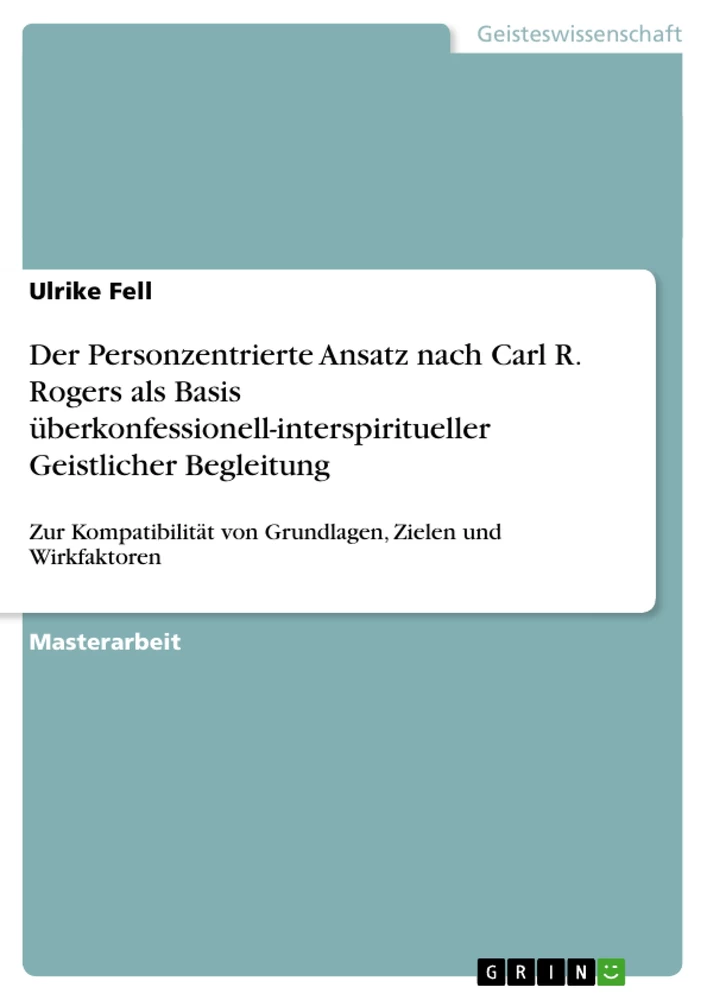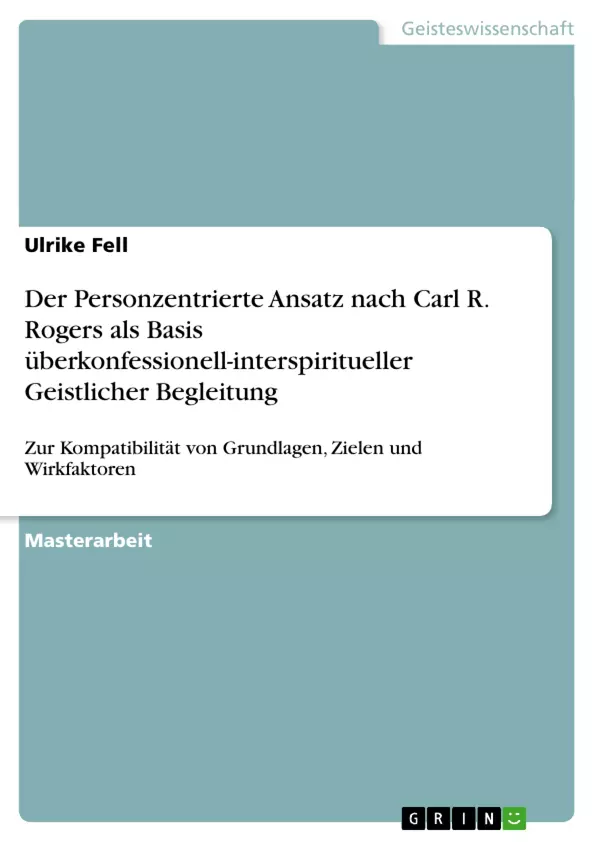Der Personzentrierte Ansatz nach Carl R. Rogers ist ein psychologischer Ansatz, kein religiös-geistlicher. Sowohl die Psychologie und die darin gründenden Psychotherapie- und Beratungsansätze als auch die Religionen und die in ihnen entwickelten Formen Geistlicher Begleitung befassen sich jedoch gleichermaßen mit Aspekten menschlichen Heil-Seins. Kennzeichnend für die Geistliche Begleitung ist, dass sie den Menschen darin unterstützen will, einen für ihn als ganzen Menschen in seiner – das macht den geistlich-religiösen Anteil aus – Transzendenzbezogenheit heilsamen Weg zu finden und zu gehen.
Religion ist auch in Westeuropa seit geraumer Zeit nicht mehr gleichbedeutend mit christlicher Religion. Andere religiöse Traditionen fassen mehr und mehr Fuß. Zunehmend wachsen Menschen andererseits inzwischen ganz ohne religiöse Anbindung auf. Und doch verspüren weiterhin viele eine Anziehung des Religiösen oder Spirituellen und sind auf der Suche. Dies stellt auch neue Anforderungen an die Geistliche Begleitung. Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgegangen, ob und inwieweit der Personzentrierte Ansatz eine Basis sein kann für eine überkonfessionell-interspirituelle Geistliche Begleitung.
In einem ersten Abschnitt wird zunächst der Personzentrierte Ansatz als solcher mit Blick auf Menschenbild, Zielsetzung und Wirkfaktoren in Grundzügen dargestellt. In einem zweiten Abschnitt folgen dann wesentliche Grundzüge der Ansätze Geistlicher Begleitung in den großen religiösen Traditionen, also der „Angebote“, sich mit persönlicher Transzendenzbezogenheit auseinander zu setzen, die traditionell zur Verfügung stehen und die die Grundlage auch einer überkonfessionell-interspirituell ausgerichteten Geistlichen Begleitung sind. Verbindende und trennende Aspekte im Vergleich zum Personzentrierten Ansatz werden aufgezeigt. In einem dritten Abschnitt werden dann auf der Basis des zuvor Untersuchten die Grundbedingungen einer überkonfessionell-interspirituellen Geistlichen Begleitung behandelt und hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit dem Personzentrierten Ansatz betrachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Der Personzentrierte Ansatz nach Carl R. Rogers
- Das dem Personzentrierten Ansatz zugrunde liegende Menschenbild
- Ziel des Personzentrierten Ansatzes
- Wirkfaktoren
- Geistliche Begleitung in den großen religiösen Traditionen
- Geistlichen Begleitung - eine begriffliche Abgrenzung
- Geistliche Begleitung, Religion und Menschenbild
- Geistliche Begleitung in den monotheistischen Religionen
- Christentum
- Geistliche Begleitung im Christentum
- Bezug zum Personzentrierten Ansatz
- Judentum
- Geistliche Begleitung im Judentum
- Bezug zum Personzentrierten Ansatz
- Islam
- Geistliche Begleitung im Islam
- Bezug zum Personzentrierten Ansatz
- Christentum
- Geistliche Begleitung in den mystisch-weisheitlichen Religionen Asiens
- Hinduismus
- Hinduismus im Überblick
- Geistliche Begleitung im Hinduismus
- Bezug zum Personzentrierten Ansatz
- Buddhismus
- Buddhismus im Überblick
- Geistliche Begleitung im Buddhismus
- Bezug zum Personzentrierten Ansatz
- Daoismus
- Daoismus im Überblick
- Geistliche Begleitung im Daoismus
- Bezug zum Personzentrierten Ansatz
- Hinduismus
- Überkonfessionell-interspirituelle Geistliche Begleitung
- Zum Begriff
- Welt- und Menschenbild
- Ein pluralistisches Welt- und Menschenbild auf der Basis der Religionen?
- Grundzüge eines religionspluralistischen Welt- und Menschenbilds
- Das religionspluralistische Welt- und Menschenbild und der Personzentrierte Ansatz
- Ziel der überkonfessionell-interspirituellen Geistlichen Begleitung
- Wirkfaktoren
- Spirituelle Praxis
- Begleitung
- Aufmerksamkeit als Grundvoraussetzung der Begleitung
- Besondere Anforderungen an die überkonfessionell-interspirituelle Begleitung
- Empathie und Verstehen
- Die Wirkfaktoren in Vergleich zum Personzentrierten Ansatz
- Zusammenschau
- Persönliches Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht die Kompatibilität des Personzentrierten Ansatzes nach Carl R. Rogers mit der überkonfessionell-interspirituellen Geistlichen Begleitung. Sie befasst sich mit den Grundlagen, Zielen und Wirkfaktoren beider Ansätze und analysiert, inwiefern sie sich ergänzen und gegenseitig bereichern können.
- Das Menschenbild des Personzentrierten Ansatzes und seine Relevanz für die Geistliche Begleitung
- Die Bedeutung von Spiritualität und Transzendenz in der Geistlichen Begleitung
- Die Herausforderungen und Chancen der überkonfessionellen Geistlichen Begleitung
- Die Rolle von Empathie, Wertschätzung und Kongruenz in beiden Ansätzen
- Die Integration von spirituellen Praktiken in die überkonfessionell-interspirituelle Begleitung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und stellt die Relevanz der Untersuchung dar. Im zweiten Kapitel wird der Personzentrierte Ansatz nach Carl R. Rogers vorgestellt, wobei das Menschenbild, das Ziel und die Wirkfaktoren des Ansatzes im Detail erläutert werden. Das dritte Kapitel widmet sich der Geistlichen Begleitung in den großen religiösen Traditionen. Es werden die verschiedenen Formen der Geistlichen Begleitung in den monotheistischen Religionen (Christentum, Judentum, Islam) sowie in den mystisch-weisheitlichen Religionen Asiens (Hinduismus, Buddhismus, Daoismus) beleuchtet. Dabei wird jeweils auf die spezifischen Merkmale der Geistlichen Begleitung in den jeweiligen Traditionen eingegangen und deren Bezug zum Personzentrierten Ansatz hergestellt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der überkonfessionell-interspirituellen Geistlichen Begleitung. Es werden der Begriff, das Welt- und Menschenbild, das Ziel und die Wirkfaktoren dieses Ansatzes diskutiert. Dabei wird insbesondere auf die Herausforderungen und Chancen der interreligiösen Begleitung eingegangen. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenschau der Ergebnisse und einem persönlichen Fazit.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Personzentrierten Ansatz, Carl R. Rogers, Geistliche Begleitung, überkonfessionell-interspirituell, Religion, Spiritualität, Transzendenz, Empathie, Wertschätzung, Kongruenz, Menschenbild, Zielsetzung, Wirkfaktoren, Kompatibilität, Integration, Pluralismus, Interreligiös.
- Citation du texte
- Ulrike Fell (Auteur), 2008, Der Personzentrierte Ansatz nach Carl R. Rogers als Basis überkonfessionell-interspiritueller Geistlicher Begleitung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132665