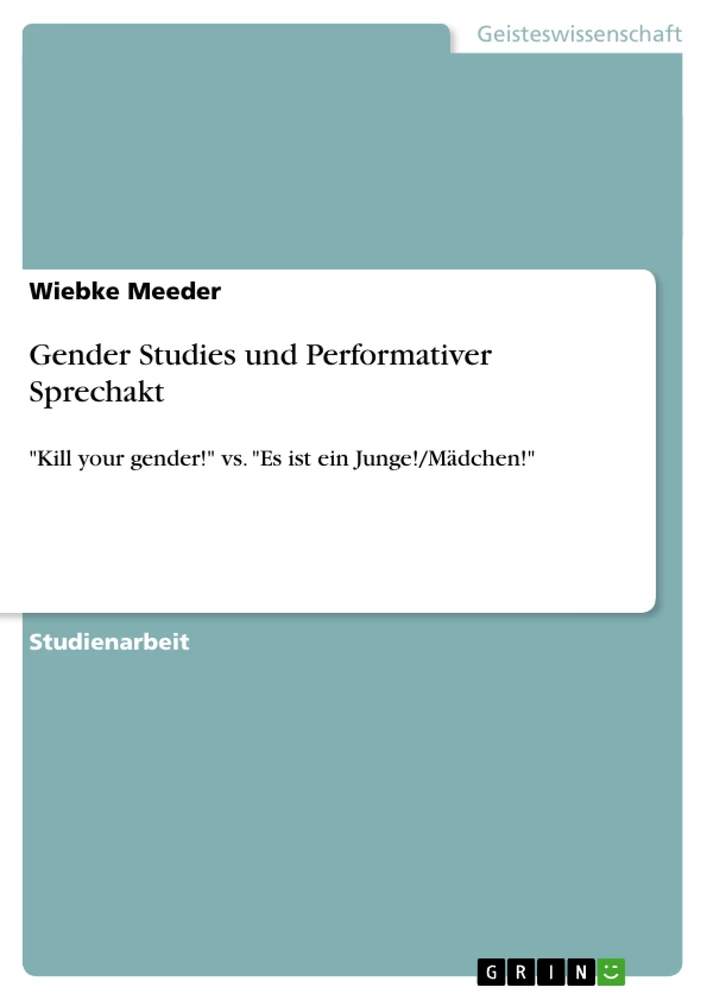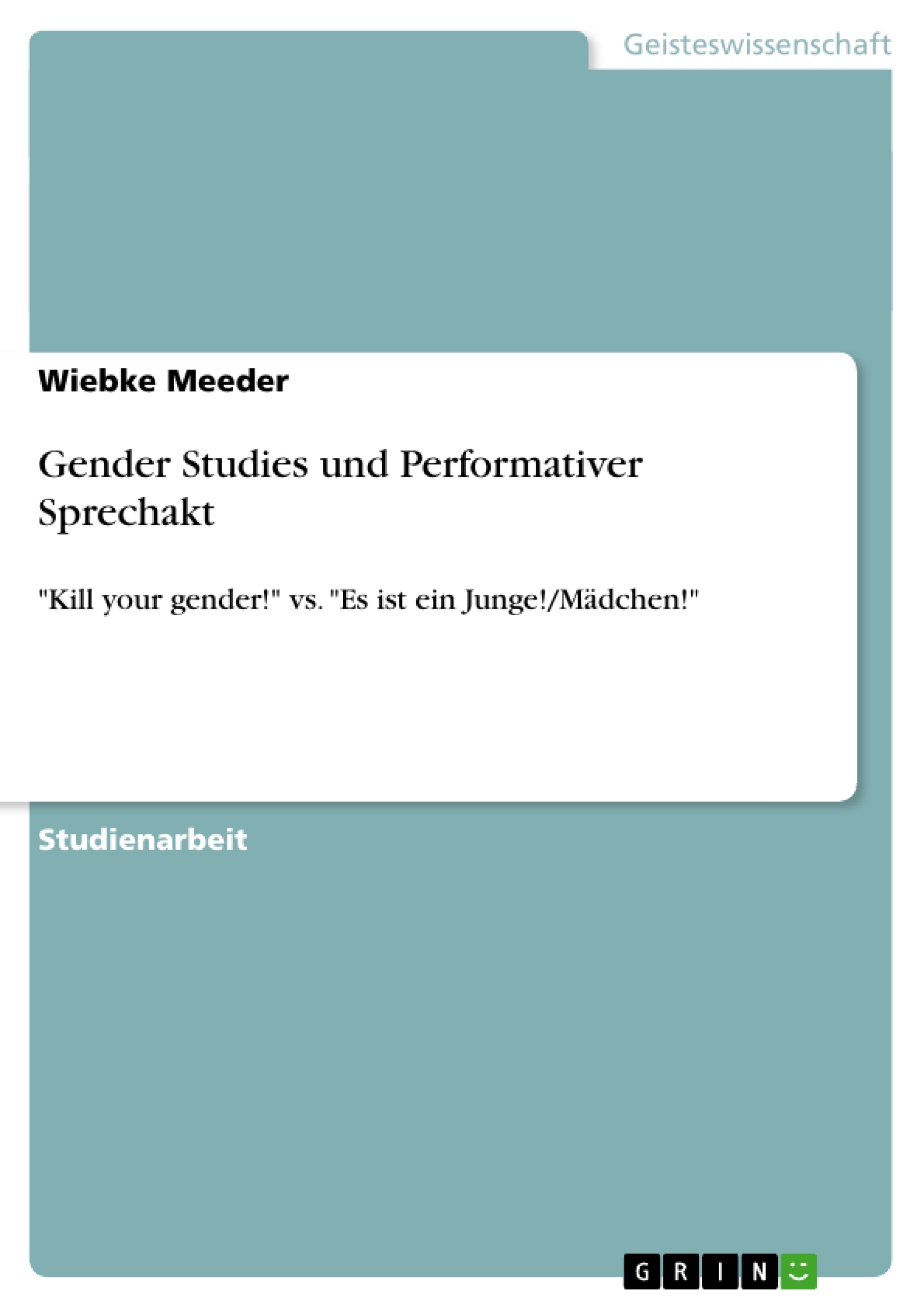Diese Arbeit soll Butlers „gender trouble“ und Austins Theorie der Sprechakte einer parallelen Lesart unterziehen. Fragestellung soll hierbei sein, inwieweit bestehende Geschlechterrollen als performative Sprechakte innerhalb von Diskursen zu verstehen sind und welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können.
Schlussfolgerungen hier hinsichtlich einer Unbestimmbarkeit der Geschlechterdifferenz und der Problematik eines binären Systems. Inwieweit ist dieses System überholt und wie lässt sich dessen mögliche Unzulänglichkeit illustrieren? Im Vordergrund der Argumentation stehen hierbei die Texte „Das Unbehagen der Geschlechter“ von Judith Butler und „Zur Theorie der Sprachakte (How to do things with words)“ von John L. Austin. Bezüglich des letzteren Bandes wird dabei der Fokus auf die siebte und achte Vorlesung des Werkes gelegt.
Im ersten Teil der Arbeit soll zunächst eine Erläuterung der Terminologie Butlers eine Einführung in den Komplex „Geschlecht und Gesellschaft“ geben, dem sich eine Annäherung der Geschlechter-Konstruktion an die performativen Sprechakte nach Austin anschließt. Des Weiteren sollen sprachpraktische Beobachtungen diesen Zusammenhang nachvollziehbar machen. Diesen Beobachtungen folgt eine Rückwendung zur binären Matrix und ihrer Stringenz, bevor die Problematik einer Geschlechterzuweisung ob eines performativen Sprechaktes thematisiert wird.
Als Exkurs soll ein kleiner Einblick in den Umgang mit Geschlechterrollen am Beispiel des Romans von Ali Smith „Girl meets boy“ stattfinden. Anhand eines Ausschnittes soll gezeigt werden, wie durch Spreche eine Verschiebung der Realitätsebene zugunsten eines Geschlechterbildes das keinem System genügt, sondern als fließend verstanden werden kann. Der springende Punkt innerhalb dieser Betrachtung – und der Arbeit als solche –liegt im Verständnis von Geschlecht als Kontinuum, in dem keine Kategorisierung Mann-Frau funktioniert, sondern die Begrifflichkeiten eher als Annäherungsversuche für Bezeichnungen (ohne die Sprache nicht funktioniert) gebraucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Sex, gender und das Ich – ein performativer Sprechakt?
- 2. Das Geschlecht als intelligibel im Sinne eines performativen Aktes
- 3. Die Zuweisung des Geschlechts als performativer Sprechakt
- 4. Problematiken der performativ erzeugten Binarität von Geschlecht
- 5. Scheitern des binären Systems in der Literatur
- 6. Fazit
- 7. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Theorie der performativen Sprechakte von John L. Austin im Kontext der Gendertheorie von Judith Butler. Sie analysiert, inwieweit bestehende Geschlechterrollen als performative Sprechakte innerhalb von Diskursen zu verstehen sind und welche Schlussfolgerungen sich daraus ergeben. Die Arbeit beleuchtet die Problematik eines binären Geschlechtermodells und untersucht, wie dieses System in der Literatur in Frage gestellt wird.
- Performative Sprechakte und Geschlechterrollen
- Die Konstruktion von Geschlecht als soziales Konstrukt
- Die Problematik der binären Geschlechtermatrix
- Die Bedeutung von Sprache und Diskurs für die Geschlechterkonstruktion
- Das Scheitern des binären Systems in der Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die theoretischen Grundlagen von Judith Butler und John L. Austin. Sie führt die Begriffe „Sex“, „Gender“ und „performativer Sprechakt“ ein und skizziert die Argumentationslinie der Arbeit.
Kapitel 1 beleuchtet die Konstruktion von Geschlecht als soziales Konstrukt und die Rolle von Diskursen in diesem Prozess. Es wird erläutert, wie Sprache und Diskurs die Wahrnehmung und Konstruktion von Geschlecht beeinflussen. Die Arbeit bezieht sich dabei auf die Theorie der performativen Sprechakte von John L. Austin und zeigt, wie diese Theorie auf die Geschlechterkonstruktion angewendet werden kann.
Kapitel 2 analysiert die Problematik der binären Geschlechtermatrix und die Folgen dieser Kategorisierung. Es wird gezeigt, wie die binäre Matrix die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten und -ausdrucksformen ignoriert und zu Diskriminierung und Ausgrenzung führt.
Kapitel 3 untersucht, wie das binäre Geschlechtermodell in der Literatur in Frage gestellt wird. Anhand des Romans „Girl meets boy“ von Ali Smith wird gezeigt, wie Sprache und Sprechakte dazu beitragen können, die Grenzen des binären Systems zu überschreiten und eine fluide Vorstellung von Geschlecht zu fördern.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Gender Studies, performative Sprechakte, Judith Butler, John L. Austin, Geschlechterrollen, Geschlechterkonstruktion, binäre Geschlechtermatrix, Diskurs, Sprache, Literatur, „Girl meets boy“ von Ali Smith.
- Quote paper
- Wiebke Meeder (Author), 2009, Gender Studies und Performativer Sprechakt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132685