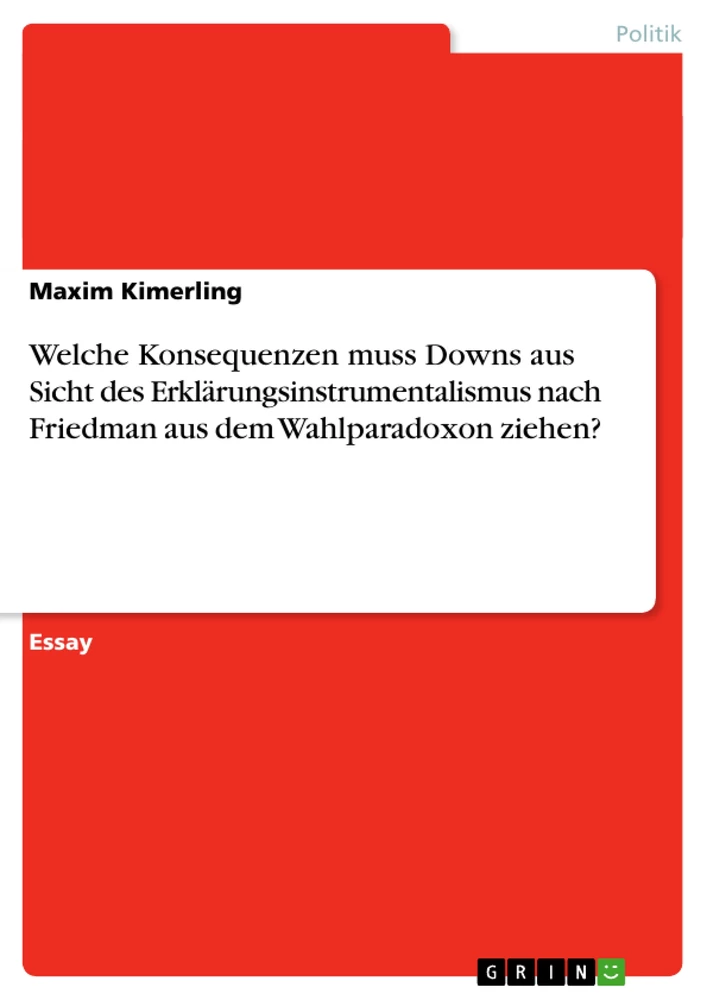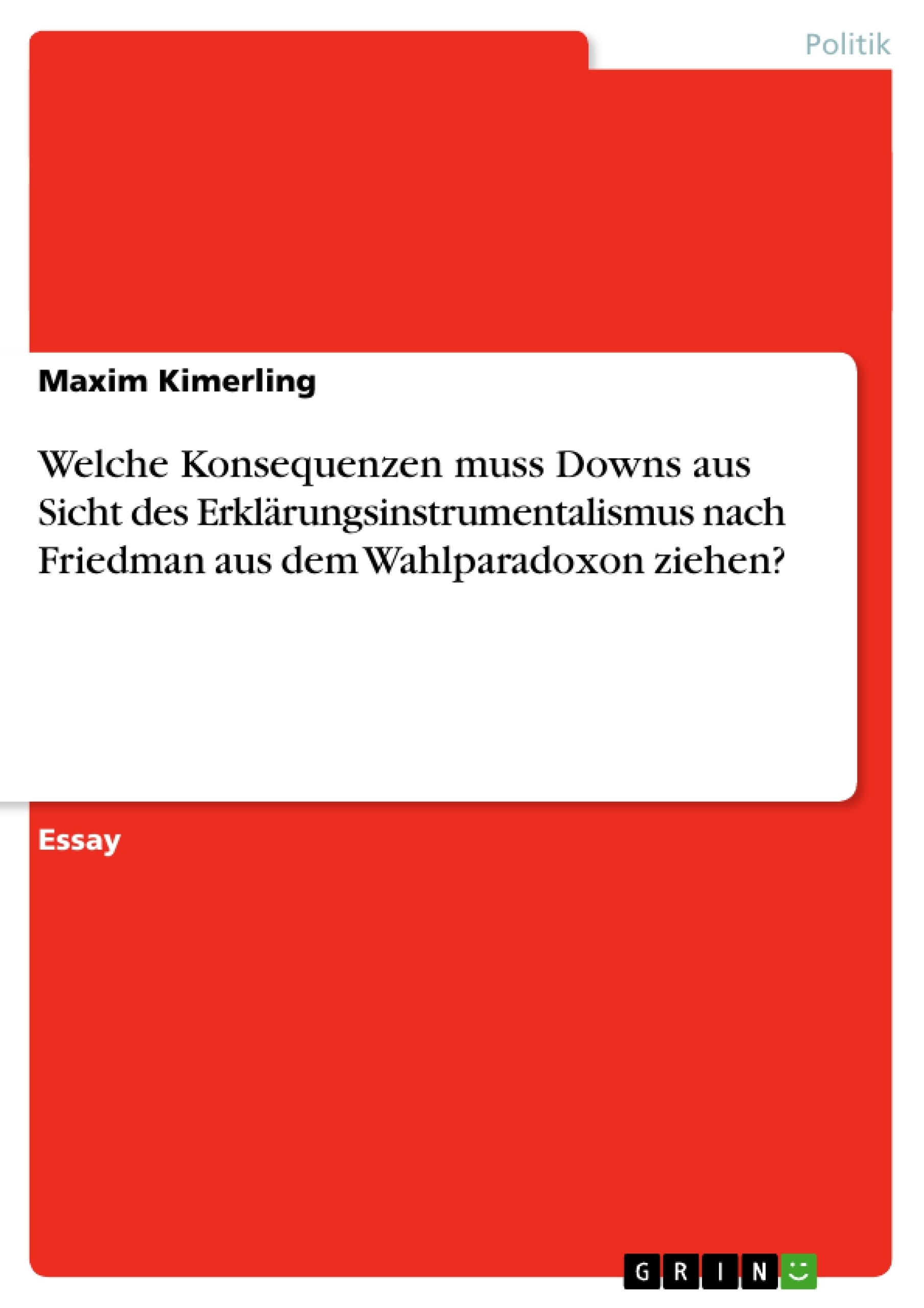Anthony Downs hat in seinem Werk „Ökonomische Theorie der Demokratie“ ein umfangreiches Modell zur Erklärung des Wählerverhaltens auf der Basis der Rational-Choice-Theorie vorgestellt. Das zentrale Element seiner Aussage ist, dass eine Wahlbeteiligung bei einem Kosten-Nutzen-Kalkül des Wählers irrational ist, selbst dann, wenn der Wähler in Bezug auf den Wahlausgang nicht indifferent ist. Downs fügt hinzu, dass die Kosten, die der Wahlgang verursacht, höher sind als der Nutzen, den der Wähler aus der Wahlbeteiligung zieht, da die einzelne Stimme einen Tropfen auf einem heißen Stein darstellt (vgl.Downs1957:238). Folglich beeinflusst die einzelne Stimme den Wahlausgang nicht und der Wahlgang wäre irrational. Diese Aussagen über die Wahlbeteiligung stimmen nicht mit der Realität überein, dies beweist die hohe Wahlbeteiligung vieler Staaten. Ziel meines Essays ist es aufzuzeigen, welche Konsequenzen Downs aus Sicht des Erklärungsinstrumentalismus nach Friedman aus diesem Paradox ziehen muss.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Friedmans Instrumentalismus
3. Ökonomische Theorie des Wählerverhaltens
3.1 Annahmen
3.2 Parteidifferenzial
3.3 Unsicherheit
3.4 Informationskosten
3.5 Wahlparadoxon
4. Ökonomische Theorie – Olson
5. Expressive Theorie des Wählerverhaltens
6. Fazit
7. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Anthony Downs hat in seinem Werk „Ökonomische Theorie der Demokratie“ ein umfangreiches Modell zur Erklärung des Wählerverhaltens auf der Basis der Rational-Choice-Theorie vorgestellt. Das zentrale Element seiner Aussage ist, dass eine Wahlbeteiligung bei einem Kosten-Nutzen-Kalkül des Wählers irrational ist, selbst dann, wenn der Wähler in Bezug auf den Wahlausgang nicht indifferent ist. Downs fügt hinzu, dass die Kosten, die der Wahlgang verursacht, höher sind als der Nutzen, den der Wähler aus der Wahlbeteiligung zieht, da die einzelne Stimme einen Tropfen auf einem heißen Stein darstellt (vgl.Downs1957:238). Folglich beeinflusst die einzelne Stimme den Wahlausgang nicht und der Wahlgang wäre irrational. Diese Aussagen über die Wahlbeteiligung stimmen nicht mit der Realität überein, dies beweist die hohe Wahlbeteiligung vieler Staaten. Ziel meines Essays ist es aufzuzeigen, welche Konsequenzen Downs aus Sicht des Erklärungsinstrumentalismus nach Friedman aus diesem Paradox ziehen muss.
2. Friedmans Instrumentalismus
Seit der antiken Philosophie ist die Suche nach der Wahrheit das klassische Ziel der Wissenschaft. Die Moderne brachte mit dem Werk Poppers eine ernüchternde Erkenntnis mit, wonach (vgl.Schröder2004:71) „Wahrheit ein unerreichbares Ideal darstellt“ (Popper2002;S. xxv). Erfüllt von der Skepsis fügt Popper hinzu, dass sicheres Wissen uns versagt ist und dass eine Annäherung an die Wahrheit möglich sei (vgl.ebd.). Friedman stemmt sich gegen die Idee des wahren Wissens (vgl.Hempel/Oppenheim1970:10) und auch gegen Poppers Forderung an die Annäherung an wahres Wissen. Friedman geht davon aus, dass das Ziel einer „positiven“ (Kromphardt1982:917) Wissenschaft sei die Entwicklung einer Theorie oder Hypothese „that yields valid and meaningful predictions about phenomena not yet observed“ (Friedman1953:7). Daraus resultiert der instrumentalistische Bewertungsmaßstab für die empirische Geltung von Theorien. Die Realitätsnähe der Annahmen, die der jeweiligen Theorie zugrunde liegen, spielt für diesen Bewertungsmaßstab keine Rolle (vgl.Kromphardt1982:917) „the only relevant test of the validity of a hypothesis is comparison of ist predictions with experience“ (Friedman1953:8f.). Das realistische Wissenschaftsverständnis fordert, dass das Explanans, damit es adäquat sei, aus empirisch zutreffenden Annahmen gebildet sein muss. Das instrumentalistische Wissenschaftsverständnis hingegen fordert nicht, dass die Prämissen, aus denen das Explanans gebildet wird, mit den realen Tatsachen übereinstimmen (vgl.Kromphardt1982:917f.). In groben Zügen lässt sich sagen, dass es Friedman um praktischen Wert, den Theorien haben, geht. Die Nützlichkeit und nicht Realitätsgehalt wird zum zentralen Kriterium der Theoriebildung (vgl.Schröder2004:172). Wenn also Prognosen – die aus einer bestimmten Theorie abgeleitet – sich als richtig erweisen, oder aber nicht völlig verfehlt, so ist es nicht verboten von falschen Voraussetzungen auszugehen (vgl.Schröder2004:173f.). Friedman geht weiter und sagt, dass „die Idee von realistischen Voraussetzungen eine Illusion“ sei und deshalb, so sein Argument, „die Wahl von theoretischen Annahmen nicht davon geleitet werden, wie realistisch diese sind, sondern wie genau die durch die Annahmen generierten Vorhersagen sind“ (vgl.Hedström2008:93). Eine ausgezeichnete Erklärung benötigt Vereinfachung und „erklärt viel aus wenig“ (Friedman1953:14). Das hat zur Folge, dass eine auf wenigen Annahmen beruhende Theorie, die fruchtbare Erklärungen liefert, gut ist (vgl.Friedman1953:20).
Viele Forscher werden von Friedman und seinem Instrumentalismus beeinflusst. Einer davon ist Downs. Downs stellt sein „Weltbild von der Wissenschaft“ in den Dienst des Instrumentalismus.
3. Ökonomische Theorie des Wählerverhaltens
3. 1 Annahmen
Die Rational-Choice-Theorie bildet das Fundament für die Downs’sche Theorie. Die Theorie beruht auf zwei Annahmen: Erstens auf dem Prinzip des methodologischen Individualismus. Danach sind soziale Phänomene auf die individuellen Handlungen von Individuen zurückzuführen. Für die Erklärung sozialer Phänomene, wird das soziale Phänomen als Folge individueller Handlungen rekonstruiert. Ferner erfolgt die Erklärung individueller Handlungen mit Hilfe eines Akteursmodells (vgl.Beyme2000:136f.). Ganz im Friedman’schen Sinne zählt für Downs, dass theoretische Modelle nur gemäß der Qualität ihrer Vorhersagen und nicht gemäß dem Realitätsgehalt ihrer Annahmen zu beurteilen sind (vgl.Downs1957:21).
Zweitens spielt die Rationalität eine entscheidende Rolle. Ein rationaler Mensch – Homo Oeconomicus – handelt nur dann rational, wenn er aus einer Menge von Alternativen eine Entscheidung treffen kann, die ihm mit dem geringsten Aufwand den größten Nutzen verspricht. Sein Ziel wäre beispielsweise der Sieg seiner Partei. Ferner unterliegt er in seinem Verhalten dem Eigennutzaxiom und bei seiner Entscheidung Restriktionen, die Einfluss auf die Befriedigung der Präferenzen haben könnten (vgl.Kunz2004:36). Der Wähler ist z.B. an ein bestimmtes Wahl- und Parteiensystem gebunden und somit steht ihm lediglich die Wahl zwischen den zur Wahl stehenden Parteien, zu. Ferner besitzt er nur eine Stimme, die eben so viel zählt, wie die Stimmen der übrigen Wähler. Weiterhin ist es für rationales Handeln erforderlich, dass der Mensch die Alternativen, denen er gegenüber steht ordnet, nämlich nach seinen Präferenzen, so dass die Verhaltensalternativen entsprechend der Präferenzordnung zu bewerten sind. Weiterhin muss seine Präferenzordnung transitiv sein und er wählt aus den Alternativen immer diejenige aus, die in seiner Präferenzordnung den höchsten Rang einnimmt. Außerdem wird er – wenn er vor gleiche Alternativen gestellt wird – immer die gleiche Entscheidung treffen (vgl.Downs1957:6).
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Wahlparadoxon“ nach Anthony Downs?
Es beschreibt die Theorie, dass Wählen für ein rational handelndes Individuum irrational ist, da die Kosten (Zeit, Aufwand) den erwarteten Nutzen einer einzelnen Stimme übersteigen.
Was besagt der Erklärungsinstrumentalismus nach Milton Friedman?
Friedman argumentiert, dass die Güte einer Theorie nicht an der Realitätsnähe ihrer Annahmen, sondern ausschließlich an der Genauigkeit ihrer Vorhersagen gemessen werden sollte.
Wie nutzt Downs das Modell des „Homo Oeconomicus“?
Er setzt voraus, dass Wähler rein eigennützig handeln und sich für die Alternative entscheiden, die ihnen den größten persönlichen Nutzen verspricht.
Welche Konsequenzen ergeben sich für Downs aus Friedmans Sicht?
Wenn die Vorhersage (niedrige Wahlbeteiligung) nicht mit der Realität (hohe Wahlbeteiligung) übereinstimmt, müsste die Theorie nach Friedman als ungültig verworfen oder modifiziert werden.
Was sind Informationskosten im Kontext der Wahltheorie?
Dies ist der Aufwand, den ein Wähler betreiben muss, um sich über Parteiprogramme zu informieren, was die „Kosten“ des Wählens weiter erhöht.
- Citation du texte
- Maxim Kimerling (Auteur), 2009, Welche Konsequenzen muss Downs aus Sicht des Erklärungsinstrumentalismus nach Friedman aus dem Wahlparadoxon ziehen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132708