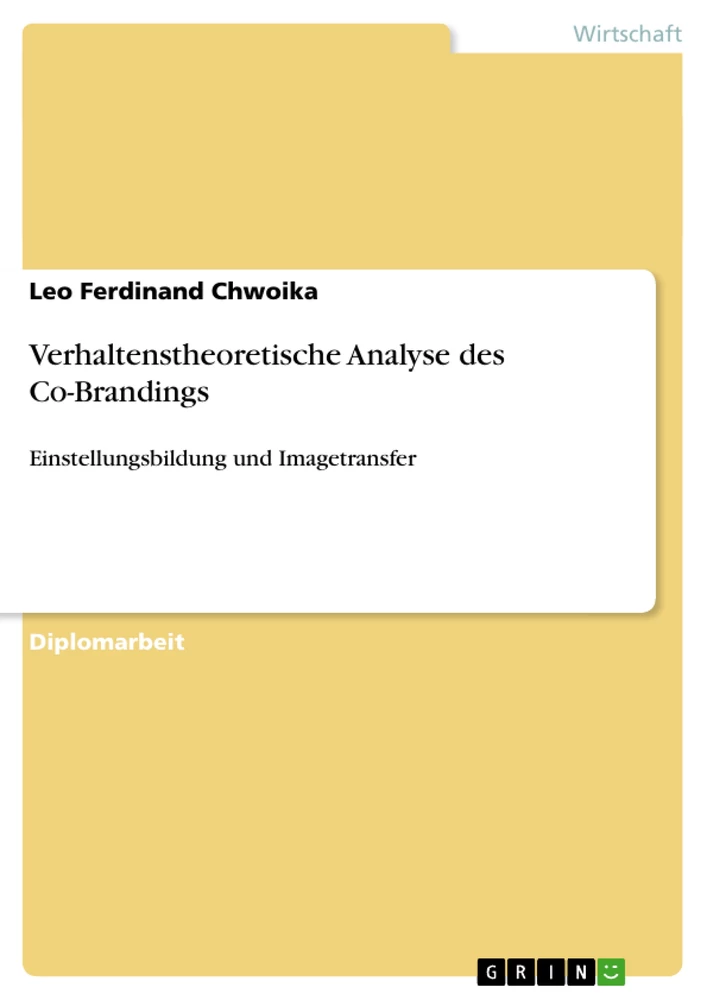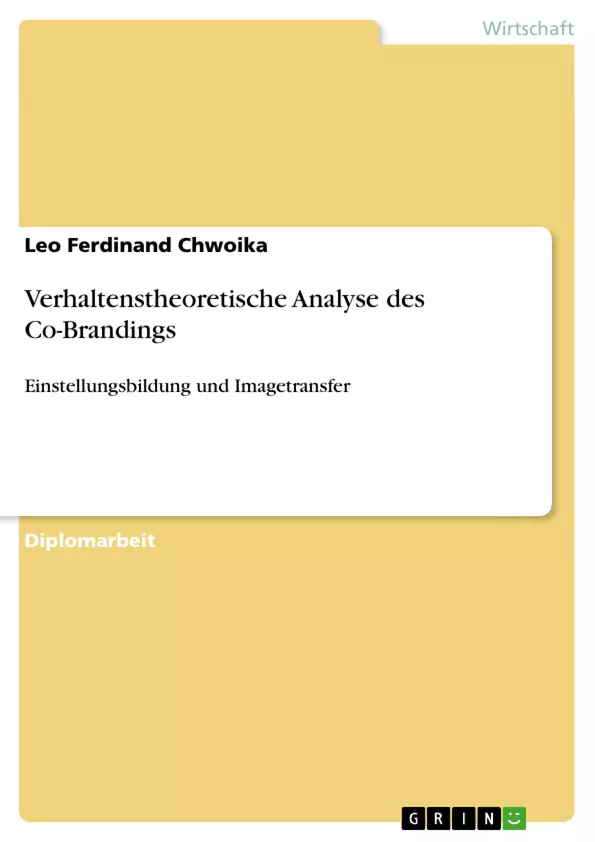Die Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln auf Konsumgütermärkten haben in den letzten Jahren gravierende Veränderungen erfahren. Aufgrund von mehr und mehr gesättigten Märkten, einer steigenden Vielfalt an Marken bzw. Produkten und einer damit einhergehenden Informationsüberlastung der Konsumenten besteht für die Unternehmen zunehmend die Notwendigkeit, sich über das Angebot eines immateriellen, emotionalen Mehrwertes zu differenzieren. Dieser emotionale Zusatznutzen wird von Seiten der Kunden häufig in Form eines Kaufes bestimmter Marken konsumiert.
Da auf Grund der genannten Marktbedingungen für Unternehmen allerdings nicht nur die Notwendigkeit besteht, starke Marken zu besitzen, sondern auch die Schwierigkeit, sowie die Kosten steigen, neue Marken bzw. Produkte erfolgreich einzuführen, wird zu diesem Zweck häufig auf Markentransferstrategien zurückgegriffen.
Unter dem Begriff "Co-Branding" als eine solche Markentransferstrategie wird im weitesten Sinne „der gemeinsame Auftritt wenigstens zweier selbstständiger Marken“ verstanden (Esch 2005, S.360).
Die vorliegende Arbeit erklärt die Wirkung eines solchen Co-Brandings unter verhaltenstheoretischen Gesichtspunkten anhand des Beurteilungsprozesses der Konsumenten und dem damit einhergehenden Einstellungs- bzw. Imagetransfer zwischen den mindestens zwei konstituierenden Partnermarken und dem Co-Branding-Produkt.
Dabei wird im Kapitel 2, das die Marke als eine gelernte Wissensstruktur im Kopf des Konsumenten sowie einstellungs- und imagetheoretische Grundlagen thematisiert, zunächst die verhaltenstheoretische Basis der Markenpolitik erläutert, bevor der Begriff des Co-Brandings im Kapitel 3 begrifflich eingeordnet und abgegrenzt sowie grundsätzliche Wirkungsmechanismen und Potentiale dieser Strategie vorgestellt werden.
Im abschließenden Kapitel 4 wird der Beurteilungsprozess bezüglich eines Co-Brands im Hinblick auf seine Wirkungsweise und relevante Einflussfaktoren auf theoretischer Basis sowie anhand ausgewählter empirischer Ergebnisse der Co-Brand-Forschung erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verhaltenstheoretische Grundlagen der Markenpolitik
- Die Marke als Gedächtnisstruktur
- Der Begriff der „Marke“
- Semantische Netzwerke und Markenschemata
- Merkmale von Markenschemata
- Die Einstellung
- Markenimage und Markenbekanntheit
- Die Marke als Gedächtnisstruktur
- Co-Branding
- Grundlagen der Markenpolitik
- Erscheinungsformen und Nutzen von Marken
- Die Markenpolitik und ihre Ziele
- Der Begriff des Co-Brandings
- Markenkombinationen als Markenstrategie
- Begriffsabgrenzung und Definition
- Wirkung und Chancen des Co-Brandings
- Die Interaktion von Gedächtnisstrukturen
- Chancen durch das Co-Brand
- Chancen für die Einzelmarken
- Grundlagen der Markenpolitik
- Die Wirkung des Co-Brandings
- Ansätze zur Erklärung der Co-Branding-Effekte
- Persönlichkeits- und Sozialtheorien
- Ansätze zum Vorwärtstransfer
- Einstellungstheoretischer Ansatz
- Kognitiver Ansatz
- Ansätze zum Rückwärtstransfer
- Einstellungstheoretischer Ansatz
- Kognitiver Ansatz
- Erfolgsfaktoren des Co-Brandings
- Das Co-Brand als Wirkungsebene
- Markenstärke und Einstellungstransfer
- Der Fit
- Die Wirkung des Marketing-Mixes
- Persönlichkeits- und Sozialfaktoren
- Die Einzelmarken als Wirkungsebene
- Das Co-Brand als Wirkungsebene
- Risiken des Co-Brandings
- Ansätze zur Erklärung der Co-Branding-Effekte
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der verhaltenstheoretischen Analyse des Co-Brandings. Ziel ist es, die Entstehung und Wirkung von Co-Branding-Strategien aus Sicht der Konsumenten zu untersuchen. Dabei werden insbesondere die Prozesse der Einstellungsbildung und des Imagetransfers im Kontext von Markenkombinationen betrachtet.
- Die Rolle von Markenschemata und Gedächtnisstrukturen bei der Verarbeitung von Markeninformationen
- Die Entstehung von Einstellungen gegenüber Co-Brands und die Einflussfaktoren auf diese Einstellungen
- Der Imagetransfer zwischen den beteiligten Marken und die Auswirkungen auf die Markenwahrnehmung
- Die Erfolgsfaktoren und Risiken von Co-Branding-Strategien
- Die Bedeutung von Fit und Markenstärke für den Erfolg von Co-Branding-Kooperationen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Co-Branding ein und erläutert die Relevanz der Thematik für die Markenpolitik. Sie stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise der Arbeit dar.
Kapitel 2 beleuchtet die verhaltenstheoretischen Grundlagen der Markenpolitik. Es werden die Konzepte der Marke als Gedächtnisstruktur, des Markenschemas und der Einstellung erläutert. Dabei wird insbesondere auf die Bedeutung von semantischen Netzwerken und der Interaktion von Markenschemata eingegangen.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit dem Begriff des Co-Brandings. Es werden die verschiedenen Erscheinungsformen und Nutzen von Markenkombinationen vorgestellt. Die Definition des Co-Brandings wird abgegrenzt und die Chancen und Risiken dieser Strategie werden diskutiert.
Kapitel 4 analysiert die Wirkung des Co-Brandings. Es werden verschiedene Ansätze zur Erklärung der Co-Branding-Effekte vorgestellt, darunter Persönlichkeits- und Sozialtheorien, sowie Ansätze zum Vorwärts- und Rückwärtstransfer. Die Erfolgsfaktoren und Risiken des Co-Brandings werden im Detail betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Co-Branding, Markenpolitik, Markenmanagement, Einstellungsbildung, Imagetransfer, Markenstärke, Fit, Gedächtnisstrukturen, Markenschemata, Konsumentenverhalten, Marketing-Mix, Erfolgsfaktoren, Risiken.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Co-Branding?
Co-Branding ist der gemeinsame Auftritt von mindestens zwei selbstständigen Marken in einem Produkt oder einer Dienstleistung.
Wie wirkt Co-Branding auf den Konsumenten?
Es findet ein Einstellungs- und Imagetransfer statt, bei dem die positiven (oder negativen) Merkmale der Partnermarken auf das neue Produkt übertragen werden.
Was ist der "Fit" beim Co-Branding?
Der "Fit" beschreibt die wahrgenommene Passfähigkeit der beiden Marken; ein hoher Fit ist entscheidend für den Erfolg der Kooperation.
Welche Risiken birgt Co-Branding?
Ein Risiko ist der negative Rücktransfer: Wenn das Co-Branding-Produkt floppt, kann dies das Image der beteiligten Einzelmarken beschädigen.
Warum nutzen Unternehmen Markentransfers?
Um die hohen Kosten und Risiken einer völlig neuen Markeneinführung zu senken und von der Bekanntheit bestehender Marken zu profitieren.
- Quote paper
- Leo Ferdinand Chwoika (Author), 2006, Verhaltenstheoretische Analyse des Co-Brandings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132732