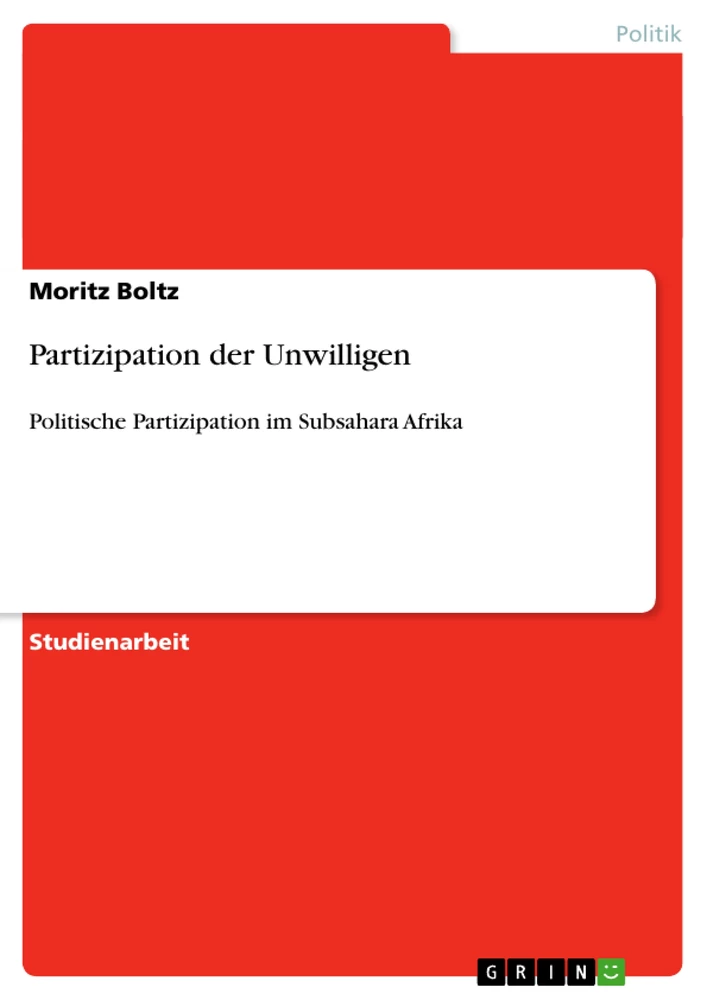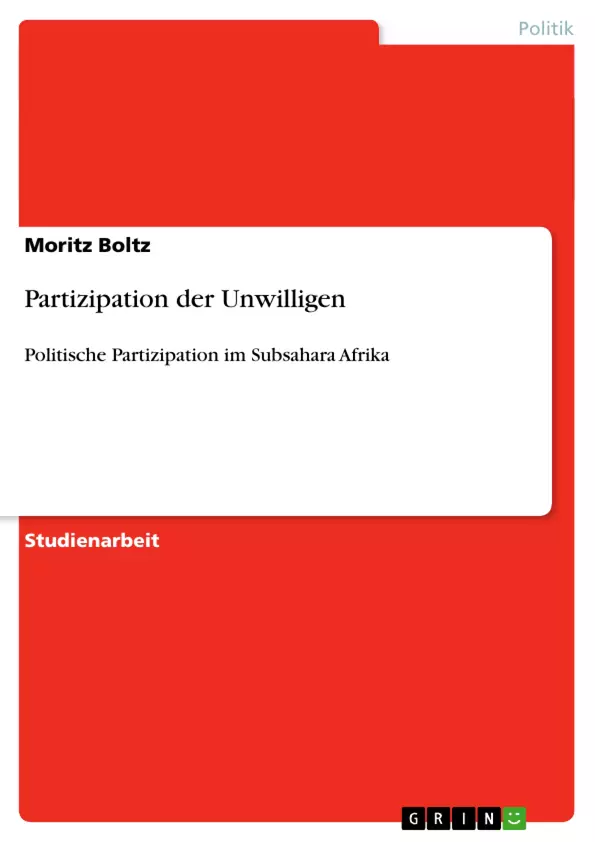Bürgerkriege sind längst zur bestimmenden Form kriegerischer Auseinandersetzung geworden und haben den Staatenkrieg, wie er von Carl von Clausewitz beschrieben wird, längst verdrängt. So stellt das Heidelberger Institut for International Conflict Research in seinem Bericht über das Jahr 2008 38 innerstaatlichen Kriegen oder ernsten Krisen nur genau einen interstaatlichen Krieg gegenüber. Besonders betroffen von den Konflikten um nationale Macht ist Afrika südlich der Sahara. In den 43 betrachteten Ländern dieser Arbeit kam es nach 1990 in 18 Ländern zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Keine andere Region der Welt ist so von erbarmungsloser Gewalt heimgesucht wie das Subsahara Afrika. Auch für die internationale Staatenwelt war und ist der schwarze Kontinent ein Brennpunkt – zehn von neunzehn „complex peace operations“ der UN fanden nach dem Ende des Kalten Krieges auf afrikanischem Boden statt. Eine besonders schwerwiegende Rolle in den Auseinandersetzungen spielen die Gewaltakteure. Sie entscheiden über die Wahl der Mittel, über die Belastung der zivilen Bevölkerung und nicht zu letzt über erfolgreiche Friedensbemühungen. Sehr oft werden politische, ökonomische oder ethnische Zielsetzungen nicht mit politischen Mitteln verfolgt, sondern mit dem Einsatz von organisierter Gewalt. Doch warum entziehen sich Gewaltakteure politischer Partizipation und wann sind sie bereit an den Verhandlungstisch zurück zu kehren?
Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit politischer Partizipation in Bürgerkriegskonstellationen. Um die Entscheidungen von Akteuren genauer erforschen zu können, werden zunächst einige Arbeitshypothesen aufgestellt. Diese sollen dann empirisch anhand der afrikanischen Länder südlich der Sahara überprüft werden. Ziel ist es, Richtlinien zu bestimmen anhand derer sich die Partizipationswahrscheinlichkeiten einschätzen lassen. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf folgende Aspekte gelegt: Zunächst soll die Kosten-Nutzen-Bilanz der Akteure, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zugang zu leicht abbaubaren Ressourcen, der Durchsetzung eigener Ziele sowie der Verschiebung von Machtkapazitäten thematisiert werden. Zweitens gilt es Institutionalisierungsprozesse sowie drittens Brüche in den sozial konstruierten Identitäten der Gewaltakteure zu analysieren. werden. Abschließend sollen viertens die Konflikte anhand der Theorie zur Eigendynamik entfesselter Gewalt von Peter Waldmann überprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
- Der geplagte Kontinent
- Die Länderauswahl der Fallstudie
- Länder mit heftigen internen Konflikten nach 1990
- Zusammenstellung der einzelnen Kriege und Konflikte
- Die Anwendung der Arbeitshypothesen
- Die rationale Hypothese – Partizipation bei sich ändernder Kosten-Nutzen-Bilanz
- Partizipation bei Veränderung des Ressourcenzugangs
- Partizipation bei Loyalitätspreisveränderungen
- Verschiebung der Machtkapazitäten
- Die bürokratische Hypothese
- Die sozialkonstruktivistische Hypothese – Partizipation bei sich ändernder Identität
- Die drei Identitätsgruppen
- Partizipation und „Alter-Casting"
- Die strukturelle Hypothese - Partizipation bei sich ändernden Gewaltordnungen
- Die rationale Hypothese – Partizipation bei sich ändernder Kosten-Nutzen-Bilanz
- Politische Implikationen
- Afrika und die Verantwortung der internationalen Staatengemeinschaft
- Bibliographie
- Literatur über die Länder des Subsahara Afrika
- Literatur zu Bürgerkriegen
- Internetquellen
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Partizipation von Bürgerkriegsparteien in Subsahara-Afrika ab den 1990er Jahren. Ziel ist es, die Faktoren zu identifizieren, die die Entscheidung von Gewaltakteuren beeinflussen, sich politischer Partizipation zu entziehen oder ihr wieder zuzuwenden. Die Arbeit untersucht verschiedene Hypothesen, die diese Entscheidungen erklären können, darunter die rationale Hypothese, die bürokratische Hypothese, die sozialkonstruktivistische Hypothese und die strukturelle Hypothese.
- Kosten-Nutzen-Bilanz von Gewaltakteuren
- Institutionalisierungsprozesse
- Identitätskonstruktionen von Gewaltakteuren
- Eigendynamik entfesselter Gewalt
- Partizipationsangebote in Bürgerkriegskonstellationen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Bedeutung von Bürgerkriegen in der heutigen Welt und stellt Afrika südlich der Sahara als besonders von Konflikten betroffene Region dar. Es wird die Rolle von Gewaltakteuren in diesen Konflikten und die Frage nach ihrer Bereitschaft zur politischen Partizipation aufgeworfen.
Das zweite Kapitel beschreibt die Länderauswahl der Fallstudie. Es werden die 42 Staaten des Subsahara-Afrika vorgestellt und die Kriterien für die Auswahl von 18 Ländern mit heftigen internen Konflikten nach 1990 erläutert. Die einzelnen Kriege und Konflikte in diesen Ländern werden in einer Tabelle zusammengefasst.
Das dritte Kapitel widmet sich der Anwendung der Arbeitshypothesen. Die rationale Hypothese untersucht die Kosten-Nutzen-Bilanz von Gewaltakteuren im Zusammenhang mit dem Zugang zu Ressourcen, der Durchsetzung eigener Ziele und der Verschiebung von Machtkapazitäten. Die bürokratische Hypothese analysiert die Rolle von Institutionalisierungsprozessen. Die sozialkonstruktivistische Hypothese betrachtet die Bedeutung von Identitätskonstruktionen für die Partizipationsentscheidung von Gewaltakteuren. Die strukturelle Hypothese untersucht die Eigendynamik entfesselter Gewalt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Bürgerkriege, politische Partizipation, Subsahara-Afrika, Gewaltakteure, Kosten-Nutzen-Bilanz, Institutionalisierung, Identitätskonstruktionen, Eigendynamik entfesselter Gewalt, Ressourcenzugang, Machtverschiebung, Konfliktforschung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Subsahara-Afrika ein Schwerpunkt dieser Konfliktanalyse?
Die Region ist weltweit am stärksten von innerstaatlichen Bürgerkriegen und erbarmungsloser organisierter Gewalt betroffen.
Was untersucht die "rationale Hypothese" in Bezug auf Gewaltakteure?
Sie analysiert die Kosten-Nutzen-Bilanz der Akteure, insbesondere den Zugang zu wertvollen Ressourcen wie Diamanten oder Öl.
Welche Rolle spielt die Identität bei der politischen Partizipation?
Die sozialkonstruktivistische Hypothese untersucht, wie Brüche in der Identität von Gewaltakteuren deren Bereitschaft zur Rückkehr an den Verhandlungstisch beeinflussen.
Was besagt die Theorie zur Eigendynamik entfesselter Gewalt?
Nach Peter Waldmann entwickeln Konflikte eine eigene Dynamik, die Gewaltakteure dazu bringt, politische Ziele zugunsten der Gewaltanwendung zu vernachlässigen.
Wie viele afrikanische Länder wurden in der Fallstudie untersucht?
Die Arbeit betrachtet 43 Länder, von denen 18 nach dem Jahr 1990 von schweren kriegerischen Auseinandersetzungen betroffen waren.
Wann sind Gewaltakteure bereit, sich politisch zu beteiligen?
Dies geschieht oft bei Verschiebungen der Machtkapazitäten, Änderungen im Ressourcenzugang oder durch Institutionalisierungsprozesse.
- Quote paper
- Moritz Boltz (Author), 2009, Partizipation der Unwilligen , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132749