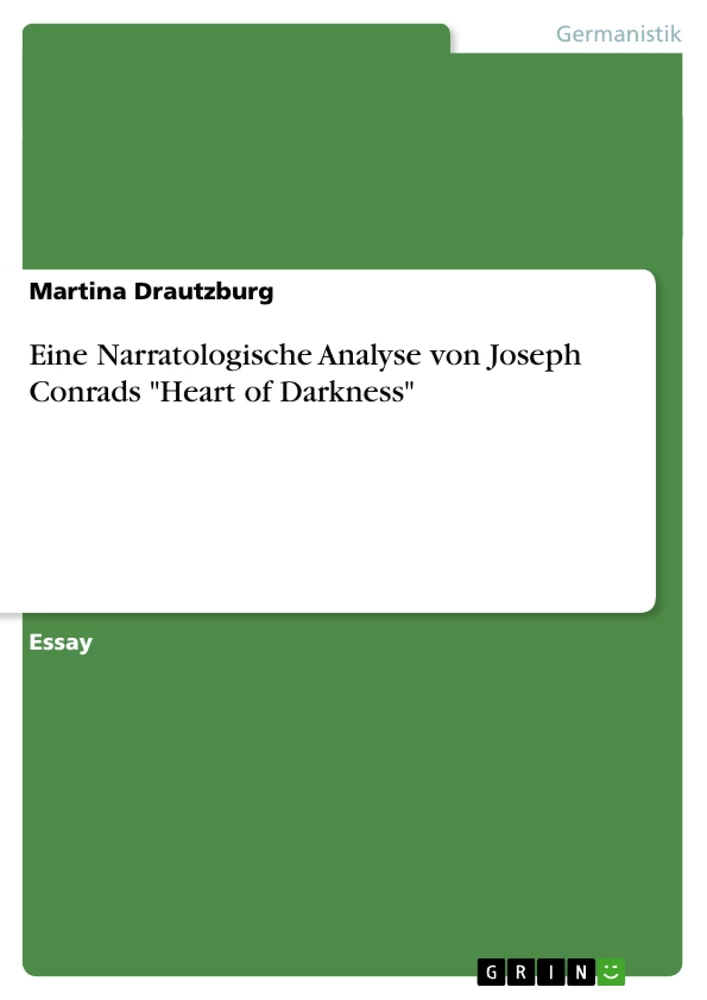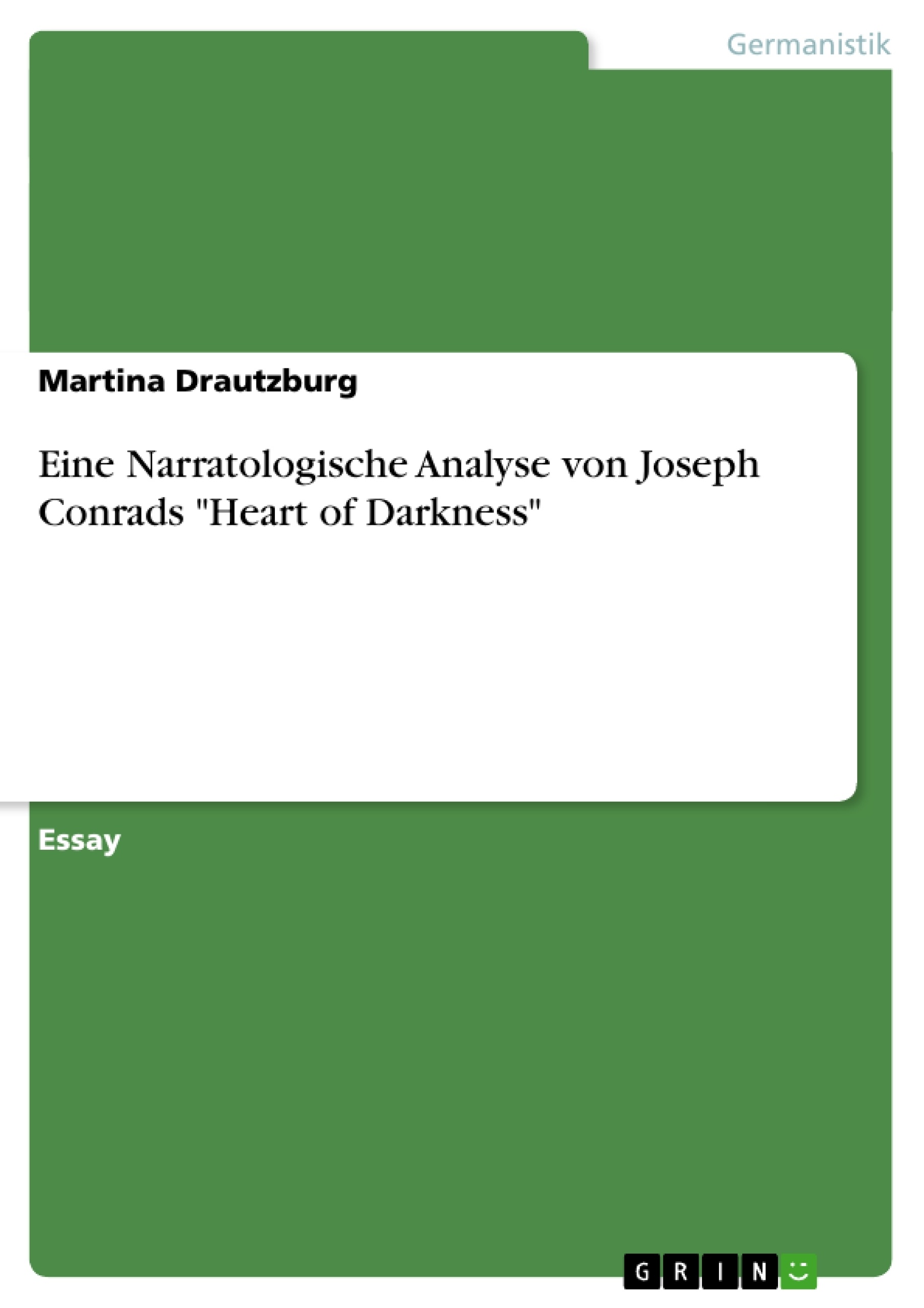Eine narratologische Analyse (Grundlage sind die Kategorien von Genette) von Joseph Conrads Erzählung "Heart of Darkness" sowie die Interpretation des Textes vor dem Hintergrund postkolonialer Theorien.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Identität
- Narration/Fokalisierung
- Alterität
- Story
- Figurendarstellung/Perspektivenstruktur
- Hybridität
- Raum
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Joseph Conrads Erzählung "Heart of Darkness" unter narratologischen Gesichtspunkten, um die formalen und sprachlichen Mittel zu untersuchen, die Conrad verwendet, um sein Bild von Afrika und den schwarzen Ureinwohnern zu vermitteln. Dabei wird ein konstruktivistisches Literaturverständnis zugrunde gelegt, das Texte als Ausdruck kultureller Selbstverständigung betrachtet, die gesellschaftliche Wirklichkeitskonstruktionen generieren.
- Identität und die Konstruktion des Selbst im Kontext der Kolonialisierung
- Die Rolle der Narration und Fokalisierung in der Darstellung von Machtverhältnissen
- Die Konstruktion von Alterität und die Darstellung der "anderen" in "Heart of Darkness"
- Hybridität und die Vermischung von Kulturen und Perspektiven
- Die Bedeutung von Sprache und Sprachgebrauch in der Konstruktion von Identität und Alterität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der narratologischen Analyse von "Heart of Darkness" ein und stellt die Zielsetzung der Arbeit dar. Sie beleuchtet die Bedeutung des Romans im Kontext der englischsprachigen Literatur und die zentrale Rolle der Figur Mister Kurtz als Verkörperung von Korruption und Ausbeutung.
Das Kapitel "Identität" untersucht die Konstruktion von Identität im Kontext der postkolonialen Theorie. Es wird argumentiert, dass Identität ein Konstrukt ist, das sich in einem ständigen Prozess der Auflösung und Neuformation befindet. Die Kategorien der Narration und Fokalisierung werden als wichtige Werkzeuge zur Analyse von Identitätskonstruktionen in "Heart of Darkness" vorgestellt.
Das Kapitel "Alterität" befasst sich mit der Darstellung von Gegensätzen und der Konstruktion des "Anderen" in "Heart of Darkness". Es wird gezeigt, wie die Darstellung der schwarzen Ureinwohner als Klischees und Stereotype die dominanten Machtverhältnisse der Kolonialisierung widerspiegeln.
Das Kapitel "Hybridität" untersucht die Vermischung von Kulturen und Perspektiven in "Heart of Darkness". Es wird gezeigt, wie der Raum als Ort der Begegnung und des Konflikts zwischen verschiedenen Kulturen fungiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die narratologische Analyse, Joseph Conrad, "Heart of Darkness", postkoloniale Theorie, Identität, Alterität, Hybridität, Kolonialismus, Imperialismus, Afrika, Schwarze Ureinwohner, Narration, Fokalisierung, Sprache, Sprachgebrauch, Figurendarstellung, Perspektivenstruktur, Raum.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der narratologischen Analyse von „Heart of Darkness“?
Die Untersuchung analysiert die formalen Erzählmittel von Joseph Conrad, um zu verstehen, wie er Identität, Alterität (das Fremde) und postkoloniale Machtstrukturen konstruiert.
Was bedeutet „Fokalisierung“ in dieser Analyse?
Fokalisierung bezeichnet die Perspektive, aus der erzählt wird. In Conrads Werk ist dies entscheidend dafür, wie Afrika und seine Bewohner wahrgenommen und bewertet werden.
Wie wird Alterität im Roman dargestellt?
Alterität wird durch die Darstellung der schwarzen Ureinwohner als Stereotype und Klischees konstruiert, was die kolonialen Machtverhältnisse der Zeit widerspiegelt.
Welche Rolle spielt die Figur Mister Kurtz?
Kurtz verkörpert die Korruption und den moralischen Verfall des Imperialismus. Seine Figur ist zentral für die Auseinandersetzung mit der „Dunkelheit“ im Menschen.
Was versteht man unter Hybridität in diesem Kontext?
Hybridität beschreibt die Vermischung von Kulturen und Perspektiven im kolonialen Raum, der als Ort der Begegnung und des Konflikts fungiert.
- Quote paper
- Martina Drautzburg (Author), 2005, Eine Narratologische Analyse von Joseph Conrads "Heart of Darkness", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132759