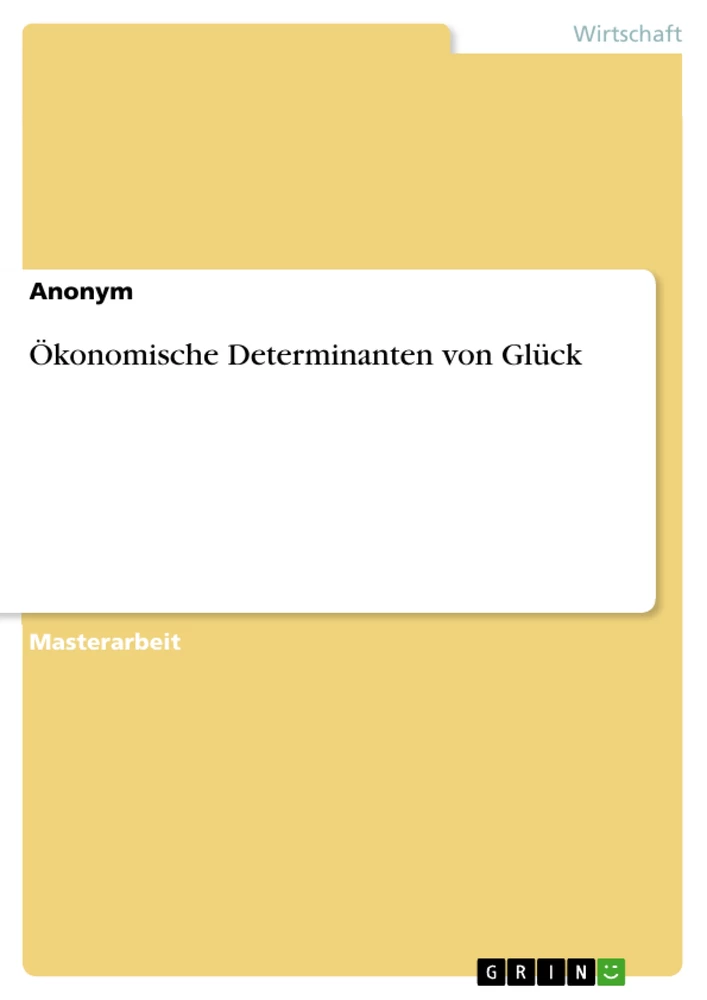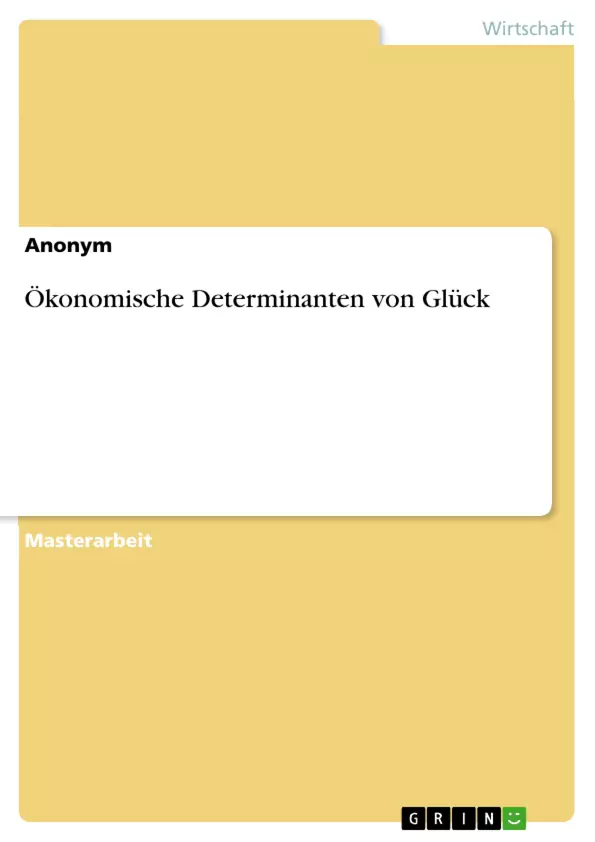Ziel der Masterarbeit ist es, darzulegen, welche ökonomischen Determinanten das Glück maßgeblich beeinflussen und wie stark diese Zusammenhänge sind. Hinsichtlich der heterogenen Forschungsergebnisse und der feinen graduellen Unterschiede wird ein detaillierter Literaturüberblick dargelegt. Darüber hinaus werden neben den ökonomischen Determinanten auf die nicht-ökonomischen Glücksfaktoren und deren Bedeutung untersucht. Dazu wird der Glücksbegriff und dessen Komponenten, die in diesem Kontext wichtig sind, abgegrenzt. Zielsetzung ist ebenfalls die Wichtigkeit sozialstaatlicher Aspekte in Bezug auf das Glück zu untersuchen und ob demnach ein Zusammenhang vorliegt oder andere Erklärungsansätze existieren. Demnach ist es wichtig, der Frage nachzugehen, ob ausschließlich die großzügigen und universellen Sozialleistungen für die Zufriedenheit maßgeblich sind. Insofern ist es entscheidend zu klären, ob möglicherweise andere Einflüsse wirken und eine pauschale Annahme, dass ein sozialdemokratisches Wohlfahrtssystem per se zu mehr Zufriedenheit führt, zu oberflächlich ist. Diese Arbeit gibt hierfür einen aufschlussreichen Überblick und generiert einen Beitrag dazu, potenziellen neuen Forschungsbedarf im Bereich der partiellen Betrachtung der Determinanten zu erkennen und eine Grundlage für weitere Arbeiten zu erarbeiten. Mit der abschließenden explorativen Regressionsanalyse wird ein erster Versuch unternommen, einzelne Determinanten, die tendenziell für einen starken Sozialstaat charakteristisch sind, zu präzisieren. Zudem wird versucht den Zusammenhang zwischen dem Ausmaß eines Sozialstaates und dem Glück der Bürger zu beschreiben und mögliche Grenzen zu erkennen.
Zu Beginn der Arbeit wird zunächst eine Abgrenzung des Glücksbegriffs erfolgen, um ein konsistentes Verständnis zu gewährleisten. Darauffolgend werden die unterschiedlichen Messmethoden der Glückserhebung und nicht-ökonomische Glücksfaktoren sowie deren Bedeutung diskutiert. Anschließend wird das Hauptaugenmerk auf die ökonomischen Determinanten von Glück gelegt, um aufzuzeigen, inwiefern diese das Glücksniveau tangieren. Darauf werden die Ergebnisse der zwei aktuellen Glücksberichte der Vereinten Nationen (UN) zusammengefasst und auftretende Unterschiede sowie Schwächen diskutiert. Den zweiten Schwerpunkt bilden die Betrachtung sozialstaatlicher Modelle und deren Ausgestaltung im Hinblick auf den Zusammenhang mit einem hohen Glücksempfinden. Abschließend wird anhand einer Regression unter Verwendung von Querschnittsdaten der OECD explorativ untersucht, wie stark der Einfluss ökonomischer und nicht-ökonomischer Determinanten ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Glück
- Definition von Glück
- Subjektives Wohlbefinden
- Messmethoden für das subjektive Wohlbefinden
- Befragung zur subjektiven Lebenszufriedenheit
- Erlebnis-Stichproben-Methode
- Tagesrekonstruktion
- Gehirnaktivität
- Glücksfaktoren
- Persönlichkeitsfaktoren
- Soziodemografische Faktoren
- Spirituelle Faktoren
- Relationale Faktoren
- Institutionelle Faktoren
- Ökonomische Determinanten von Glück
- Einkommen
- Absolutes Einkommen
- Relatives Einkommen
- Inflation
- Einkommensverteilung
- Arbeitslosigkeit
- Personelle Arbeitslosigkeit
- Generelle Arbeitslosigkeit
- Ergebnisse Glücksberichte
- World Happiness Report
- Human Development Index
- Rolle des Sozial- / Wohlfahrtsstaates
- Sozialstaatliche Modelle nach der Esping-Andersen-Typologie
- Liberaler Wohlfahrtsstaat
- Konservativ-korporatistischer Wohlfahrtsstaat
- Sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat
- Rudimentärer/mediterraner Wohlfahrtsstaat
- Postsozialistischer Wohlfahrtsstaat
- Soziale Sicherungssysteme in Volkswirtschaften
- Kritische Analyse
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den ökonomischen Determinanten von Glück. Ziel ist es, die Beziehung zwischen ökonomischen Faktoren und dem subjektiven Wohlbefinden zu untersuchen und die Rolle des Sozialstaates in diesem Zusammenhang zu beleuchten.
- Definition und Messung von Glück
- Ökonomische Einflussfaktoren auf das subjektive Wohlbefinden (z.B. Einkommen, Arbeitslosigkeit, Inflation)
- Die Rolle des Sozialstaates bei der Förderung von Glück
- Kritik an den ökonomischen Glücksstudien
- Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung präsentiert die Problemstellung der Arbeit, definiert die Zielsetzung und skizziert die Vorgehensweise.
- Glück: Dieses Kapitel erläutert den Begriff des Glücks und die verschiedenen Methoden zur Messung des subjektiven Wohlbefindens.
- Glücksfaktoren: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Faktoren, die Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden haben, darunter Persönlichkeitsfaktoren, soziodemografische Faktoren, spirituelle Faktoren, relationale Faktoren und institutionelle Faktoren.
- Ökonomische Determinanten von Glück: Dieses Kapitel analysiert den Einfluss von ökonomischen Faktoren wie Einkommen, Inflation, Einkommensverteilung und Arbeitslosigkeit auf das Glücksempfinden.
- Ergebnisse Glücksberichte: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse wichtiger Glücksstudien, wie den World Happiness Report und den Human Development Index.
- Rolle des Sozial- / Wohlfahrtsstaates: Dieses Kapitel untersucht die Rolle des Sozialstaates bei der Förderung von Glück und analysiert verschiedene Wohlfahrtsstaatmodelle nach der Esping-Andersen-Typologie.
- Kritische Analyse: Dieses Kapitel kritisiert die ökonomischen Glücksstudien und beleuchtet mögliche Limitationen und methodische Herausforderungen.
Schlüsselwörter
Glück, subjektives Wohlbefinden, ökonomische Determinanten, Einkommen, Arbeitslosigkeit, Inflation, Sozialstaat, Wohlfahrtsstaat, Esping-Andersen-Typologie, Glücksberichte, World Happiness Report, Human Development Index, Kritik, Limitationen, methodische Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen ökonomischen Determinanten von Glück in dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht insbesondere den Einfluss von Einkommen (absolut und relativ), Inflation, Einkommensverteilung und Arbeitslosigkeit auf das subjektive Wohlbefinden.
Wie wird der Begriff „Glück“ in der Masterarbeit abgegrenzt?
Zu Beginn der Arbeit erfolgt eine Definition und Abgrenzung des Glücksbegriffs sowie des subjektiven Wohlbefindens, um ein konsistentes Verständnis für die ökonomische Analyse zu gewährleisten.
Welche Rolle spielt der Sozialstaat für die Lebenszufriedenheit?
Die Arbeit untersucht, ob großzügige Sozialleistungen maßgeblich für die Zufriedenheit sind oder ob ein Zusammenhang mit bestimmten Wohlfahrtsmodellen, wie dem sozialdemokratischen System, besteht.
Welche Messmethoden für das Wohlbefinden werden diskutiert?
Es werden verschiedene Methoden wie Befragungen zur Lebenszufriedenheit, die Erlebnis-Stichproben-Methode, die Tagesrekonstruktion und die Messung der Gehirnaktivität vorgestellt.
Was ist das Ziel der explorativen Regressionsanalyse am Ende der Arbeit?
Die Analyse nutzt OECD-Daten, um den Einfluss ökonomischer und nicht-ökonomischer Faktoren zu präzisieren und den Zusammenhang zwischen der Stärke eines Sozialstaates und dem Glück der Bürger zu beschreiben.
Welche Glücksberichte werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit fasst die Ergebnisse des World Happiness Report der Vereinten Nationen (UN) sowie des Human Development Index (HDI) zusammen.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2019, Ökonomische Determinanten von Glück, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1328713