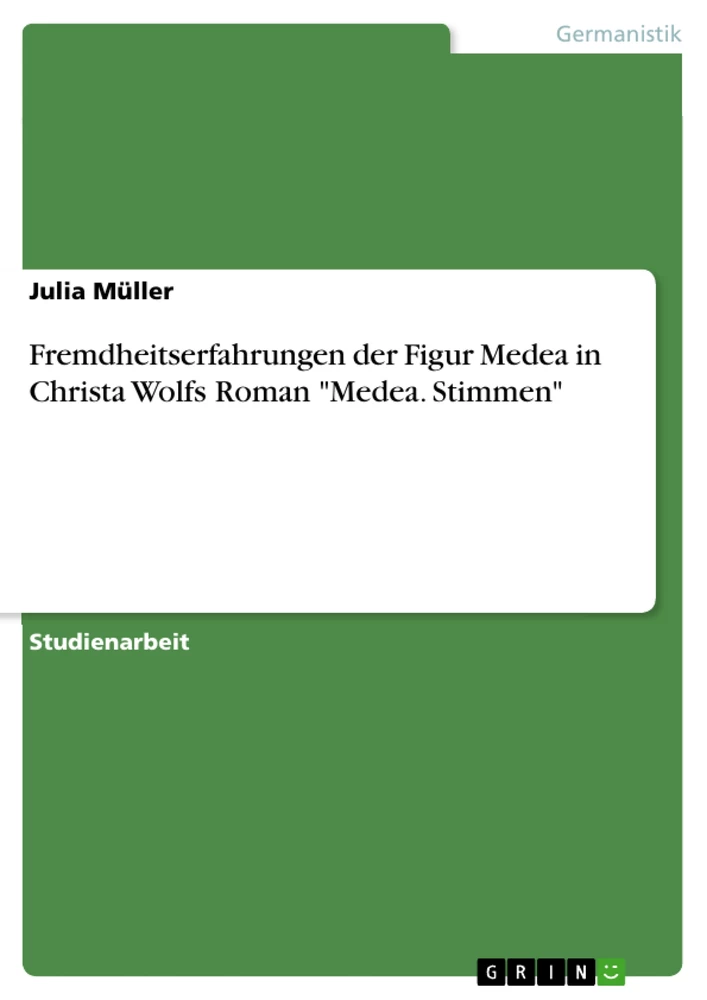Christa Wolf setzt sich in ihrem Werk "Medea.Stimmen" mit einem Urtext der abendländischen Zivilisation auseinander, und zwar mit dem Medea-Mythos. Seit Euripides "Medea" ist in den Köpfen der Menschen das Bild einer grausamen Frau verankert, die ihren Bruder, eine vermeintliche Freundin und schließlich ihre eigenen Kinder ermordet. Christa Wolf hegte berechtigte Zweifel an dieser von Männerperspektiven geprägten Version und schrieb kurzerhand ihre eigene Medea-Figur, mit der sich diese Arbeit näher beschäftigen soll. Schwerpunkt dabei werden die Fremdheitserfahrungen der wolfschen Medea darstellen.
Ziel der Arbeit ist es, die Fremdheitserfahrungen der Medea in Korinth sowohl nach außen als auch nach innen gerichtet, nachvollziehen zu können, denn diese zeichnen sie maßgeblich als Person und Figur aus. Abschließend soll die Frage beantwortet werden, inwiefern die gemachten Erfahrungen die Identität und die Positionierung in der Gesellschaft der Figur Medea beeinflusst haben. Da dies auf einer theoretischen Grundlage geschehen soll, wird zunächst der Fremdheitsbegriff behandelt und verschiedene für das Ziel dieser Arbeit relevante Perspektiven diesbezüglich beleuchtet, nämlich die soziologische, die kulturanthropologische und die psychologische. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Fremdheitserfahrungen Medeas.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 2. Begriffsklärung.
- 2.1 Soziologische Perspektive…......
- 2.2 Kulturanthropologische Perspektive .......
- 2.3 Psychologische Perspektive......
- 3. Fremdheitserfahrungen in Christa Wolfs Roman Medea. Stimmen
- 3.1 Die Kolcher als fremdes Volk in Korinth.
- 3.2 Christa Wolfs Medea als Projektionsfigur der Fremdheit.
- 3.2.1 Das Frauenbild in Korinth und Kolchis.
- 3.2.2 Medea als ambivalente Figur zwischen Faszination und Ablehnung
- 3.2.3 Medea als Individuum am Rande zweier Kulturen
- 4. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“ unter dem Aspekt der Fremdheitserfahrungen der Titelfigur. Ziel ist es, die Herausforderungen von Medeas Existenz in Korinth, sowohl in Bezug auf die Außenwelt als auch in ihrem inneren Erleben, zu verstehen. Dabei wird untersucht, wie diese Erfahrungen Medeas Identität und ihre Positionierung in der Gesellschaft beeinflussen.
- Fremdheitserfahrungen als zentrales Thema im Roman
- Die soziologische, kulturanthropologische und psychologische Perspektive auf Fremdheit
- Die Rolle der Kolcher als fremdes Volk in Korinth
- Medea als Projektionsfigur der Fremdheit, betrachtet anhand des Frauenbildes, der Ambivalenz ihrer Positionierung und ihrer Rolle am Rande zweier Kulturen
- Der Einfluss der Fremdheit auf Medeas Identität und soziale Positionierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert Christa Wolfs Roman „Medea. Stimmen“ als Auseinandersetzung mit dem Medea-Mythos und stellt die besondere Interpretation der Figur durch Wolf in den Vordergrund. Die Fremdheitserfahrungen der wolfschen Medea, die als „Grenzgängerin zwischen zwei Wertesystemen“ beschrieben wird, stehen im Zentrum der Untersuchung. Die Arbeit zielt darauf ab, Medeas Fremdheitserfahrungen in Korinth sowohl nach außen als auch nach innen zu verstehen, um ihren Einfluss auf ihre Identität und Positionierung in der Gesellschaft zu beleuchten.
Das Kapitel „Begriffsklärung“ widmet sich der Definition von Fremdheit aus verschiedenen Perspektiven. Die soziologische, kulturanthropologische und psychologische Sichtweise auf den Begriff werden vorgestellt und in ihrer Relevanz für die Analyse des Romans beleuchtet.
Das Kapitel „Fremdheitserfahrungen in Christa Wolfs Roman Medea. Stimmen“ untersucht die Fremdheitserfahrungen der Figur Medea in verschiedenen Dimensionen. Zuerst wird die Perspektive der Kolcher, Medeas Volk, als Kulturgruppe in der Begegnung mit der korinthischen Gesellschaft beleuchtet. Anschliessend wird Medeas individuelle Figur als Projektionsfigur der Fremdheit anhand von drei Dimensionen analysiert: Das Frauenbild in Korinth im Vergleich zum Frauenbild der Kolcher, die ambivalente Position Medeas zwischen Faszination und Ablehnung, sowie ihre Einordnung am Rande zweier Kulturen.
Schlüsselwörter
Fremdheit, Medea, Christa Wolf, Mythos, Soziologie, Kulturanthropologie, Psychologie, Kolcher, Korinth, Frauenbild, Identität, Positionierung, Gesellschaft, Interkulturalität, Ambivalenz, Einordnung
Häufig gestellte Fragen
Welche Perspektiven auf den Begriff Fremdheit werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit beleuchtet den Fremdheitsbegriff aus soziologischer, kulturanthropologischer und psychologischer Perspektive, um die Erfahrungen der Figur Medea theoretisch fundiert zu analysieren.
Wie interpretiert Christa Wolf die Figur der Medea neu?
Christa Wolf bricht mit dem traditionellen Bild der Medea als Kindsmörderin und grausamen Frau. Sie entwirft eine Figur, die durch männliche Perspektiven verzerrt wurde, und fokussiert sich stattdessen auf ihre Rolle als Grenzgängerin zwischen Kulturen.
Was sind die zentralen Fremdheitserfahrungen Medeas in Korinth?
Medea erlebt Fremdheit sowohl nach außen durch die Ablehnung der korinthischen Gesellschaft als auch nach innen durch die Konfrontation mit gegensätzlichen Wertesystemen und Rollenbildern.
Welche Rolle spielen die Kolcher im Roman?
Die Kolcher werden als fremdes Volk in Korinth dargestellt. Ihre Anwesenheit verdeutlicht die kulturellen Spannungen und die Schwierigkeiten der Integration in eine Gesellschaft mit anderen Normen.
Inwiefern beeinflusst das Frauenbild in Korinth Medeas Position?
Das restriktive Frauenbild in Korinth steht im Kontrast zu Medeas Herkunft und macht sie zur Projektionsfläche für Ängste und Ablehnung, was ihre soziale Ausgrenzung verstärkt.
Was ist das Ziel der Analyse von "Medea. Stimmen"?
Ziel ist es nachzuvollziehen, wie Fremdheitserfahrungen die Identität und die gesellschaftliche Positionierung Medeas maßgeblich prägen und sie als ambivalente Figur zwischen Faszination und Ablehnung kennzeichnen.
- Arbeit zitieren
- Julia Müller (Autor:in), 2021, Fremdheitserfahrungen der Figur Medea in Christa Wolfs Roman "Medea. Stimmen", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1328818