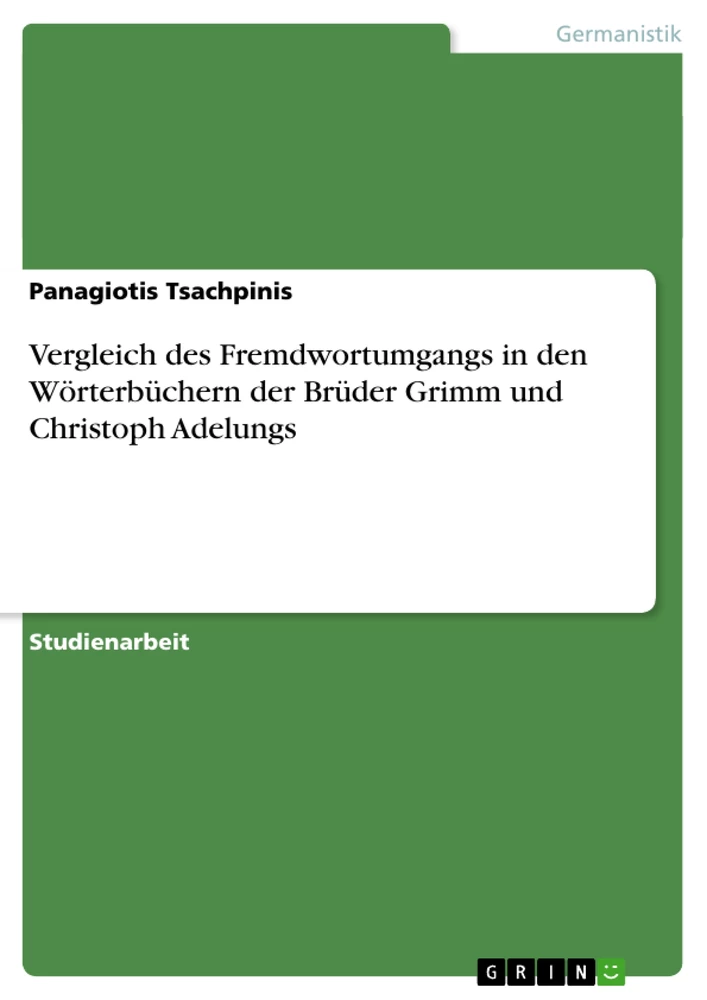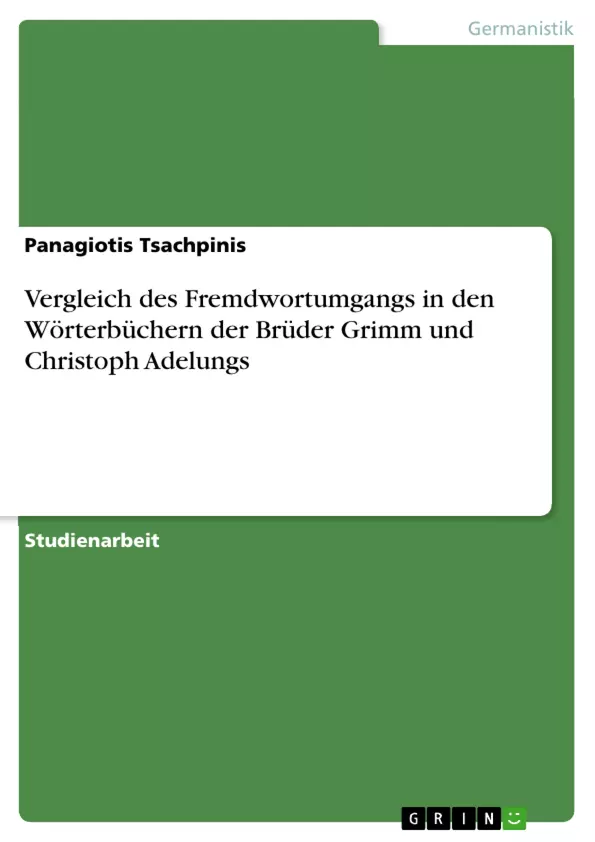Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, sowie Johann Christoph Adelung, waren Sprachforscher, die sich unter anderem darum bemüht haben, die deutsche Sprache zu vereinheitlichen. Aus diesem Grund entstanden zwei Lexika: Zum einen ein Deutsches Wörterbuch der Brüder Grimm, zum anderen ein Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart von Adelung. Ziel dieser Hausarbeit soll es sein, Vergleiche zwischen beiden Wörterbüchern zu ziehen, und eventuelle Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten aufzuführen. Dies soll allerdings nicht auf die kompletten Werke bezogen werden, sondern ausschließlich auf den Umgang mit Fremdwörtern.
Es soll ausgearbeitet werden, ob die Autoren der Wörterbüchern Fremdwörtern eher positiv, oder eher negativ gegenüber gestanden haben, und falls letzteres zutrifft, weshalb dennoch ausländische Begriffe in den Lexika enthalten sind.
Außerdem wird auf die Problematik bei der Aufnahme von Fremdwörtern eingegangen werden, und auch hier sollen – wie bei der Einstellung zu fremden Ausdrücken – Vergleiche zwischen Adelung und den Grimms gezogen werden.
Inhalt
1. Einleitung
2. Ansichten zu Fremdwörtern
3. Die Aufnahme von Fremdwörtern
3.1 Kriterien
3.2 Schwierigkeiten
4. Formaler Aufbau eines Fremdwortartikels
4.1 Aufbau bei den Grimms
4.2 Aufbau bei Adelung
5. Scheinbar deutsche Wörter
6. Schlussbetrachtung
7. Quellen- und Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm, sowie Johann Christoph Adelung, waren Sprachforscher, die sich unter anderem darum bemüht haben, die deutsche Sprache zu vereinheitlichen. Aus diesem Grund entstanden zwei Lexika: Zum einen ein Deutsches Wörterbuch der Brüder Grimm, zum anderen ein Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart von Adelung. Ziel dieser Hausarbeit soll es sein, Vergleiche zwischen beiden Wörterbüchern zu ziehen, und eventuelle Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten aufzuführen. Dies soll allerdings nicht auf die kompletten Werke bezogen werden, sondern ausschließlich auf den Umgang mit Fremdwörtern.
Es soll ausgearbeitet werden, ob die Autoren der Wörterbüchern Fremdwörtern eher positiv, oder eher negativ gegenüber gestanden haben, und falls letzteres zutrifft, weshalb dennoch ausländische Begriffe in den Lexika enthalten sind.
Außerdem wird auf die Problematik bei der Aufnahme von Fremdwörtern eingegangen werden, und auch hier sollen – wie bei der Einstellung zu fremden Ausdrücken – Vergleiche zwischen Adelung und den Grimms gezogen werden.
Als Quellen dienen neben der Sekundärliteratur die Internet-Seiten der Uni Trier, auf welcher das Wörterbuch der Grimms in digitaler Form zu finden ist, sowie die Seite der Bayerischen Staatsbibliothek, die Einblicke in Adelungs Lexikon gewährt. Aus diesem Grund beziehen sich die Angaben der Spaltenzahl bei dem grimmschen Wörterbuch auf die Angaben der Universitäts-Homepage, auf welcher bei den Einzelnen Artikeln nicht aufgeführt ist, um welche Spalte es sich genau handelt, sondern immer nur zusammenfassende Zahlen angegeben werden.
2. Ansichten zu Fremdwörtern
Sowohl Jacob und Wilhelm Grimm, als auch Johann Christoph Adelung standen der Verwendung von Fremdwörtern größtenteils negativ gegenüber.
Adelung empfand ausländische Begriffe als störend und sogar beleidigend,[1] und ihre Benutzung schrieb er Faulheit, mangelhafter Kenntnis der Muttersprache, Angeberei und schlechtem Geschmack zu:
Die Ursachen dieser Sprachmengerey sind theils Bequemlichkeit, nicht lange nach einem guten Ausdrucke herum sinnen zu dürfen; theils Unwissenheit und Unkunde des Reichthumes seiner Muttersprache; theils Eitelkeit, gelehrt zu scheinen; theils aber auch und vornehmlich Mangel des Geschmackes,[...][2]
Vor allem in der Poesie sollten seiner Meinung nach keine Fremdwörter gebraucht werden, da diese dort aufgrund ihrer verunstaltenden Art und des schwachen Klanges besonders auffallend sind und noch größere Störungen verursachen als in der alltäglichen Sprache.[3]
Wilhelm Grimm sprach sich ebenfalls betont gegen die „sprachliche Überfremdung“[4] des Deutschen aus und nannte diese sogar einen „Mißbrauch“.[5] Im Vorwort zum ersten Band des grimmschen Wörterbuches heißt es, man wolle den Einzug fremder Wörter auf keinen Fall unterstützen, sondern diesem eher noch entgegen wirken.[6] Es sei sogar die Pflicht der Sprachforschung, „dem maszlosen und unberechtigten vordrang des fremden widerstand zu leisten.“[7]
Dennoch finden sich Fremdwörtern im Lexikon der Grimms sowie dem Adelungs, denn eine völlige Ignorierung derselben scheint beiden unmöglich, wie das nächste Kapitel zeigen wird.
3. Die Aufnahme von Fremdwörtern
3.1 Kriterien
Trotz der vorherrschenden Abneigung gegenüber ausländischen Begriffen finden diese ihren Platz in beiden Lexika. Die Grimms vertreten die Auffassung, dass es nicht möglich sei, Fremdwörter komplett auszuschließen, besonders nicht diejenigen, welche bereits fester Bestandteil der deutschen Sprache geworden sind. Als Beispiel werden Bezeichnungen für Tiere und Pflanzen aus dem Ausland genannt, für die es keinen deutschen Namen gibt, sowie Wörter, die sich durch Ableitungen und Zusammensetzungen der deutschen Grammatik unterworfen haben, und gar nicht mehr als Fremdwörter erkannt werden.[8]
[...]
[1] Vgl. Adelung, Johann Christoph: Über den deutschen Styl. 3 Theile in 1 Band (Documenta Linguistica, Quellen zur Geschichte der deutschen Sprache des 15. bis 20. Jahrhunderts, Ergänzungsreihe), Hildesheim u.a. 1974, Bd. 1, S. 106.
[2] Adelung, deutscher Styl, Bd. 1, S. 110f.
[3] Vgl. Adelung, deutscher Styl, Bd. 2, S. 49.
[4] Mertens, Volker (Hrsg.): Die Grimms, die Germanistik und die Gegenwart (Philologica Germanica, 9), Wien 1988, S. 76.
[5] Mertens, S. 76
[6] Vgl. Grimm, Jacob / Grimm, Wilhelm: Deutsches Wörterbuch, Leipzig, 1854-1960, Vorwort zu Bd. 1, S. 28, 24.04.2009. < http://germazope.uni-trier.de/Projects/DWB >
[7] Grimm, Vorwort zu Bd. 1, S. 27, 24.04.09.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text?
Dieser Text ist eine vergleichende Analyse der Herangehensweise von Jacob und Wilhelm Grimm sowie Johann Christoph Adelung an Fremdwörter in ihren jeweiligen Wörterbüchern (Deutsches Wörterbuch der Brüder Grimm und Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart von Adelung). Der Text untersucht die Einstellungen der Autoren zu Fremdwörtern, die Kriterien für deren Aufnahme in die Lexika und die formalen Strukturen der Artikel.
Welche Einstellung hatten die Grimms und Adelung zu Fremdwörtern?
Sowohl die Grimms als auch Adelung standen der Verwendung von Fremdwörtern überwiegend negativ gegenüber. Adelung empfand sie als störend und schrieb ihre Verwendung Faulheit, Unkenntnis der Muttersprache, Angeberei und schlechtem Geschmack zu. Wilhelm Grimm sprach sich ebenfalls gegen die "sprachliche Überfremdung" des Deutschen aus.
Warum sind trotz der negativen Einstellung Fremdwörter in den Wörterbüchern enthalten?
Obwohl sie eine Abneigung gegen Fremdwörter hatten, erkannten sowohl die Grimms als auch Adelung an, dass es unmöglich ist, alle Fremdwörter vollständig auszuschließen, insbesondere solche, die bereits fester Bestandteil der deutschen Sprache geworden sind. Die Grimms führten als Beispiele Bezeichnungen für Tiere und Pflanzen aus dem Ausland an, für die es keine deutschen Namen gibt.
Welche Kriterien wurden für die Aufnahme von Fremdwörtern verwendet?
Die Grimms argumentierten, dass Fremdwörter, die sich durch Ableitungen und Zusammensetzungen der deutschen Grammatik unterworfen haben und nicht mehr als solche erkannt werden, aufgenommen werden können.
Welche Quellen wurden für diese Analyse verwendet?
Neben Sekundärliteratur wurden die Internetseiten der Uni Trier (für das Wörterbuch der Grimms) und der Bayerischen Staatsbibliothek (für Adelungs Lexikon) als Quellen genutzt.
Was ist das Ziel dieser Hausarbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Vergleiche zwischen den Wörterbüchern von Adelung und den Grimms in Bezug auf den Umgang mit Fremdwörtern zu ziehen und Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.
- Citar trabajo
- Panagiotis Tsachpinis (Autor), 2009, Vergleich des Fremdwortumgangs in den Wörterbüchern der Brüder Grimm und Christoph Adelungs, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132946