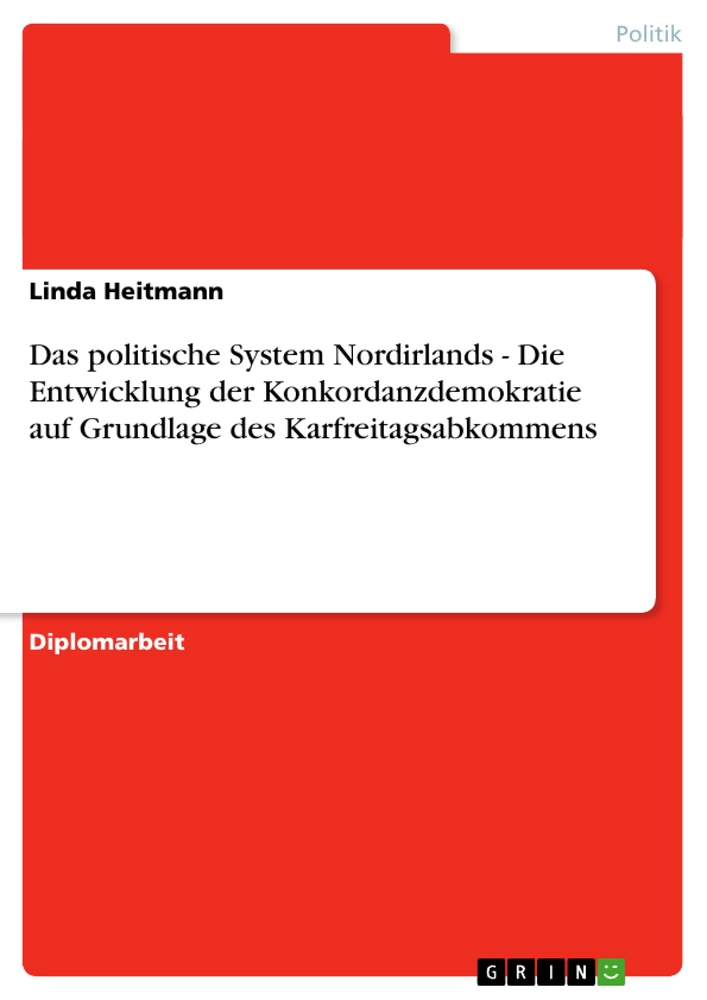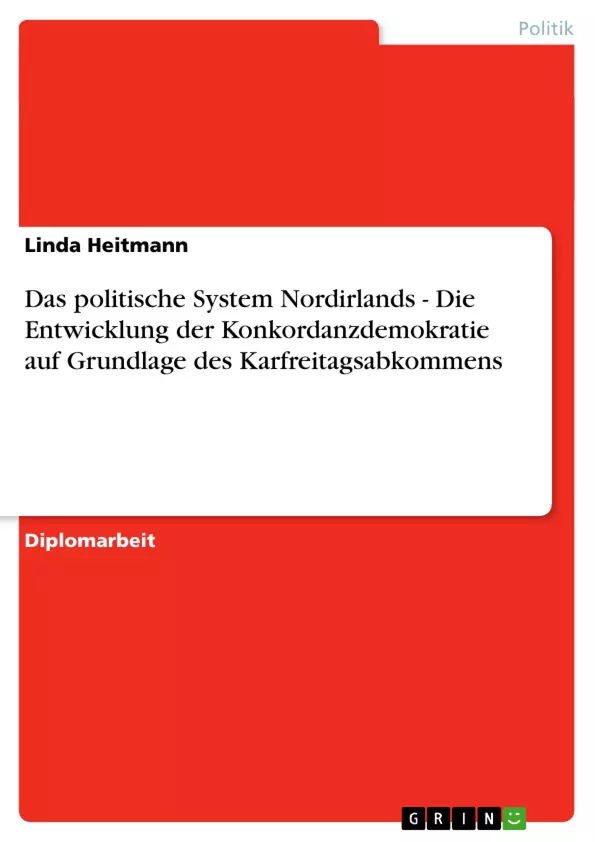Von einer „historischen Einigung nach jahrzehntelanger Feindschaft“ schrieb die Süddeutsche Zeitung am 27.03.2007, als die als radikal geltende katholische Sinn Fein sowie die protestantische DUP verkündeten, Nordirland in den nächsten Jahren gemeinsam regieren zu wollen. Tatsächlich scheint dies ein großer Schritt in dem kleinen Land zu sein, wenn man bedenkt, dass beide Seiten es jahrzehntelang abgelehnt hatten, sich auch nur miteinander fotografieren zu lassen.
Nachdem Nordirland seit Ende der 60er Jahre lange mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen zu kämpfen gehabt hatte, begannen Mitte der 90er erstmals Erfolg versprechende Friedensverhandlungen. Der Kampf um politische Mitbestimmung sowie der Wunsch nach Zugehörigkeit zu bestimmten Staatsverbänden hatten lange Zeit für blutige Fehden zwischen den beiden größten nordirischen Bevölkerungsgruppen, Protestanten und Katholiken, gesorgt. Die in der leichten Mehrheit befindlichen Protestanten beherrschten lange Zeit das politische Geschehen und begrüßten Nordirlands Zugehörigkeit zu Großbritannien. Viele Katholiken hingegen forderten neben mehr Mitbestimmung außerdem die Wiedervereinigung mit der irischen Republik.
Erst im Rahmen der Friedensverhandlungen in den 90ern schien eine Lösung in Sicht, nach der beide Gruppen die Provinz gemeinsam und weitgehend unabhängig regieren könnten. Ergebnis war das Karfreitagsabkommen von 1998, in dem zahlreiche Regelungen festgeschrieben wurden, wie beide Konfliktparteien Nordirland zukünftig gemeinsam führen sollten. Doch auf Grund verschiedener Probleme übernahm das Vereinigte Königreich in den darauf folgenden Jahren immer wieder die Direktregierung.
Ob es langfristig zu einer stabilen friedlichen Regierung kommen wird, bleibt abzuwarten. Inwiefern dies auf der Grundlage des Abkommens von 1998 überhaupt möglich ist, wird in der vorliegenden Arbeit untersucht. Zentrale These ist dabei, dass sowohl die nordirischen Wähler als auch die politischen Eliten nicht die nötige Kooperationsbereitschaft mitbringen, die für eine langfristige Stabilität nötig wäre.
Grundlage der Untersuchung ist das politikwissenschaftliche Modell der Konkordanzdemokratie, welches eine Regierungsform beschreibt, bei der verschiedene gesellschaftliche Gruppen in einer segmentierten Gesellschaft auf der Grundlage bestimmter institutioneller Regelungen gemeinsam regieren. Die im nordirischen Karfreitagsabkommen festgeschriebenen Bestimmungen sind ein klassisches Beispiel für jenes Modell.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell der Konkordanzdemokratie
- Kriterien der Konkordanzdemokratie
- Die „plural society“
- Institutionelle Ausgestaltung von Konkordanzmodellen
- Die Funktionsweise der Konkordanzdemokratie
- Kriterien der Konkordanzdemokratie
- Konkordanzdemokratie in Nordirland
- Exkurs: kurzer Überblick über die nordirische Geschichte
- Die Ausgestaltung der Konkordanzdemokratie in Nordirland seit 1998 auf Grundlage des „Good Friday Agreement“
- Die nordirische Gesellschaftsstruktur
- Das nordirische Parteiensystem
- Unionistische Parteien
- Die Ulster Unionist Party (UUP)
- ,,Manifesto 2005“ der Ulster Unionist Party
- Führende Köpfe der Ulster Unionist Party
- Die Democratic Unionist Party (DUP)
- "Manifesto 2005" der Democratic Unionist Party
- Führende Köpfe der Democratic Unionist Party
- Andere unionistische Parteien
- Die Ulster Unionist Party (UUP)
- Nationalistische Parteien
- Die Social Democratic Labour Party (SDLP)
- ,,Manifesto 2005" der Social Democratic and Labour Party
- Führende Köpfe der Social Democratic and Labour Party
- (Provisional) Sinn Fein (PSF)
- ,,Manifesto 2005" der (Provisional) Sinn Fein
- Führende Köpfe der (Provisional) Sinn Fein
- Die Social Democratic Labour Party (SDLP)
- Bi-konfessionelle Parteien
- Die Alliance Party Northern Ireland (APNI)
- "Manifesto 2005" der Alliance Party Northern Ireland
- Führende Köpfe der Alliance Party Northern Ireland
- Andere bi-konfessionelle Parteien
- Die Alliance Party Northern Ireland (APNI)
- Unionistische Parteien
- Abstimmungsverhalten im Belfast City Council
- Quantitative Analyse
- Inhaltliche Analyse
- Wahlergebnisse und Wählergruppen in Nordirland seit 1998
- Exkurs: Politische Entwicklungen in Nordirland seit 1998
- Nordirische Wahlergebnisse seit 1998
- Wahlen zur Nationalversammlung
- Wahlen zum britischen Unterhaus
- Europawahlen
- Kommunalwahlen
- Wahlen zum Belfast City Council
- Wählergruppen und Wählerwanderungen
- Wählereinstellungen zum Karfreitagsabkommen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Funktionsweise der Konkordanzdemokratie in Nordirland, insbesondere im Kontext des Karfreitagsabkommens von 1998. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen der Konkordanzdemokratie in einer segmentierten Gesellschaft wie Nordirland zu analysieren und zu bewerten, ob die politischen Eliten und Wähler die nötige Kooperationsbereitschaft für eine langfristige Stabilität aufweisen.
- Die theoretischen Grundlagen der Konkordanzdemokratie
- Die Umsetzung des Konkordanzmodells im Karfreitagsabkommen
- Die nordirische Gesellschaftsstruktur und ihre Segmentierung
- Das nordirische Parteiensystem und die Kooperationsbereitschaft der politischen Eliten
- Wahlergebnisse und Wählergruppen in Nordirland seit 1998
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Konkordanzdemokratie in Nordirland ein und stellt die zentrale These der Arbeit vor: Die politischen Eliten und Wähler in Nordirland sind nicht kooperationsbereit genug, um das Modell der Konkordanz langfristig stabil und erfolgreich werden zu lassen.
Kapitel 1 erläutert die Theorie der Konkordanzdemokratie, ihre Entstehung und Ausgestaltung. Es werden die Kriterien für das langfristige Funktionieren des Modells sowie der Begriff der „segmentierten Gesellschaft“ definiert.
Kapitel 2 befasst sich mit der Umsetzung der Konkordanzdemokratie in Nordirland, insbesondere im Kontext des Karfreitagsabkommens. Es wird ein kurzer Exkurs zur nordirischen Geschichte gegeben, bevor die Ausgestaltung des Konkordanzmodells im Abkommen und die nordirische Gesellschaftsstruktur im Hinblick auf die Segmentierung beleuchtet werden.
Kapitel 3 analysiert das nordirische Parteiensystem und untersucht die Kooperationsbereitschaft der politischen Eliten. Es werden die fünf wichtigsten Parteien vorgestellt und ihre Manifeste sowie führende Köpfe analysiert.
Kapitel 4 untersucht das Abstimmungsverhalten im Belfast City Council, sowohl quantitativ als auch inhaltlich.
Kapitel 5 analysiert die Wahlergebnisse und Wählergruppen in Nordirland seit 1998. Es werden die Ergebnisse der Wahlen zur Nationalversammlung, zum britischen Unterhaus, zum Europäischen Parlament, zu den Kommunalwahlen und zum Belfast City Council betrachtet. Außerdem werden Wählergruppen und Wählerwanderungen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Konkordanzdemokratie, das Karfreitagsabkommen, Nordirland, politische Eliten, Wählergruppen, Segmentierung, Parteiensystem, Wahlergebnisse, Abstimmungsverhalten, Kooperationsbereitschaft, Stabilität und Frieden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Konkordanzdemokratie?
Eine Konkordanzdemokratie ist ein Regierungsmodell für segmentierte Gesellschaften, bei dem alle großen Gruppen an der politischen Macht beteiligt werden, um Konflikte friedlich zu lösen.
Was regelt das Karfreitagsabkommen von 1998?
Es legte die institutionellen Grundlagen für die gemeinsame Regierung von Protestanten und Katholiken in Nordirland fest, inklusive Machtteilung und Entwaffnung.
Warum wird die nordirische Gesellschaft als "plural society" bezeichnet?
Weil sie tief entlang religiöser und politischer Linien (Unionisten vs. Nationalisten) gespalten ist, wobei beide Gruppen eigene Identitäten und Staatsvorstellungen verfolgen.
Wer sind die wichtigsten unionistischen Parteien?
Die beiden bedeutendsten Parteien sind die moderatere Ulster Unionist Party (UUP) und die radikalere Democratic Unionist Party (DUP).
Welche Rolle spielt Sinn Fein in Nordirland?
Sinn Fein ist die größte nationalistische Partei, die historisch eng mit der IRA verbunden war und heute die Wiedervereinigung mit der Republik Irland anstrebt.
Was ist das Hauptproblem für die Stabilität der Regierung?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass es sowohl den politischen Eliten als auch den Wählern oft an der nötigen Kooperationsbereitschaft fehlt, was zu häufigen Aussetzungen der Selbstverwaltung führt.
- Quote paper
- Linda Heitmann (Author), 2007, Das politische System Nordirlands - Die Entwicklung der Konkordanzdemokratie auf Grundlage des Karfreitagsabkommens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132948