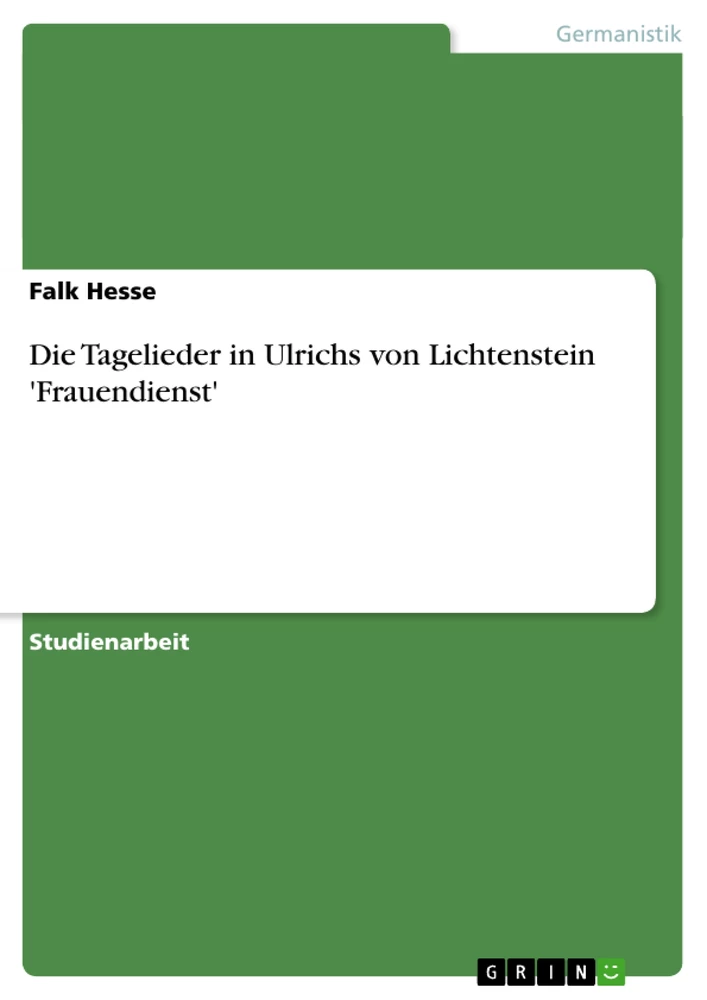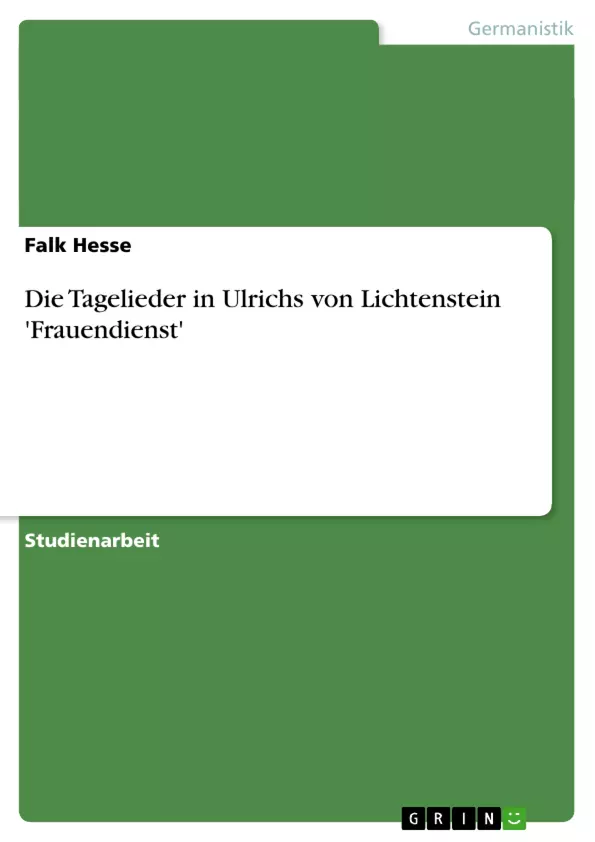Ulrich von Lichtenstein war einer der führenden Männer der Steiermark des Mittelalters. Er lebte von etwa 1200 bis 1275. Im Jahre 1255 schrieb Ulrich von Lichtenstein sein Werk 'Frauendienst'. Dieser, der sowohl autobiographische als auch epische Elemente aufweist, gilt als der erste deutsche Ich-Roman. In seinen 'Frauendienst' übernahm Ulrich von Lichtenstein mehrere seiner lyrischen Werke und fügte sie an passender Stelle ein. Unter anderem finden sich hier auch zwei Tagelieder, die er in den Jahren 1233/40 und 1240/41 verfasste. Bekannte mittelalterliche Lyriker, wie unter anderem Wolfram von Eschenbach, Walter von der Vogelweide und, nach dem Tod Ulrichs von Lichtenstein, Oswald von Wolkenstein, schrieben ebenfalls Tagelieder. Sie orientierten sich (fast) immer an einem strickten Rahmen, der die einzelnen Elemente dieser Gattung umfasste und vorgab. Ulrich von Lichtenstein wich in seinen beiden Tageliedern von wichtigen Elementen dieser Norm ab. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Betrachtung dieser beiden Tagelieder und soll zeigen, wie sie in den epischen Rahmen des 'Frauendienstes' passen. Ebenfalls sollen die Gründe Ulrichs von Lichtenstein Abweichung von der Norm betrachtet werden und wie sich diese in den beiden Tageliedern äußert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das allgemeine Tagelied und die Tagelieder des „Frauendienst“
- Das erste Tagelied
- Das zweite Tagelied
- Schlussfolgerung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die beiden Tagelieder in Ulrichs von Lichtensteins „Frauendienst“ und untersucht, wie sie in den epischen Rahmen des Werks passen. Die Arbeit beleuchtet die Gründe für Ulrichs Abweichung von der traditionellen Tageliedform und analysiert die Auswirkungen dieser Abweichungen auf die beiden Tagelieder.
- Die Einbindung der Tagelieder in den epischen Kontext des „Frauendienst“
- Die Abweichungen von der traditionellen Tageliedform
- Die Rolle der Magd als Weckerin im Vergleich zum traditionellen Wächter
- Die Bedeutung der Ständeklausel in den Tageliedern
- Der Realismus in Ulrichs von Lichtensteins Tageliedern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Ulrich von Lichtenstein und sein Werk „Frauendienst“ vor und führt in die Thematik der Tagelieder ein. Sie beleuchtet die Bedeutung der Tagelieder in der mittelalterlichen Literatur und die Besonderheiten der Tagelieder in Ulrichs Werk.
Das Kapitel „Das allgemeine Tagelied und die Tagelieder des „Frauendienst““ analysiert die traditionelle Form des Tagelieds und die Abweichungen, die Ulrich von Lichtenstein in seinen beiden Tageliedern vornimmt. Es wird insbesondere auf die Rolle des Wächters und die Ständeklausel eingegangen.
Die Kapitel „Das erste Tagelied“ und „Das zweite Tagelied“ bieten detaillierte Analysen der beiden Tagelieder in Ulrichs „Frauendienst“. Sie untersuchen die spezifischen Merkmale der beiden Gedichte und die Auswirkungen der Abweichungen von der traditionellen Form.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Tagelieder, Ulrich von Lichtenstein, „Frauendienst“, mittelalterliche Literatur, Minnesang, Ständeklausel, Realismus, Abweichungen von der Norm, Magd, Wächter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Ulrich von Lichtensteins „Frauendienst“?
Der „Frauendienst“ (1255) gilt als der erste deutsche Ich-Roman und enthält sowohl autobiographische als auch epische Elemente des Minnesangs.
Was ist ein Tagelied in der mittelalterlichen Lyrik?
Ein Tagelied beschreibt die Trennung zweier Liebender bei Tagesanbruch, meist nach einer heimlichen Nacht, und wird oft durch den Warnruf eines Wächters eingeleitet.
Wie weicht Ulrich von Lichtenstein von der Norm des Tagelieds ab?
Ulrich ersetzt den traditionellen Wächter oft durch eine Magd als „Weckerin“ und variiert die Ständeklausel, was seinen Liedern eine realistischere Note verleiht.
Welche Rolle spielen die Tagelieder im „Frauendienst“?
Ulrich fügte seine lyrischen Werke an passenden Stellen in den epischen Rahmen des Romans ein, um die Handlung zu untermalen und seine Emotionen als Minneritter auszudrücken.
Wann entstanden die beiden untersuchten Tagelieder?
Die beiden Lieder wurden vermutlich in den Zeiträumen 1233/40 und 1240/41 verfasst und später in das Werk integriert.
- Quote paper
- Falk Hesse (Author), 2009, Die Tagelieder in Ulrichs von Lichtenstein 'Frauendienst', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/132980