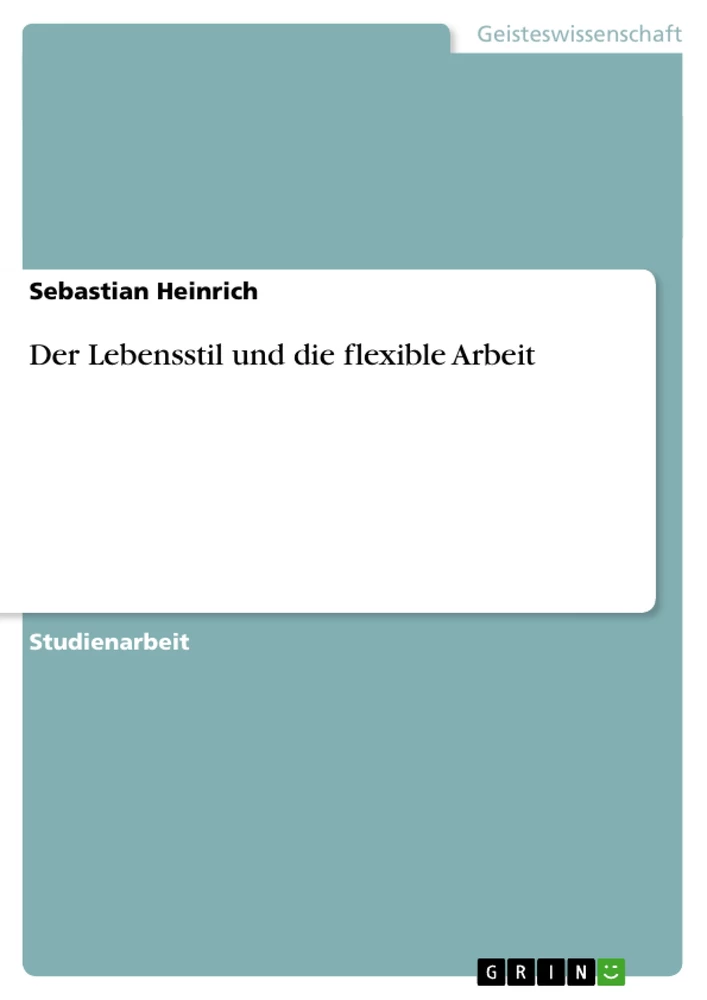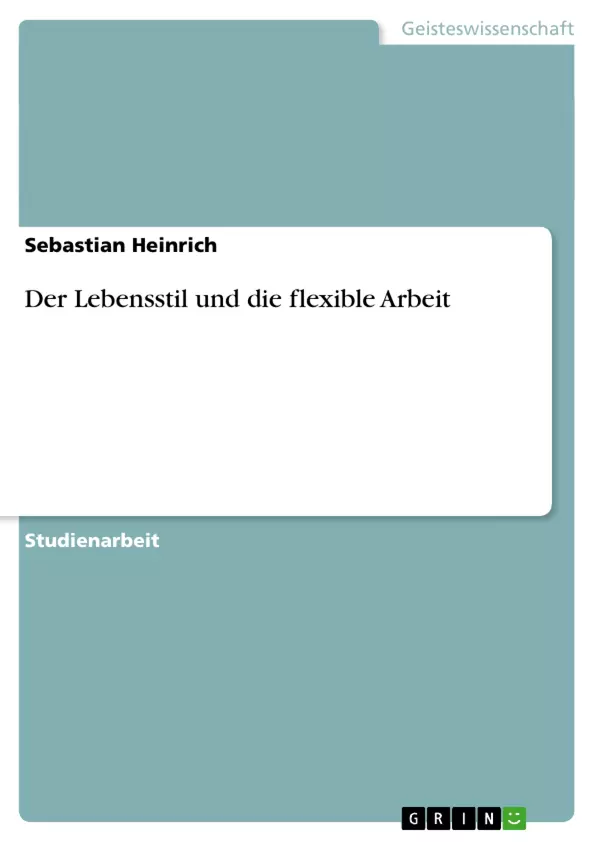Pierre Bourdieu hat der Nachwelt einen besonders umfangreichen Schatz an Instrumentarien zur empirischen Gesellschaftsanalyse hinterlassen. Zwar lassen sich seine Untersuchungen, die von der Spezifik ihrer räumlichen und zeitlichen Kontexte – wie dem Frankreich der sechziger und siebziger Jahre oder der vormodernen Lebensweise der Kabylen in Algerien - untrennbar sind, nicht ohne weiteres auf andere Gesellschaften übertragen. Seine bewusst offen gehaltenen und zur Weiterentwicklung einladenen Termini sind jedoch mit ein Grund für die anhaltende, und in den letzten Jahren wieder verstärkte Beschäftigung der Soziologie mit Bourdieus Gesellschaftstheorien. In dieser Hausarbeit möchte ich der Frage nachgehen, inwieweit Bourdieus Theorien für die postindustrielle deutsche Arbeitsgesellschaft Gültigkeit besitzen. Als Untersuchungs-gegenstand beschäftigt mich das aktuelle und weitreichende Phänomen der Entgrenzung der Arbeit, vor allem in ihrer zeitlichen Dimension, jedoch soll auch die räumliche und qualitative Ebene Beachtung finden.
Inhaltsverzeichnis
- Bourdieus Theorien: Anwenden, anpassen oder "vergessen"?
- Das Lebensstilkonzept Bourdieus
- Die Entwicklung des Lebensstils aus dem Habitus
- Amor fati
- Neuere Lebensstiltheorien
- Der Lebensstil als Option
- Sinnbasteln
- Die flexibilisierte Arbeit
- Geschichte der Arbeitszeit
- Flexibilisierung der Arbeitszeit
- Lebensweltliche Folgen
- Anwendungsmöglichkeiten der Lebensstilkonzepte im Vergleich
- Eine klassenlose Gesellschaft?
- Fremdbestimmtheit in flexibler Arbeit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Anwendbarkeit von Pierre Bourdieus Lebensstiltheorie auf die postindustrielle deutsche Arbeitsgesellschaft, insbesondere im Kontext der flexibilisierten Arbeit. Sie analysiert, ob Bourdieus strukturalistisches Konzept des Lebensstils zur Beschreibung des modernen Arbeitnehmers geeignet ist oder ob neuere Lebensstiltheorien, die von einer größeren Wahlfreiheit ausgehen, besser geeignet sind.
- Die Entwicklung des Lebensstils aus dem Habituskonzept Bourdieus
- Die Rolle von "Amor fati" bei der Stilisierung von Lebensführung
- Der Vergleich von Bourdieus Lebensstiltheorie mit neueren Ansätzen wie dem Sinnbasteln
- Die Auswirkungen flexibilisierter Arbeitsverhältnisse auf Lebensstile
- Die Frage nach einer klassenlosen Gesellschaft im Kontext flexibler Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Relevanz von Bourdieus Theorien für die heutige Gesellschaft und stellt die Frage nach ihrer Anwendbarkeit auf die deutsche Arbeitsgesellschaft. Es wird die Entgrenzung der Arbeit, insbesondere in ihrer zeitlichen Dimension, als Untersuchungsgegenstand eingeführt.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Lebensstilkonzept Bourdieus, das aus dem Habituskonzept abgeleitet wird. Es werden die strukturalistischen Merkmale des Lebensstils und die Rolle von "Amor fati" bei der Stilisierung von Lebensführung erläutert.
Das dritte Kapitel stellt neuere Lebensstiltheorien vor, die von einer größeren Wahlfreiheit des Individuums ausgehen. Am Beispiel des Sinnbastlers von Ronald Hitzler werden die Unterschiede zu Bourdieus Ansatz aufgezeigt.
Das vierte Kapitel behandelt die flexibilisierte Arbeit und ihre Geschichte. Es werden die Auswirkungen der Flexibilisierung der Arbeitszeit auf die Lebenswelt des Arbeitnehmers untersucht.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der Anwendung der Lebensstilkonzepte im Vergleich. Es werden die Frage nach einer klassenlosen Gesellschaft und die Fremdbestimmtheit in flexibler Arbeit diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Pierre Bourdieu, Lebensstil, Habitus, Amor fati, flexible Arbeit, Arbeitszeitflexibilisierung, Sinnbasteln, Klassenstruktur, soziale Ungleichheit, postindustrielle Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Habitus und Lebensstil bei Pierre Bourdieu zusammen?
Der Lebensstil ist das sichtbare Ergebnis des Habitus, also der verinnerlichten Dispositionen, die durch die soziale Herkunft und Stellung geprägt sind.
Was bedeutet der Begriff "Amor fati" in Bourdieus Theorie?
Es beschreibt die "Liebe zum Schicksal", bei der Individuen ihre durch soziale Notwendigkeit bedingte Lebensführung als eigene, gewollte Stilisierung wahrnehmen.
Sind Bourdieus Theorien auf die heutige flexible Arbeitswelt anwendbar?
Die Arbeit untersucht, ob Bourdieus strukturalistisches Konzept noch für die postindustrielle deutsche Gesellschaft gilt oder ob moderne Ansätze wie das "Sinnbasteln" besser passen.
Was versteht man unter der "Entgrenzung der Arbeit"?
Dies bezeichnet die Auflösung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, insbesondere in zeitlicher, räumlicher und qualitativer Hinsicht.
Was ist ein "Sinnbastler"?
Ein Konzept von Ronald Hitzler, das im Gegensatz zu Bourdieu von einer größeren Wahlfreiheit des Individuums bei der Konstruktion seines Lebensstils ausgeht.
- Quote paper
- Sebastian Heinrich (Author), 2006, Der Lebensstil und die flexible Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133018