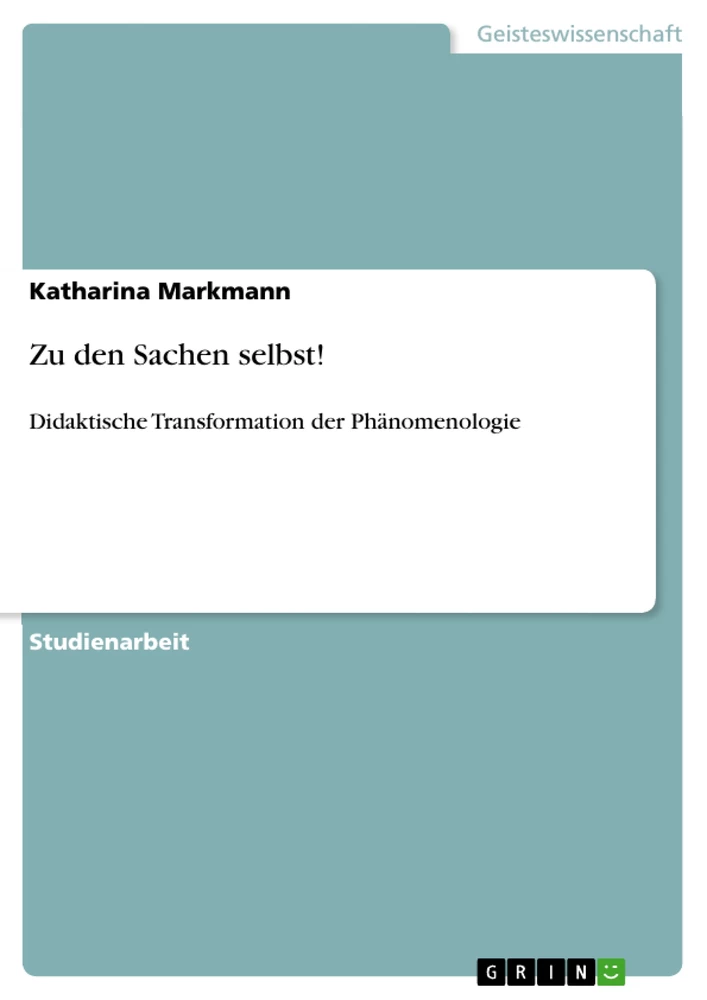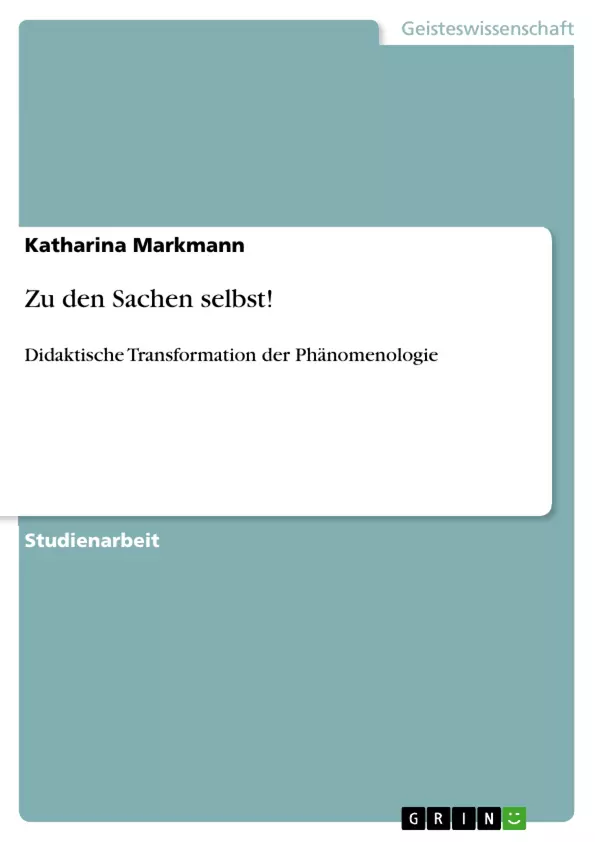Da Ethik und Philosophie im Fächerkanon als Pflichtfächer relativ jung sind, ist die Beschäftigung mit der Entwicklung einer Fachdidaktik an den Hochschulen noch sehr aktuell. Bei der Entwicklung einer Fachdidaktik können die der Philosophie eigenen Methoden einen wertvollen Beitrag leisten. Wenn man dabei nicht von den oft komplizierten Theorien der einzelnen philosophieschen Methoden ausgeht, sondern von den ihnen zu Grunde liegenden Fragestellungen aus den Alltagszusammenhängen (Verstehen und Fragen als Grundlage der Hermeneutik, das Beschreiben als Wurzel der Phänomenologie, Rede und Widerrede in der Dialektik usw.), so erweist sich deren Anwendung im Unterricht als sehr gewinnbringend, ohne dem Vorwurf des „philosophischen Dilettantismus“ ausgesetzt zu sein. Eine solche Didaktik erfüllt dann nicht nur den Zweck, dem Unterricht eine Struktur zu geben, sondern vermitteln dazu noch fachspezifische Inhalte. Exemplarisch werde ich im Folgenden die Möglichkeiten darstellen, die die Phänomenologie in ihrer didaktischen Transformation beinhaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anforderungen des sächsischen Lehrplanes
- Die Phänomenologie als philosophische Methode
- Die didaktische Transformation der Phänomenologie
- Allgemeine pädagogische Aspekte
- Fachdidaktisches Potential
- Ziele phänomenologisch orientierten Unterrichts
- Einige praktische Beispiele
- Unterrichtsentwurf
- Schlussbetrachtung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der didaktischen Transformation der Phänomenologie im Ethikunterricht. Ziel ist es, die Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die Phänomenologie als philosophische Methode im Unterricht eingesetzt werden kann, um den Anforderungen des sächsischen Lehrplans gerecht zu werden. Die Arbeit analysiert das didaktische Potential der Phänomenologie, stellt Ziele phänomenologisch orientierten Unterrichts dar und bietet praktische Beispiele für die Anwendung im Unterricht.
- Didaktische Transformation der Phänomenologie
- Anforderungen des sächsischen Lehrplans
- Ziele phänomenologisch orientierten Unterrichts
- Praktische Beispiele für die Anwendung im Unterricht
- Unterrichtsentwurf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Fachdidaktik für Ethik und Philosophie dar und führt in die Thematik der didaktischen Transformation philosophischer Denkrichtungen ein. Die Phänomenologie wird als eine Methode vorgestellt, die sich besonders gut für den Unterricht eignet, da sie von alltäglichen Fragestellungen ausgeht und somit den Schülern zugänglich ist.
Im zweiten Kapitel werden die Anforderungen des sächsischen Lehrplans für das Fach Ethik zusammengefasst. Es werden die Ziele des Faches, wie die Sensibilisierung für den Wertepluralismus, die Förderung der ethischen Reflexion und die Entwicklung von interkultureller Kompetenz, sowie die didaktischen Forderungen des Lehrplans, wie der diskursive Charakter des Unterrichts und die Handlungsorientierung, dargestellt.
Das dritte Kapitel widmet sich der Phänomenologie als philosophische Methode. Es werden die Grundzüge der Phänomenologie erläutert und ihre Bedeutung für die philosophische Erkenntnisgewinnung hervorgehoben.
Im vierten Kapitel wird die didaktische Transformation der Phänomenologie im Detail betrachtet. Es werden das didaktische Potential der Phänomenologie, die Ziele phänomenologisch orientierten Unterrichts und einige praktische Beispiele für die Anwendung im Unterricht vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die didaktische Transformation der Phänomenologie, den Ethikunterricht, den sächsischen Lehrplan, die Ziele des Ethikunterrichts, die Förderung der ethischen Reflexion, die Entwicklung von interkultureller Kompetenz, die Handlungsorientierung im Unterricht, die Phänomenologie als philosophische Methode, das didaktische Potential der Phänomenologie, die Ziele phänomenologisch orientierten Unterrichts und praktische Beispiele für die Anwendung im Unterricht.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „didaktische Transformation“ in der Philosophie?
Es bezeichnet die Anpassung komplexer philosophischer Methoden und Theorien für den Schulunterricht, sodass sie für Schüler verständlich und anwendbar werden.
Warum eignet sich die Phänomenologie besonders für den Ethikunterricht?
Die Phänomenologie geht vom Beschreiben alltäglicher Erfahrungen aus. Sie hilft Schülern, Dinge unvoreingenommen wahrzunehmen („Zu den Sachen selbst!“).
Welche Ziele verfolgt phänomenologisch orientierter Unterricht?
Ziele sind die Förderung der ethischen Reflexion, die Sensibilisierung für Wertepluralismus und die Entwicklung interkultureller Kompetenz.
Was fordert der sächsische Lehrplan für das Fach Ethik?
Er fordert einen diskursiven Charakter des Unterrichts, Handlungsorientierung und die Befähigung der Schüler zur moralischen Urteilsbildung.
Wie kann Phänomenologie praktisch im Unterricht angewendet werden?
Durch Übungen zum bewussten Beschreiben von Phänomenen ohne Vorurteile, was als Wurzel für tiefergehende ethische Diskussionen dient.
- Citar trabajo
- Katharina Markmann (Autor), 2009, Zu den Sachen selbst!, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133026