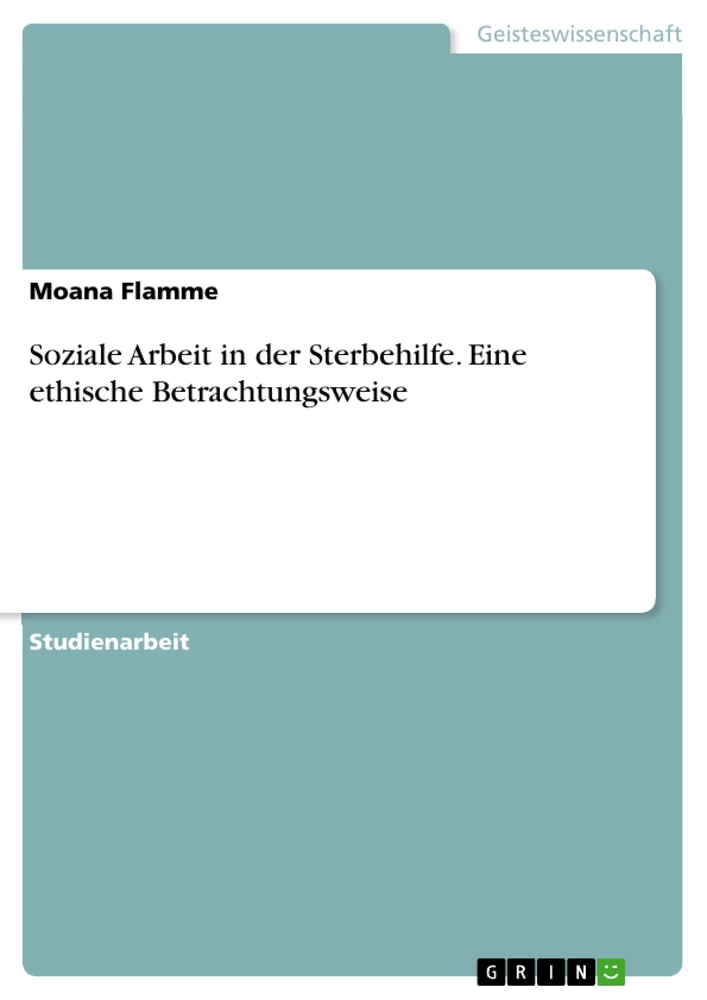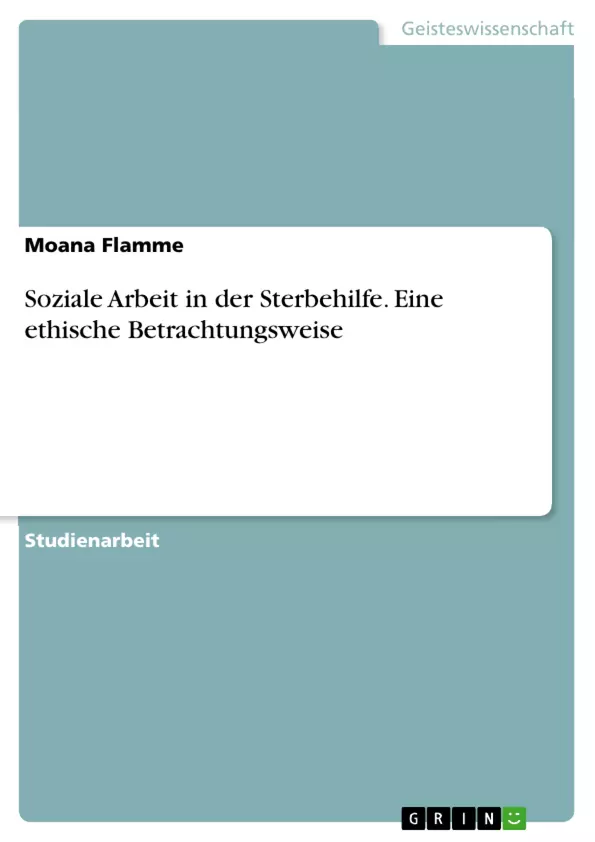Diese Arbeit befasst sich mit der Sterbehilfe im Kontext der Sozialen Arbeit. Was ist in der Sterbehilfe erlaubt? Was ist human? Ethisch vertretbar? Und wer entscheidet darüber was „richtig“ oder „falsch“ sein soll?
Im ersten Kapitel wird ein kurzer Einblick in die unterschiedlichen Arten der Sterbehilfe gegeben. Dies dient als Orientierungsansatz für den folgenden Diskurs der ethischen und rechtlichen Grundlagen. Was man in der viel diskutierten Thematik der Sterbehilfe ebenfalls nicht außer Acht lassen darf, sind die aktuellen Rechtslagen in Deutschland und den umliegenden europäischen Ländern, auf welche unter 3.ff eingegangen wird.
Inwiefern sich die Soziale Arbeit im Bereich der Sterbehilfe engagieren und etablieren kann, sowie bereits hat, wird in Kapitel 4.ff erörtert. Hierbei muss zunächst ein Blick auf die Profession des Berufsbildes der Sozialen Arbeit geworfen werden. In 4.1 wird die Soziale Arbeit in Hospizen und Palliativ Care betrachtet. Danach folgen die Handlungsmöglichkeiten im Bereich der Sterbehilfe/-begleitung, sowie der Trauerbegleitung von Angehörigen und Hinterbliebenen.
Nachdem die Grundlagen der Sterbehilfe in den ersten Kapiteln betrachtet wurden, folgen in Kapitel 5.ff ethische Betrachtungsweisen der Sozialen Arbeit in der Sterbehilfe als kompakter Einblick in den ethischen Diskurs. Hierbei wird versucht, die grundlegenden ethischen Blickwinkel objektiv zusammenzufassen und verständlich zu erläutern. Am Ende wird ein Blick auf Ethik im Kontext der Sozialen Arbeit im Berufsfeld der Sterbebegleitung/-hilfe geworfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsverwendung
- 2.1 Passive Sterbehilfe oder sterben lassen
- 2.2 Indirekte Sterbehilfe als eine Form von Behandlung am Lebensende
- 2.3 Aktive Sterbehilfe oder Tötung auf Verlangen
- 2.4 Assistierte Sterbehilfe oder Beihilfe zur Selbsttötung
- 3. Rechtliche Grundlagen
- 3.1 Rechtslage in Deutschland
- 3.2 Rechtslage im europäischen Ausland
- 3.2.1 Niederlande
- 3.2.2 Belgien und Luxemburg
- 3.2.3 Schweiz
- 4. Soziale Arbeit in der Sterbehilfe
- 4.1 Soziale Arbeit in Hospiz und Palliativ Care
- 4.2 Soziale Arbeit in der Sterbehilfe/-begleitung
- 4.3 Soziale Arbeit in der Trauerbegleitung und Angehörigenarbeit
- 5. Ethik in der Sozialen Arbeit
- 5.1 Alltagsethik
- 5.2 Berufsethik
- 5.3 Ethik im beruflichen Kontext der sozialen Arbeit
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Thematik der Sterbehilfe im Kontext der Sozialen Arbeit und analysiert die ethischen und rechtlichen Aspekte dieses komplexen Themas. Sie gibt einen Überblick über die verschiedenen Formen der Sterbehilfe und beleuchtet die aktuelle Rechtslage in Deutschland und Europa.
- Die verschiedenen Formen der Sterbehilfe (passive, indirekte, aktive, assistierte Sterbehilfe)
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Sterbehilfe in Deutschland und europäischen Ländern
- Die Rolle und Bedeutung der Sozialen Arbeit in der Sterbehilfe, insbesondere in Hospiz und Palliativ Care, sowie in der Sterbehilfe/-begleitung und Trauerbegleitung
- Ethische Aspekte der Sterbehilfe im Kontext der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Sterbehilfe im Kontext der Sozialen Arbeit vor und gibt einen kurzen Überblick über die behandelten Inhalte. Das zweite Kapitel widmet sich der Begriffsverwendung und erläutert die unterschiedlichen Formen der Sterbehilfe. Im dritten Kapitel wird die rechtliche Situation in Deutschland und Europa behandelt, inklusive der Rechtslage in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und der Schweiz. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle und dem Engagement der Sozialen Arbeit in der Sterbehilfe, insbesondere in Hospiz und Palliativ Care, sowie in der Sterbehilfe/-begleitung und Trauerbegleitung von Angehörigen. Das fünfte Kapitel analysiert ethische Aspekte der Sozialen Arbeit in der Sterbehilfe und untersucht die Alltagsethik, Berufsethik und die ethischen Herausforderungen im beruflichen Kontext.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Themen Sterbehilfe, Soziale Arbeit, Ethik, Recht, Palliativ Care, Hospiz, Trauerbegleitung, Angehörigenarbeit, Lebensende, Euthanasie, assistierter Suizid, Patientenwille, Selbstbestimmung, Lebensqualität, Tod.
Häufig gestellte Fragen zur Sterbehilfe in der Sozialen Arbeit
Welche Formen der Sterbehilfe werden unterschieden?
Man unterscheidet zwischen passiver Sterbehilfe (Sterbenlassen), indirekter Sterbehilfe, aktiver Sterbehilfe (Tötung auf Verlangen) und assistierter Sterbehilfe (Beihilfe zur Selbsttötung).
Wie ist die Rechtslage zur Sterbehilfe in Deutschland?
Die Rechtslage in Deutschland ist streng; während passive und indirekte Sterbehilfe unter Bedingungen erlaubt sind, ist die aktive Sterbehilfe verboten.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit in Hospizen?
Sozialarbeiter unterstützen Patienten und Angehörige psychosozial, helfen bei rechtlichen Fragen und begleiten den Prozess der Abschiednahme und Trauer.
Was ist der Unterschied zwischen Alltagsethik und Berufsethik?
Alltagsethik basiert auf persönlichen Werten, während Berufsethik die spezifischen moralischen Standards und Pflichten einer Profession (z.B. Soziale Arbeit) definiert.
In welchen europäischen Ländern ist aktive Sterbehilfe liberaler geregelt?
Länder wie die Niederlande, Belgien und Luxemburg haben Gesetze, die aktive Sterbehilfe unter strengen Voraussetzungen ermöglichen.
- Quote paper
- Moana Flamme (Author), 2020, Soziale Arbeit in der Sterbehilfe. Eine ethische Betrachtungsweise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1330320