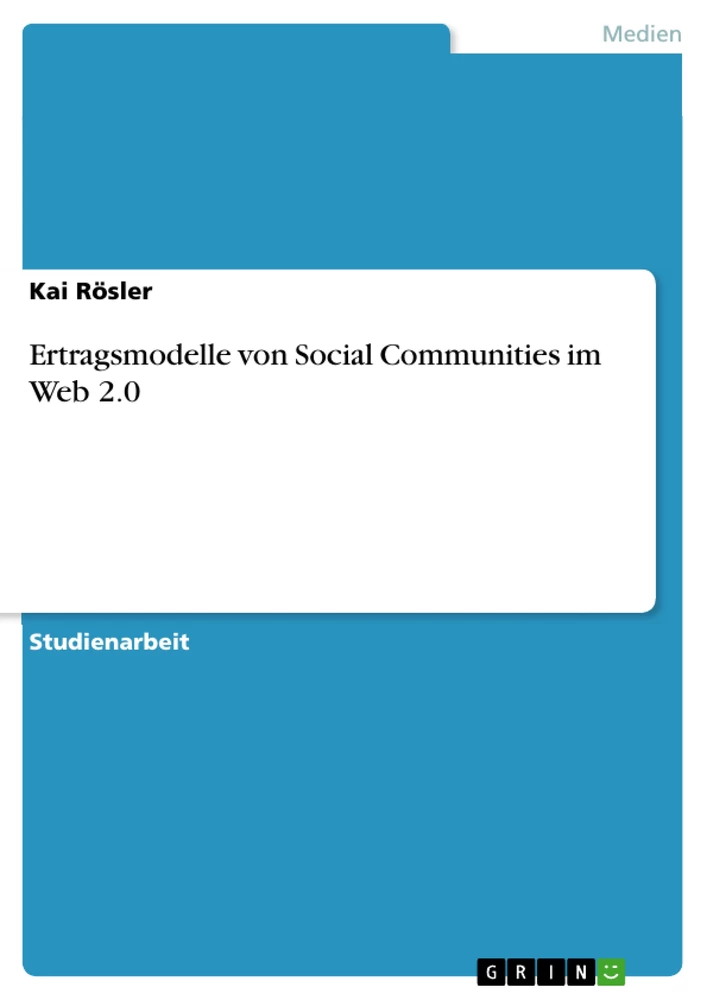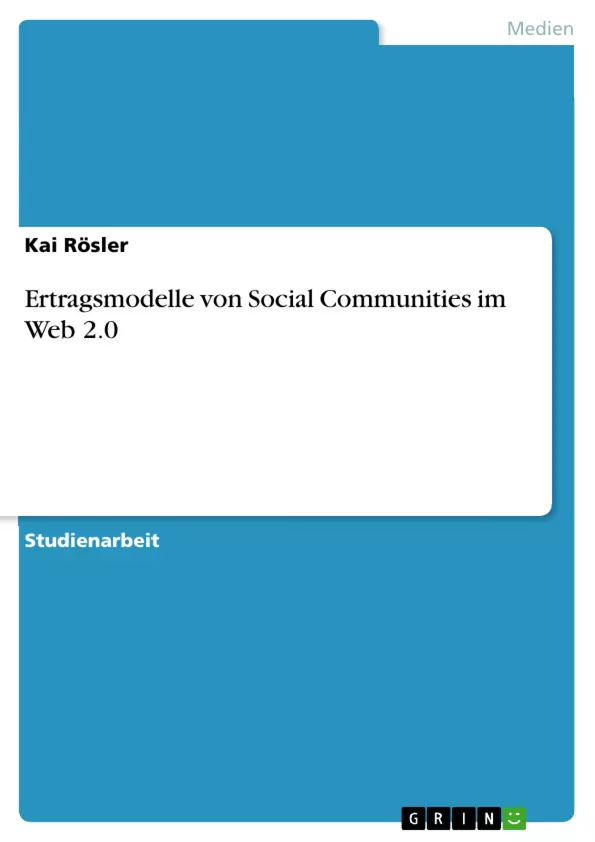Als Tim O´Reilly 2004 den Begriff 'Web2.0' geprägt hat, hat das neue "Mitmach-Internet" einen Namen bekommen. An diesem Begriff konnte sich nun eine breite Diskussion entfachen, die bis heute anhält und bereits jetzt eine große Fülle an Erkenntnissen geliefert hat.
Ein wesentlicher Aspekt der Diskussion tritt dabei besonders hervor: Die Frage nach der Finanzierung. Betrachtet man die Plattformen (social communities), die den Dreh- und Angelpunkt der partizipativen Aktivitäten der Nutzer bilden, als zentrale Elemente des Web2.0, so präzisiert sich das Erkenntnisinteresse dieser Hausarbeit: Sind die verschiedenen Arten von social communities aus sich selbst heraus finanzierbar? Wenn nicht, welche Folgen hat dies für sie selbst und damit für das Web2.0?
Das die Beantwortung dieser Frage von höchster Priorität für die gesamte Diskussion um Web2.0 ist, beruht darauf, dass eine solide Gegenfinanzierung durch funktionierende Ertragsmodelle die Grundvoraussetzung für die Nachhaltigkeit eines jeden Unternehmens, also auch solcher Plattformen, ist. Gelänge es nicht, passende Ertragsmodelle zu finden, würden sie vom Markt verschwinden und mit Ihnen, den Trägern des Web2.0, würde auch zwangsläufig der neue Boom im Internet vergehen.
Es geht also mit dieser Hausarbeit um nichts weniger als darum, einen wesentlichen Beitrag zur Klärung der so dringenden Frage zu leisten, ob das Web2.0 lediglich einen Boom darstellt, der zwangsläufig, also aus innerstrukturellen Unzulänglichkeiten, nicht von Dauer sein kann, weil es keine dauerhaften Finanzierungsmöglichkeiten geben kann.
Die Relevanz dieses Themas ergibt sich auch aus den großen Hoffnungen in das neue Web und den entsprechend großen Investitionen, die in diesem Bereich im Moment getätigt werden. Unterstellt man eine grundsätzliche Nicht-Finanzierbarkeit der social communities, wächst die Notwendigkeit, dieser Frage zeitnah nachzugehen. Denn die Folgen eines möglichen Irrwegs nehmen mit zunehmender Zeit zu (Stichwort: Blasenbildung; siehe Schlussbetrachtung). Rechtzeitige Kurskorrekturen könnten immense finanzielle Schäden verhindern und vor allem die Idee des partizipativen Internets weiterleben lassen. Insofern kann diese Arbeit auch einen Beitrag dazu leisten, überzogene Erwartungen abzudämpfen und den wesentlichen Ideen zu mehr Nachhaltigkeit zu verhelfen.
Die Hauptleistung dieser Arbeit besteht darin, ein möglichst vollständiges Bild aller Ertragsmodelle zu geben und anschließend deren Verwendbarkeit zu prüfen.
Inhaltsverzeichnis
- Theoretischer Überbau
- I Einleitung
- II Definitionen
- II.1.1 Social Communities
- II.1.2 Ertragsmodell
- II.2 Spannungslinien / Diskussionen:
- II.2.1 Nicht-Finanzierbarkeit / Finanzierbarkeit von Social Communities
- II.2.2 Finanzierung nicht notwendig / notwendig?
- II.3 Die Ertragsmodelle - Eine betriebswirtschaftliche Betrachtung
- II.3.1 Strategische Ertragsmodelle (direkt-monetäre Ertragsmodelle)
- II.3.1.1 Werbung
- II.3.1.2 Provisionen
- II.3.1.3 Transaktionserlöse
- II.3.1.4 Mitgliederbeiträge / angeschlossene Dienstleistungen innerhalb der Plattform (engl.: Subscription)
- II.3.1.5 Fundraising / Spenden
- II.3.2 Taktische Ertragsmodelle (nicht direkt-monetäre Ertragsmodelle)
- II.3.2.1 Nutzerprofile für personalisierte Werbung, Marktforschung und andere
- II.3.2.2 Verwertung des User Generated Content
- II.3.2.3 Passive Geldvorteile (negative Einnahmen bzw. Kostensenkungen)
- II.3.2.4 Community-Marketing / Kundenanbindung
- II.3.2.5 Aktiensteigerung durch ungewisse Einnahmen / Einnahmehöhe
- III Explikation
- III.1 Der Spannungsbogen, in dem sich die Ertragsmodelle befinden
- III.2 Die Gruppe der strategischen und die der taktischen Ertragsmodelle
- III.3 Für welche Art (hier: Größe) einer Social Community eignet sich welche(s) Ertragsmodell(-Gruppe)?
- IV Schlussbetrachtung
- Finanzierbarkeit von Social Communities im Web2.0
- Analyse verschiedener Ertragsmodelle
- Spannungsfelder zwischen Ertragsmodellen und Social-Community-Prinzip
- Einfluss der Größe und Art von Social Communities auf die Auswahl geeigneter Ertragsmodelle
- Nachhaltigkeit des Web2.0-Booms
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Begriff "Web2.0" und die damit verbundenen Diskussionen, insbesondere die Frage der Finanzierung von Social Communities, vor. Sie unterstreicht die Bedeutung der Ertragsmodelle für die Nachhaltigkeit des Web2.0 und stellt die Relevanz des Themas heraus.
- Definitionen: Dieses Kapitel liefert Definitionen für die Begriffe "Social Communities" und "Ertragsmodelle" und legt den Grundstein für die weitere Analyse.
- Spannungslinien / Diskussionen: Hier werden verschiedene Spannungsfelder und Debatten rund um die Finanzierung von Social Communities beleuchtet, darunter die Frage der Finanzierbarkeit und die Notwendigkeit von Finanzierung.
- Die Ertragsmodelle - Eine betriebswirtschaftliche Betrachtung: Dieses Kapitel untersucht verschiedene Ertragsmodelle aus betriebswirtschaftlicher Perspektive, unterteilt in strategische und taktische Ertragsmodelle. Es werden verschiedene Ansätze, wie z.B. Werbung, Provisionen, Transaktionserlöse, Mitgliedsbeiträge und Fundraising, detailliert beschrieben.
- Explikation: Im dritten Kapitel wird die Frage diskutiert, in welchem Spannungsfeld sich die Ertragsmodelle befinden, welche Auswirkungen die unterschiedlichen Ertragsmodellgruppen (strategisch und taktisch) haben und welche Ertragsmodelle sich für welche Art (Größe) von Social Communities eignen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Finanzierbarkeit von Social Communities im Web2.0 und zielt darauf ab, ein umfassendes Bild der verschiedenen Ertragsmodelle zu zeichnen, die für diese Plattformen zur Verfügung stehen. Sie analysiert die Spannungsfelder zwischen den Ertragsmodellen und der Grundidee der Social Community sowie die Herausforderungen, die sich aus der unterschiedlichen Größe und Art von Social Communities ergeben.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Finanzierung von Social Communities im Web2.0. Die Analyse konzentriert sich auf die Ertragsmodelle, die für diese Plattformen zur Verfügung stehen, und untersucht deren Spannungsfelder mit dem Social-Community-Prinzip. Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Möglichkeiten der Finanzierung, die je nach Art und Größe der Community infrage kommen, sowie die Herausforderungen und Chancen der Nachhaltigkeit des Web2.0-Booms.
Häufig gestellte Fragen
Sind Social Communities im Web 2.0 dauerhaft finanzierbar?
Die Arbeit untersucht diese zentrale Frage und analysiert, ob funktionierende Ertragsmodelle die Nachhaltigkeit dieser Plattformen sichern können.
Was sind direkt-monetäre (strategische) Ertragsmodelle?
Dazu zählen klassische Einnahmequellen wie Werbung, Provisionen, Transaktionserlöse, Mitgliedsbeiträge (Subscriptions) und Fundraising.
Welche taktischen (indirekten) Ertragsmodelle gibt es?
Taktische Modelle nutzen Nutzerprofile für Marktforschung, verwerten User Generated Content oder zielen auf Aktiensteigerungen durch hohe Nutzerzahlen ab.
Warum ist die Finanzierung von Social Communities ein Problem?
Es besteht oft ein Spannungsfeld zwischen der freien "Mitmach-Kultur" der Nutzer und der Notwendigkeit für Plattformbetreiber, Gewinne zu erzielen.
Welche Rolle spielt die Größe einer Community für das Ertragsmodell?
Die Arbeit expliziert, dass sich bestimmte Modelle (wie personalisierte Werbung) eher für große Plattformen eignen, während Nischen-Communities oft auf Beiträge oder Spenden angewiesen sind.
- Citation du texte
- Kai Rösler (Auteur), 2008, Ertragsmodelle von Social Communities im Web 2.0, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133086