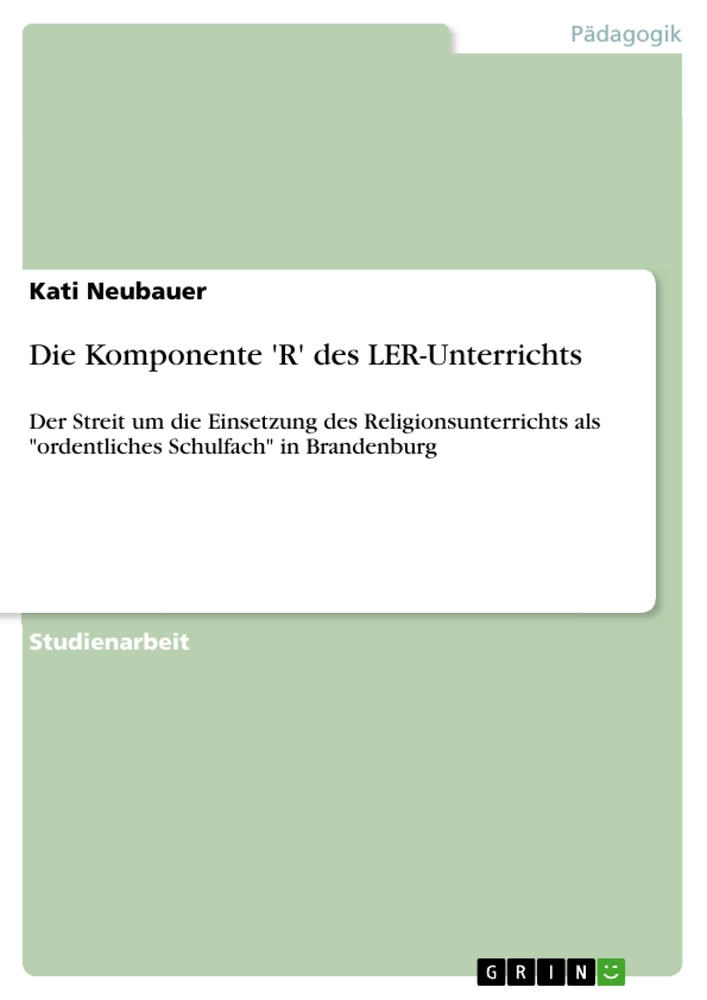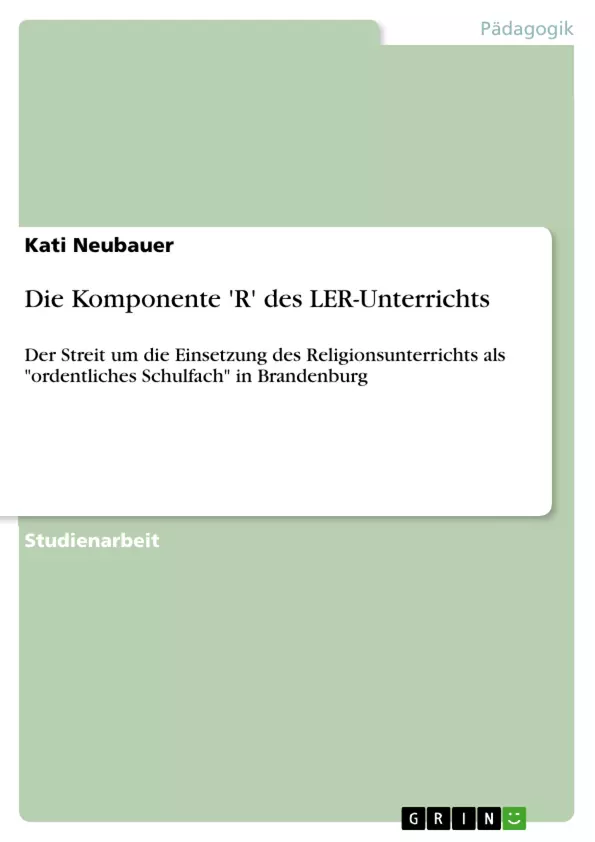Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Einführung des Schulfachs Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde in Brandenburg. Der öffentliche Streit um die Komponente „R“, der den Werdegang des Faches LER bis zu seiner endgültigen Einführung als Pflichtfach in Brandenburg begleitet und beeinflusst hat, wird anhand seiner gesellschaftlichen und rechtlichen Argumentationsketten der verschiedenen Vertreter dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtliche und soziologische Voraussetzungen für die Einführung LER
- Historische Situation in Brandenburg in Bezug auf Religiosität
- Vorgeschichte zum Fach LER
- Lebensgestaltung- Ethik- Religion in der Erprobungsphase
- Die Auseinandersetzung um die Komponente „R“
- Argumentation der Kläger für die Einführung des „ordentlichen Lehrfachs“ Religion entgegen LER
- Verletzung des Rechts der Religionsfreiheit und religiösen Selbstbestimmung
- Zweifel an der staatlich zugesicherten Neutralität
- Juristische Begründung für die Einführung LERs durch das Land Brandenburg
- Zum Vorwurf der Verletzung des Rechts der Religionsfreiheit und religiösen Selbstbestimmung
- Zu den Zweifeln an der Neutralität der staatlichen Lehrer
- Pädagogische Argumentation zur Einführung eines Pflichtfaches LER explizit mit der Teilkomponente „R“
- Argumentation der Kläger für die Einführung des „ordentlichen Lehrfachs“ Religion entgegen LER
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Konflikt um die „R“-Komponente im Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER) in Brandenburg. Ziel ist es, den Werdegang des Faches bis zu seiner Einführung als Pflichtfach nachzuvollziehen und die Notwendigkeit einer verpflichtenden Thematisierung religiöser Aspekte im staatlichen Werte- und Lebensgestaltungsunterricht zu beleuchten. Dazu werden historische und soziologische Entwicklungen in Brandenburg skizziert und die konträren rechtlichen Positionen analysiert.
- Historische Entwicklung der Religiosität in Brandenburg
- Rechtliche Auseinandersetzungen um die Einführung von LER
- Pädagogische Argumente für und gegen die „R“-Komponente
- Der Konflikt zwischen kirchlicher und staatlicher Autorität im Religionsunterricht
- Die Rolle der Säkularisierung im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einführung des Faches Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER) in Brandenburg war von einem erbitterten Rechtsstreit mit kirchlichen Vertretern geprägt, der sich um die „Religion“-Komponente drehte. Dieser Konflikt beruhte auf dem Grundrecht der Kirchen, Religionsunterricht in eigener Regie zu erteilen (§7 Abs. 3 GG) und der Sorge vor einer unzureichenden Berücksichtigung der Religionsfreiheit im LER-Konzept. Die Arbeit analysiert diesen Konflikt und die damit verbundenen rechtlichen, pädagogischen und soziologischen Aspekte.
2. Geschichtliche und soziologische Voraussetzungen für die Einführung LERS: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Religiosität in Brandenburg, beginnend mit der Reformation und der sich daraus ergebenden Trennung von Kirche und Staat. Es wird der Einfluss von Napoleon, der Nationalbewegung und des Dritten Reichs auf die Beziehung zwischen Kirche und Staat dargestellt, sowie die Veränderungen in der DDR und die Entwicklungen nach der Wiedervereinigung. Die zunehmende Säkularisierung und der Wandel der gesellschaftlichen Einstellungen zu Religion bilden den Hintergrund für die Einführung des interkonfessionellen LER-Unterrichts.
3. Lebensgestaltung- Ethik- Religion in der Erprobungsphase: (Anmerkung: Es fehlt im gegebenen Text eine Beschreibung dieser Phase. Eine Zusammenfassung ist daher nicht möglich.)
4. Die Auseinandersetzung um die Komponente „R“: Dieses Kapitel analysiert detailliert die rechtlichen und pädagogischen Argumente im Streit um die „R“-Komponente von LER. Es werden die Positionen der Kläger (die die Einführung eines regulären Religionsunterrichts forderten) und die des Landes Brandenburg (das an LER festhielt) gegenübergestellt. Die Kläger argumentierten mit der Verletzung der Religionsfreiheit und der mangelnden staatlichen Neutralität. Brandenburg verteidigte LER als pädagogisch sinnvoll und als einen Weg, religiöse Themen in einem pluralistischen Kontext zu behandeln. Die juristischen und pädagogischen Aspekte dieses Konflikts werden hier umfassend erörtert.
5. Schlussbetrachtung: (Anmerkung: Gemäß den Vorgaben wird die Schlussbetrachtung nicht zusammengefasst.)
Schlüsselwörter
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER), Brandenburg, Religionsunterricht, Religionsfreiheit, Staatliche Neutralität, Säkularisierung, Kirchenrecht, Schulgesetzgebung, Bundesverfassungsgericht, Konfessionsneutralität, Werteerziehung, Pluralismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Brandenburgischer Konflikt um die "R"-Komponente im Fach LER
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Konflikt um die "R"-Komponente (Religion) im Fach Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER) in Brandenburg. Sie analysiert den Weg des Faches bis zu seiner Einführung als Pflichtfach und beleuchtet die Notwendigkeit einer verpflichtenden Thematisierung religiöser Aspekte im staatlichen Werte- und Lebensgestaltungsunterricht.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt historische und soziologische Entwicklungen in Brandenburg, die rechtlichen Auseinandersetzungen um die Einführung von LER, pädagogische Argumente für und gegen die "R"-Komponente, den Konflikt zwischen kirchlicher und staatlicher Autorität im Religionsunterricht und die Rolle der Säkularisierung im Bildungssystem.
Welche historischen Hintergründe werden beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der Religiosität in Brandenburg, beginnend mit der Reformation und der sich daraus ergebenden Trennung von Kirche und Staat. Der Einfluss von Napoleon, der Nationalbewegung, des Dritten Reichs, der DDR und der Wiedervereinigung auf die Beziehung zwischen Kirche und Staat wird dargestellt, ebenso wie die zunehmende Säkularisierung und der Wandel der gesellschaftlichen Einstellungen zu Religion.
Wie wird der Konflikt um die "R"-Komponente dargestellt?
Das Kapitel zur Auseinandersetzung um die "R"-Komponente analysiert detailliert die rechtlichen und pädagogischen Argumente. Es werden die Positionen der Kläger (die einen regulären Religionsunterricht forderten) und des Landes Brandenburg (das an LER festhielt) gegenübergestellt. Die Argumente der Kläger betrafen die Verletzung der Religionsfreiheit und die mangelnde staatliche Neutralität. Brandenburg verteidigte LER als pädagogisch sinnvoll und als einen Weg, religiöse Themen pluralistisch zu behandeln.
Welche rechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die juristischen Begründungen sowohl der Kläger (Verletzung der Religionsfreiheit und religiösen Selbstbestimmung, Zweifel an der staatlichen Neutralität) als auch des Landes Brandenburg (Verteidigung von LER als verfassungsgemäß und pädagogisch wertvoll). Das Grundrecht der Kirchen, Religionsunterricht in eigener Regie zu erteilen (§7 Abs. 3 GG), spielt eine zentrale Rolle.
Welche pädagogischen Argumente werden diskutiert?
Die Arbeit untersucht die pädagogischen Argumente für und gegen die Integration der "R"-Komponente in LER. Es wird der Konflikt zwischen der Forderung nach einem konfessionsunabhängigen, staatlich verantworteten Unterricht und dem Recht der Kirchen auf eigenverantwortlichen Religionsunterricht beleuchtet.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LER), Brandenburg, Religionsunterricht, Religionsfreiheit, staatliche Neutralität, Säkularisierung, Kirchenrecht, Schulgesetzgebung, Bundesverfassungsgericht, Konfessionsneutralität, Werteerziehung und Pluralismus.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel, mit Ausnahme der Kapitel 3 ("LER in der Erprobungsphase") und 5 ("Schlussbetrachtung"), für die keine Informationen im gegebenen Text vorhanden waren.
- Citar trabajo
- Kati Neubauer (Autor), 2007, Die Komponente 'R' des LER-Unterrichts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133111