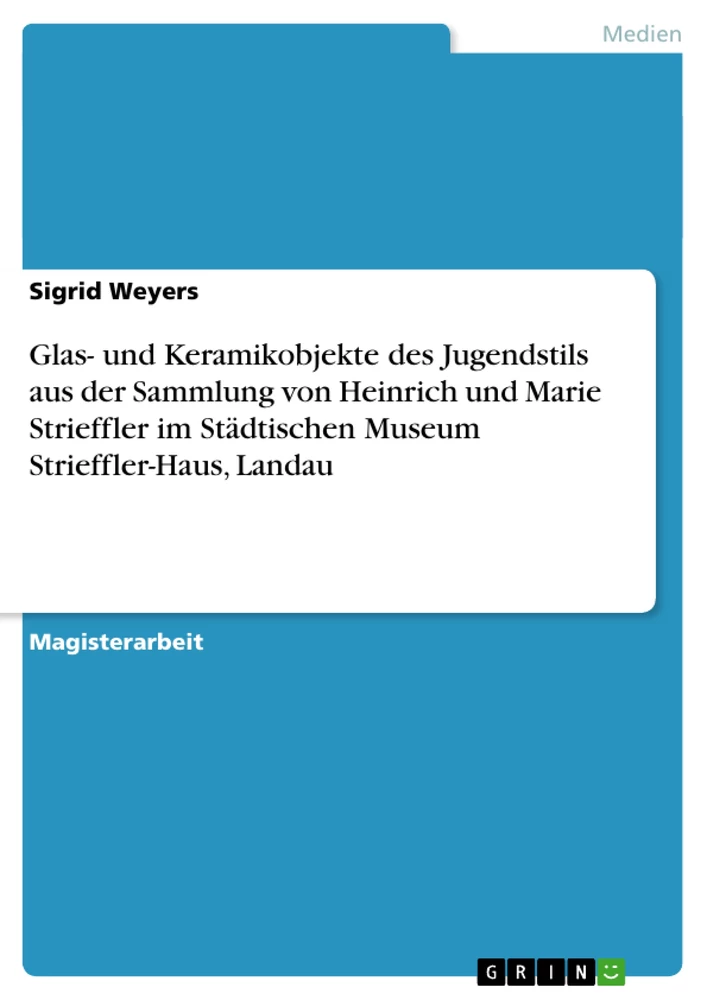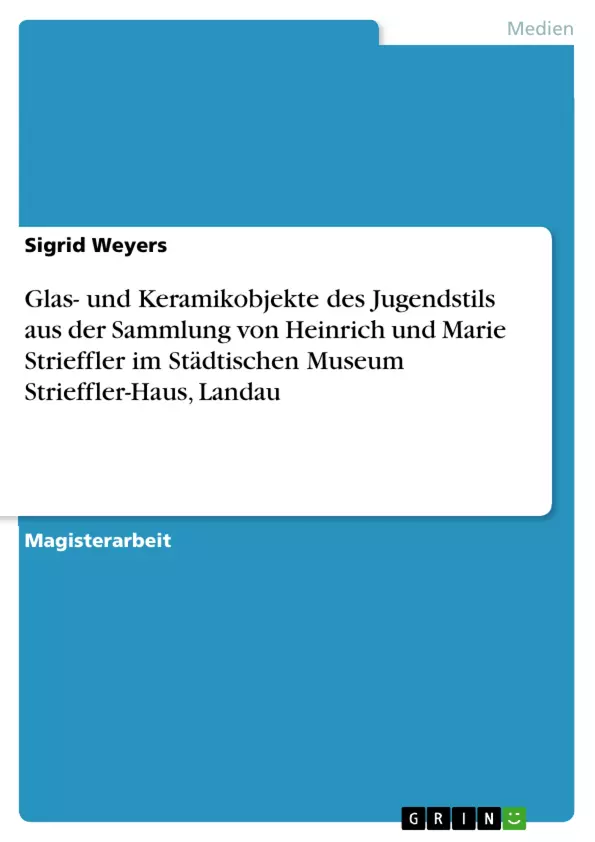Seit 1990 wird das ehemalige Wohn- und Atelierhaus des Landauer Künstlers Heinrich Strieffler als städtisches Museum geführt. Innenausstattung und Exponate spannen einen Bogen vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Zeit nach 1945. Gerade das Zusammenspiel aus originaler Architektur der 20er Jahren, einer in weiten Bereichen erhaltenen Innenausstattung und vielfältigen Lebenszeugnissen hebt dieses Haus über den Rang einer rein heimatkundlichen Sehenswürdigkeit hinaus.
Die Zeit der Jahrhundertwende und der mit ihr verbundene Jugendstil sind für die Geschichte des Hauses und die seines „spiritus rector“ von besonderer Bedeutung. Landau war zu dieser Zeit eine unbedeutende Garnisonsstadt am Rande des Königreiches Bayern wie des Deutschen Reiches. Die Verbindung zur Landeshauptstadt München, Zentrum der Sezession, und die geographische Nähe zu Städten wie Darmstadt und Karlsruhe, die der Jugendstilbewegung verbunden waren, lässt jedoch vermuten, dass Impulse des Fin de Siècle von dort in die pfälzische Provinz gelangten.
Mit dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, die Glas- und Keramikobjekte aus der kunstgewerblichen Sammlung wissenschaftlich aufzuarbeiten und zu würdigen. Dabei soll beispielhaft aufgezeigt werden, wie die künstlerischen Ideen der Zeit um 1900 die Kulturräume an der Peripherie beeinflussten und welche Bedeutung dies für die aktuelle museale Präsentation hat.
Heinrich und Marie Strieffler sind mit ihrer künstlerischen Arbeit bis heute ein wichtiger Teil der Kulturgeschichte der Stadt Landau und der Region. Ihre Stadt- und Dorfansichten und ihre Darstellungen des Alltags in einer vom Weinbau bestimmten Region prägen noch immer das Bild vieler Menschen von „ihrer Pfalz“. Ihre kunstgewerbliche Sammlung dagegen ist vielen Besuchern bis heute unbekannt, führt sie doch – in Schränken und Vitrinen dicht an dicht aufbewahrt – ein Schattendasein. Der Nachweis kulturgeschichtlicher Bedeutsamkeit ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für das Überleben kleiner, eher regional eingebundener Kultureinrichtungen. Diese Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, das im Strieffler-Haus vorhandene Potential auszuloten und Ansätze für eine zeitgemäße Präsentation des Hauses und seiner kunstgewerblichen Sammlung zu eröffnen.
Die vorliegende Arbeit umfasst sowohl die Auswertung der Datenblätter zu den einzelnen Exponaten und die Würdigung der Sammlung, als auch die Datenblätter aller untersuchten Exponate.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 Anmerkungen zur Wahl des Themas
- 1.2 Jugendstil – Anmerkungen zu einem Epochenbegriff
- 2 Jugendstil – Erneuerung von Kunst und Leben
- 2.1 Impulse der Moderne
- 2.1.1 Weltausstellungen und Reisen
- 2.1.2 Zeitungs- und Verlagswesen
- 2.1.3 Industriekritik
- 2.1.4 Entindividualisierung
- 2.1.5 Volkskunde und Nationalstaatsdenken
- 2.1.6 Orientalismus und Kolonialgeschichte
- 2.1.7 Museumskultur
- 2.1.8 Kaufhäuser und Galerien
- 3 Auf dem Weg zur neuen Gestaltung
- 3.1 Gründerjahre
- 3.2 Kunst und Wirtschaftsförderung
- 4 Die kunsthandwerkliche Sammlung im Strieffler-Haus
- 4.1 Die Begründung der Sammlung durch Heinrich Strieffler
- 4.2 Die Fortführung der Sammlung durch Marie Strieffler
- 4.3 Der aktuelle Sammlungsbestand
- 4.4 Jugendstil als Sammelobjekt
- 5 Die Keramikobjekte des Jugendstils in der Sammlung Strieffler
- 5.1 Keramik des Jugendstils. Charakteristika, Gestalter, Zentren
- 5.2 Die Gestaltung der Jugendstilkeramik. Ausgewählte Exponate aus der Sammlung Strieffler
- 5.2.1 Vom Historismus zum Jugendstil
- 5.2.2 Die neue Gestaltung: Schlickermalerei
- 5.2.3 Die neue Gestaltung: Lüsterglasuren
- 5.2.4 Die neue Gestaltung: Laufglasuren
- 5.2.5 Die neue Gestaltung: Variationen der Handhaben
- 5.2.6 Die neue Gestaltung: Spätformen der Jugendstilkeramik
- 5.2.7 Die neue Gestaltung: Kleinplastiken
- 5.2.8 Die neue Gestaltung: Die volkstümliche Keramik
- 5.3 Keramische Zentren des Jugendstils
- 5.3.1 Deutsches Reich
- 5.3.2 Frankreich
- 5.3.3 England
- 5.3.4 Österreich
- 5.3.5 Skandinavien
- 5.3.6 Außereuropäische Keramik: Japan
- 6 Die Glasobjekte des Jugendstils in der Sammlung Strieffler
- 6.1 Das Glashüttenwesen im ausgehenden 19. Jahrhundert
- 6.2 Die Glaskunst des Jugendstils
- 6.3 Die Glaskunst des Jugendstils. Ausgewählte Exponate der Sammlung Strieffler
- 6.3.1 Die neue Gestaltung: Form durch Deformation
- 6.3.2 Die neue Gestaltung: Schwingende Gefäßabschlüsse
- 6.3.3 Die neue Gestaltung: Neue Gefäßtypen
- 6.3.4 Die neue Gestaltung: Handhaben und ihr Ansatz
- 6.3.5 Die neue Gestaltung: Irisglas
- 6.3.6 Die neue Gestaltung: Fadenauflage und Kammzug
- 6.3.7 Die neue Gestaltung: Zierglasarten mit besonderen Massen
- 6.3.8 Die neue Gestaltung: Glasgefäße in Metall-Montierung
- 6.4 Glaszentren und Glasgestalter in der Sammlung Strieffler
- 6.4.1 Böhmen
- 6.4.2 Deutsches Reich
- 6.4.3 Italien: Murano/Venedig
- 6.4.4 Frankreich
- 6.4.5 Vereinigte Staaten
- 7 Heinrich und Marie Strieffler
- 7.1 Heinrich Strieffler: Künstler und Sammler
- 7.2 Marie Strieffler: Künstlerin und Stifterin
- 8 Das Strieffler-Haus: Urbanes Umfeld und Architektur
- 8.1 Landau. Kurzer Abriss zur Stadtentwicklung
- 8.2 Die Architektur des Hauses
- 9 Ephemera
- 9.1 Metallobjekte in der Sammlung Strieffler
- 9.2 Lampen
- 9.3 Constantin Meunier: Der Schiffslöscher
- 9.3.1 Der Schiffslöscher (Le Débardeur)
- 9.3.2 Constantin Meunier
- 9.3.3 Heinrich Strieffler und Meunier
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Glas- und Keramikobjekte der Jugendstilsammlung von Heinrich und Marie Strieffler im Städtischen Museum Strieffler-Haus in Landau. Ziel ist die wissenschaftliche Aufarbeitung und Würdigung dieser Sammlung, um deren kulturgeschichtliche Bedeutung aufzuzeigen und Ansätze für eine zeitgemäße museale Präsentation zu entwickeln.
- Einfluss des Jugendstils auf Kunst und Kunsthandwerk in der Provinz
- Die Entwicklung der Sammlung Strieffler und deren Besonderheiten
- Analyse der Gestaltungsprinzipien der Jugendstilkeramik und -glaskunst
- Die Bedeutung der verschiedenen keramischen und gläsernen Zentren
- Der Zusammenhang zwischen Kunst, Handwerk und Wirtschaftsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Diese Einleitung erläutert die Beweggründe für die Wahl des Themas, insbesondere die Bedeutung der Strieffler-Sammlung für die Stadt Landau und die Notwendigkeit ihrer wissenschaftlichen Aufarbeitung. Sie beleuchtet die Herausforderungen bei der Erforschung der Sammlung aufgrund mangelnder Dokumentation und betont die kulturgeschichtliche Bedeutung der Jugendstil-Objekte. Der Begriff „Jugendstil“ wird kritisch hinterfragt.
2 Jugendstil – Erneuerung von Kunst und Leben: Dieses Kapitel beschreibt den Jugendstil als eine Bewegung, die sich von den traditionellen Gestaltungsformen abwandte und die Suche nach neuen Ausdrucksformen in den Mittelpunkt stellte. Es beleuchtet diverse Einflüsse, wie Weltausstellungen, Reisen, die Entwicklung des Zeitungs- und Verlagswesens, die Industriekritik, sowie das Aufkommen von Museen und Galerien.
3 Auf dem Weg zur neuen Gestaltung: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklungen im 19. Jahrhundert, die den Jugendstil prägten, insbesondere die Reichsgründung und die daraus resultierende Förderung von Kunst und Handwerk. Die Rolle von Gewerbeschulen und Museen für den Austausch zwischen Künstlern und Manufakturen wird hervorgehoben.
4 Die kunsthandwerkliche Sammlung im Strieffler-Haus: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Sammlung von Heinrich und Marie Strieffler. Es werden die Sammlungsstrategien beider sowie der aktuelle Bestand detailliert erläutert. Der signifikante Verlust von Objekten durch Verkäufe Ende der 1980er Jahre wird aufgezeigt.
5 Die Keramikobjekte des Jugendstils in der Sammlung Strieffler: Dieses Kapitel analysiert die Keramikobjekte der Sammlung und ordnet sie in den Kontext des Jugendstils ein. Es werden verschiedene Gestaltungsmerkmale und -techniken wie Schlickermalerei, Lüsterglasuren und Laufglasuren, sowie die Herkunft der Stücke aus verschiedenen keramischen Zentren Europas untersucht.
6 Die Glasobjekte des Jugendstils in der Sammlung Strieffler: Dieses Kapitel widmet sich den Glasobjekten der Sammlung. Es beschreibt die Entwicklung des Glashüttenwesens im 19. Jahrhundert, die Einflüsse des Jugendstils auf die Glaskunst und analysiert verschiedene Gestaltungstechniken und -formen. Die Herkunft der Gläser aus unterschiedlichen europäischen Zentren wird ebenfalls beleuchtet.
7 Heinrich und Marie Strieffler: Hier werden die Biografien von Heinrich und Marie Strieffler skizziert, wobei ihr künstlerisches Wirken und ihre Rolle bei der Entstehung der Sammlung im Fokus steht. Der Einfluss von Heinrichs Ausbildung und Reisen auf seine Sammeltätigkeit wird dargestellt.
8 Das Strieffler-Haus: Urbanes Umfeld und Architektur: Dieses Kapitel beschreibt die Stadtentwicklung Land aus und die architektonischen Besonderheiten des Strieffler-Hauses, mit besonderem Augenmerk auf den Kontext der Jugendstil-Epoche.
9 Ephemera: Dieses Kapitel liefert einen kurzen Überblick über die Metallobjekte der Sammlung, die nicht im Detail analysiert wurden. Es wird kurz auf die Bedeutung von Lampen und der Skulptur von Constantin Meunier eingegangen.
Schlüsselwörter
Jugendstil, Glaskunst, Keramik, Sammlung Strieffler, Landau, Heinrich Strieffler, Marie Strieffler, Kunsthandwerk, Industriekultur, Gewerbemuseum, Kunstgewerbe, Regionale Kulturgeschichte, Formgebung, Dekoration, Glasuren, Keramikzentren, Glashütten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Jugendstilsammlung Strieffler
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Glas- und Keramikobjekte der Jugendstilsammlung von Heinrich und Marie Strieffler im Städtischen Museum Strieffler-Haus in Landau. Ziel ist die wissenschaftliche Aufarbeitung und Würdigung dieser Sammlung, um deren kulturgeschichtliche Bedeutung aufzuzeigen und Ansätze für eine zeitgemäße museale Präsentation zu entwickeln.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt den Einfluss des Jugendstils auf Kunst und Kunsthandwerk in der Provinz, die Entwicklung der Sammlung Strieffler und deren Besonderheiten, die Analyse der Gestaltungsprinzipien der Jugendstilkeramik und -glaskunst, die Bedeutung verschiedener keramischer und gläserner Zentren sowie den Zusammenhang zwischen Kunst, Handwerk und Wirtschaftsförderung. Es werden die Biografien von Heinrich und Marie Strieffler beleuchtet und das Strieffler-Haus in seinen städtebaulichen Kontext eingeordnet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es jeweils?
Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel: Kapitel 1 (Einführung) behandelt die Themenwahl und den Begriff "Jugendstil"; Kapitel 2 (Jugendstil – Erneuerung von Kunst und Leben) beleuchtet die Einflüsse auf den Jugendstil; Kapitel 3 (Auf dem Weg zur neuen Gestaltung) untersucht die Vorläufer des Jugendstils; Kapitel 4 (Die kunsthandwerkliche Sammlung im Strieffler-Haus) beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Sammlung; Kapitel 5 (Die Keramikobjekte des Jugendstils in der Sammlung Strieffler) analysiert die Keramikobjekte; Kapitel 6 (Die Glasobjekte des Jugendstils in der Sammlung Strieffler) analysiert die Glasobjekte; Kapitel 7 (Heinrich und Marie Strieffler) beschreibt die Sammler; Kapitel 8 (Das Strieffler-Haus: Urbanes Umfeld und Architektur) beschreibt den Kontext des Museums; Kapitel 9 (Ephemera) behandelt weitere Objekte der Sammlung.
Welche Gestaltungsprinzipien der Jugendstilkeramik und -glaskunst werden analysiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Gestaltungsmerkmale und -techniken der Keramik, wie Schlickermalerei, Lüsterglasuren und Laufglasuren, sowie Gestaltungstechniken des Glases wie Form durch Deformation, schwingende Gefäßabschlüsse, neue Gefäßtypen, Handhaben und deren Ansatz, Irisglas, Fadenauflage und Kammzug, Zierglasarten mit besonderen Massen und Glasgefäße in Metall-Montierung.
Welche keramischen und gläsernen Zentren werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Zentren der Keramik- und Glasproduktion, darunter das Deutsche Reich, Frankreich, England, Österreich, Skandinavien, Japan, Böhmen, Italien (Murano/Venedig) und die Vereinigten Staaten.
Welche Bedeutung hat die Sammlung Strieffler?
Die Sammlung Strieffler ist von kulturgeschichtlicher Bedeutung, da sie einen Einblick in den Jugendstil in der Provinz bietet und die Entwicklung von Kunst und Kunsthandwerk im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert widerspiegelt. Die wissenschaftliche Aufarbeitung dient der Würdigung und der Entwicklung einer zeitgemäßen musealen Präsentation.
Wer waren Heinrich und Marie Strieffler?
Heinrich Strieffler war Künstler und Sammler, Marie Strieffler Künstlerin und Stifterin. Ihre Biografien und ihr Einfluss auf die Entstehung und Entwicklung der Sammlung werden in der Arbeit detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jugendstil, Glaskunst, Keramik, Sammlung Strieffler, Landau, Heinrich Strieffler, Marie Strieffler, Kunsthandwerk, Industriekultur, Gewerbemuseum, Kunstgewerbe, Regionale Kulturgeschichte, Formgebung, Dekoration, Glasuren, Keramikzentren, Glashütten.
- Citar trabajo
- M. A. Sigrid Weyers (Autor), 2008, Glas- und Keramikobjekte des Jugendstils aus der Sammlung von Heinrich und Marie Strieffler im Städtischen Museum Strieffler-Haus, Landau , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133149