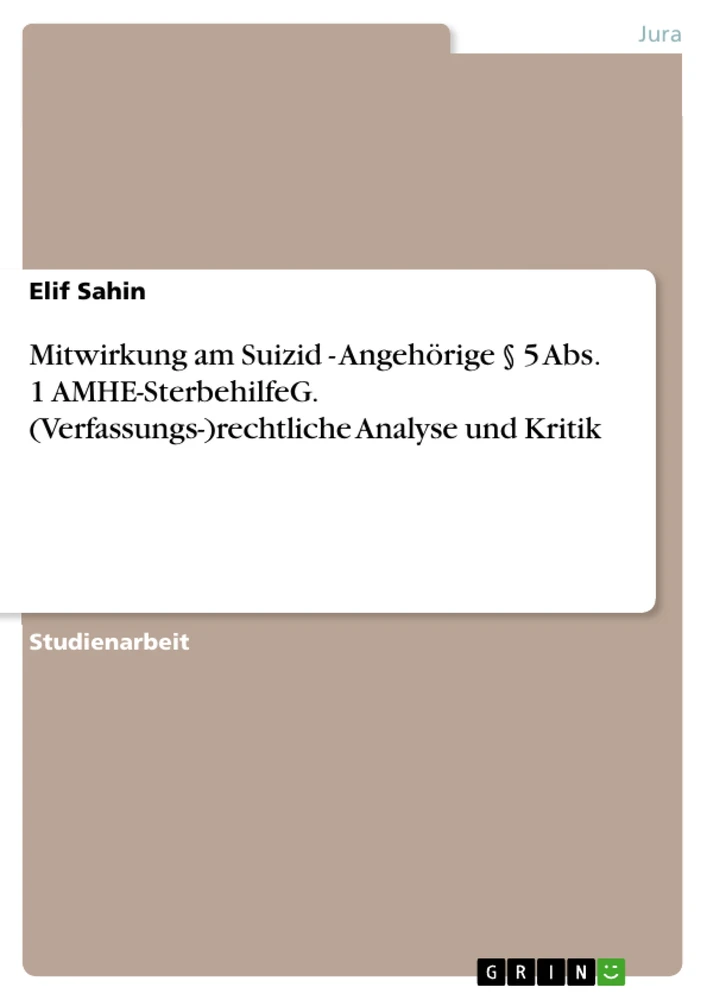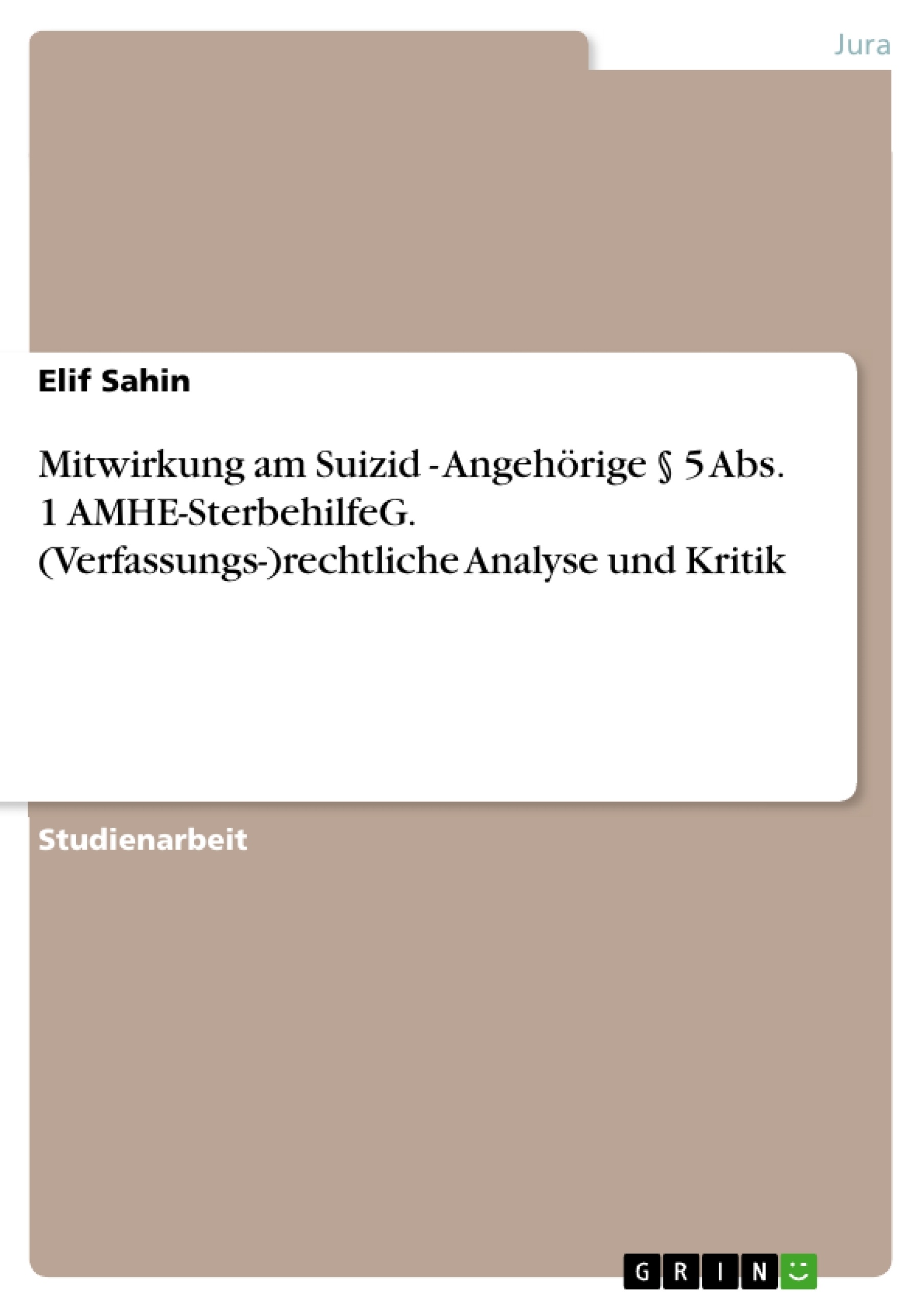Ob die Legalisierung der Suizidbeihilfe in Deutschland unseren Umgang mit Krankheit und Tod in Richtung einer von Huxley im Jahr 1932 beschriebenen Dystopie hin verändern wird oder diese Angst unbegründet ist, wird wohl erst die tatsächliche Veränderung der Rechtslage zeigen. Die unterschiedlichen Meinungen zur Thematik erstrecken sich von der Suizidbeihilfe als einzige Option eines autonomen und würdevollen Todes bis hin zur Degradierung des Sterbenden durch die Mitwirkungshandlung. Gegner der Legalisierung befürchten, der Suizid werde salonfähig und bereits die Option der Inanspruchnahme von Suizidbeihilfe würde einen nonverbal kommunizierten gesellschaftlichen Druck auf Kranke, Alte und Pflegebedürftige begründen, der sie zum Suizid dränge. So würde mit der Zeit suggeriert, dass ein würdevolles Sterben nur in der Kontrollierbarkeit des Geschehens liegen könne. Das Sterben sei als Lebensphase und nicht als einfacher Ausweg zu deuten. Man müsse vielmehr in die Zwischenmenschlichkeit der Behandlung investieren, als die Menschen durch die Trivialisierung der Beihilfe in eine innere Resignation zu schicken. Befürworter erkennen die Suizidbeihilfe als Teil des in der Menschenwürde wurzelnden Selbstbestimmungsrechts des Sterbewilligen an. Ein Mensch müsse sich nicht gegen seinen Willen den Herausforderungen seiner unheilbaren Krankheit oder seines Alters stellen. Beim Vollzug des Suizids würde es gerade auf die praktische und seelische Unterstützung ankommen. So könnten brutale Suizidformen unterbunden und der Suizident würdevoll in den Tod begleitet werden. Von besonderer Relevanz sind in diesem Kontext Angehörige, an die sich Sterbewillige naturgemäß zuerst wenden. Um die Unterstützung gewährleisten zu können, bedarf es eines liberalen Rechtsrahmens für die Suizidmitwirkung durch Angehörige. § 5 Abs. 1 des Augsburg-Münchner-Hallerschen-Entwurfes eines Sterbehilfegesetzes setzt erstmals einen positiv rechtlichen Rahmen für die Mitwirkung am Suizid.
Diese Arbeit erläutert nach der Begriffsbestimmung zu § 5 Abs. 1 AMHE zunächst die aktuelle strafgesetzlichen Rechtslage der Suizidmitwirkung durch Ang. Im Anschluss werden die Rechte des Suizidenten und des mitwirkenden Ang. dargestellt und die Verfassungsmäßigkeit von § 5 Abs. 1 AMHE überprüft. Die strafrechtliche sowie die verfassungsrechtliche Analyse insgesamt sollen dann die Frage nach einem etwaigen Pönalisierunggebot der Angehörigenbeihilfe beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Überblick
- Begriffskomplex der Sterbehilfe
- Entwurf des Sterbehilfegesetzes (AMHE-SterbehilfeG)
- Begriffsbestimmungen zu § 5 Abs. 1 AMHE
- Suizid
- Angehörige
- Mitwirkung
- C. Strafrechtliche Analyse
- Suizidbeihilfe
- Straflosigkeit des Suizids
- Akzessorietät
- Garantenpflicht zur Intervention
- Unterlassene Hilfeleistung
- Strafbarkeit nach BtMG
- Zwischenergebnis
- Pönalisierungsgebot
- Suizidbeihilfe
- D. Verfassungsrechtliche Analyse
- Grundrechte des Suizidenten
- Aus Art. 1 Abs. 1 GG
- Aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG
- Aus Art. 2 Abs. GG
- Aus Art. 8 EMRK
- Zwischenergebnis
- Grundrechte des angehörigen Suizidassistenten
- Aus Art. 4 Abs. 1 GG
- Aus Art. 6 Abs. 1 GG
- Aus Art. 2 Abs. 1 GG
- Aus Art. 8 EMRK
- Zwischenergebnis
- Verfassungsmäßigkeit von § 5 Abs. 1
- Art. 4 Abs. 1 GG
- Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG
- Schutzbereich
- Abwehrrechtliche Dimension
- Staatliche Schutzpflicht
- Das Leben des Sterbewilligen als individualistischer Schutzzweck
- Das Leben Dritter und der allgemeine Lebensschutz
- Öffentliches Interesse als überindividueller Schutzzweck
- Eingriff
- Rechtfertigung
- Verhältnismäßigkeit
- Legitimer Zweck
- Geeignetheit
- Erforderlichkeit
- Angemessenheit
- Missbrauch
- Freiverantwortlichkeit
- Altruistische Motive
- Appellsuizide
- Beistand und Hilfe
- Verhältnismäßigkeit
- Schutzbereich
- Zwischenergebnis
- Ergebnis
- E. Kein Pönalisierungsgebot
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert und kritisiert die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Regelung der Sterbehilfe in § 5 Abs. 1 AMHE-SterbehilfeG, insbesondere im Hinblick auf die Mitwirkung von Angehörigen am Suizid. Ziel ist es, die Spannungen zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und der staatlichen Schutzpflicht für das Leben des Sterbewilligen und anderer Menschen zu beleuchten.
- Die Abgrenzung von Suizid und Sterbehilfe
- Die rechtliche Regulierung der Sterbehilfe in Deutschland
- Die Rolle der Angehörigen bei der Sterbehilfe
- Die verfassungsrechtlichen Grenzen der staatlichen Schutzpflicht
- Der Konflikt zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und dem Lebensschutz
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Mitwirkung von Angehörigen am Suizid im Kontext des AMHE-SterbehilfeG ein. Im Überblick werden die wichtigsten Begriffe und der Entwurf des Sterbehilfegesetzes vorgestellt. Die strafrechtliche Analyse beleuchtet die Strafbarkeit von Suizidbeihilfe und die damit verbundenen rechtlichen Fragen. Die verfassungsrechtliche Analyse untersucht die Grundrechte des Suizidenten und des Suizidassistenten im Kontext der Sterbehilfe. Dabei werden insbesondere die Abwägung zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung und dem Lebensschutz sowie die Grenzen der staatlichen Schutzpflicht im Fokus stehen.
Schlüsselwörter
Sterbehilfe, Suizid, AMHE-SterbehilfeG, § 5 Abs. 1, Angehörige, Mitwirkung, Freiverantwortlichkeit, Selbstbestimmung, Lebensschutz, Grundrechte, Verfassungsmäßigkeit, Pönalisierungsgebot
Häufig gestellte Fragen
Was regelt § 5 Abs. 1 des AMHE-SterbehilfeG?
Dieser Entwurf setzt einen rechtlichen Rahmen für die Mitwirkung am Suizid, insbesondere durch Angehörige, um Straffreiheit unter bestimmten Bedingungen zu gewährleisten.
Ist Suizidbeihilfe in Deutschland grundsätzlich strafbar?
Der Suizid selbst ist straflos; die Beihilfe dazu ist aufgrund der Akzessorietät theoretisch straflos, wird jedoch durch andere Gesetze (z.B. BtMG) oft eingeschränkt.
Welche Rolle spielen Angehörige bei der Sterbehilfe?
Angehörige sind oft die ersten Ansprechpartner für Sterbewillige und leisten sowohl praktische als auch seelische Unterstützung beim Suizidvollzug.
Was bedeutet Freiverantwortlichkeit beim Suizid?
Es bezeichnet die Fähigkeit des Sterbewilligen, die Tragweite seiner Entscheidung voll zu erfassen und frei von äußerem Druck zu handeln.
Wie wird das Selbstbestimmungsrecht verfassungsrechtlich begründet?
Das Recht auf einen selbstbestimmten Tod wird aus der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 GG) abgeleitet.
Was ist ein Pönalisierungsgebot?
Ein Pönalisierungsgebot würde den Staat verpflichten, bestimmte Handlungen (wie die Suizidbeihilfe) unter Strafe zu stellen, um den Lebensschutz zu wahren.
- Grundrechte des Suizidenten
- Citar trabajo
- Elif Sahin (Autor), 2021, Mitwirkung am Suizid - Angehörige § 5 Abs. 1 AMHE-SterbehilfeG. (Verfassungs-)rechtliche Analyse und Kritik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1331697