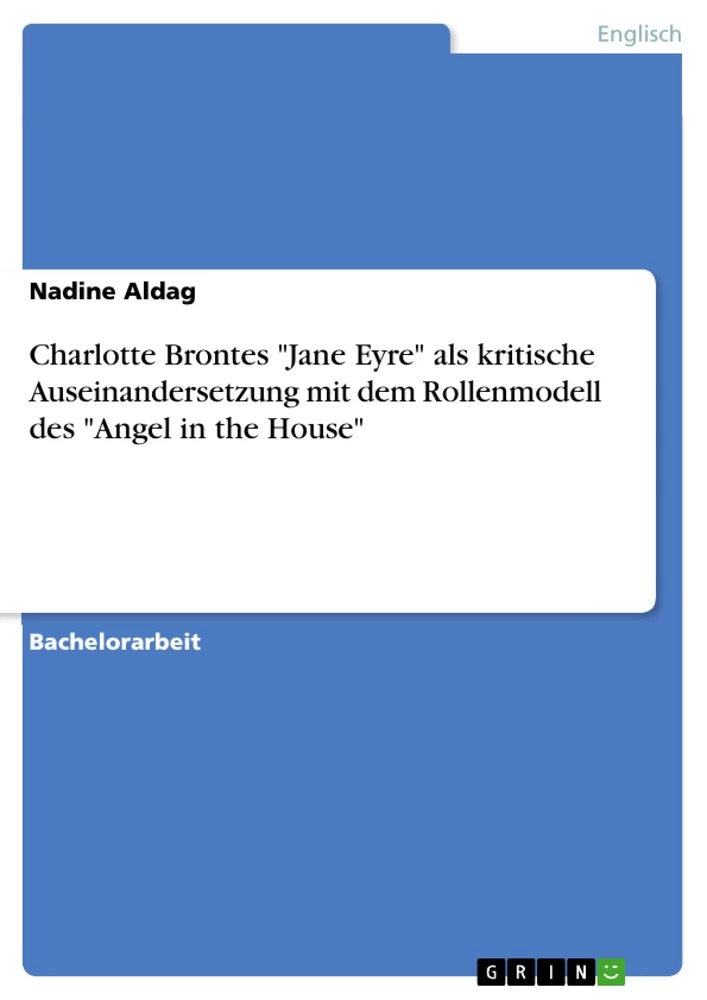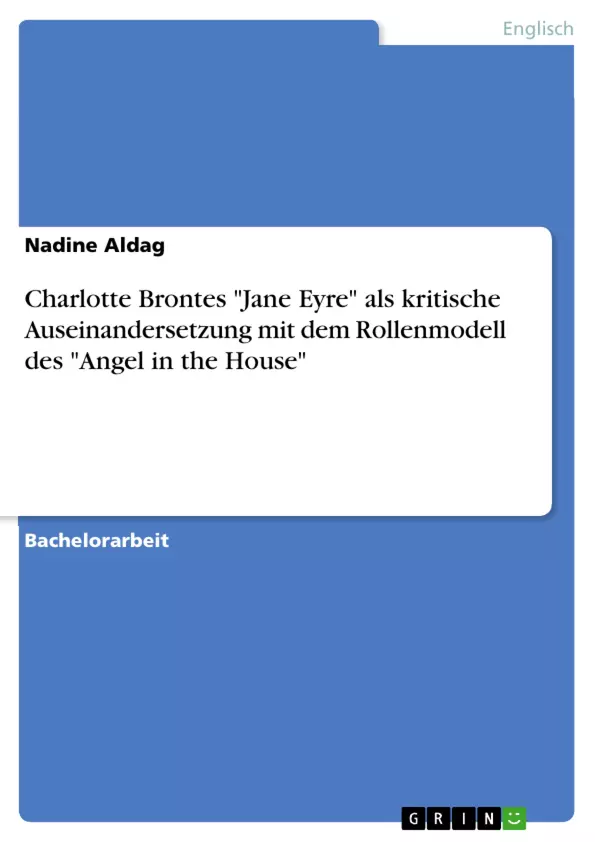Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, aufzuzeigen, dass die Protagonistin Jane Eyre mit dem damals vorherrschenden Rollenmodell bricht und sowohl in ihrer Gedankenäußerung als auch in ihrem Handeln emanzipierte Verhaltensweisen verfolgt. Zunächst gilt es, das gängige Rollenmodell in der viktorianischen Gesellschaft herauszuarbeiten und anhand bestimmter Figuren, denen Jane während ihres Bildungsprozesses begegnet, ausgewählte Facetten im Detail zu diskutieren. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf Janes Freundin Helen Burns, die Schulleiterin Ms. Temple und ihre vermeintliche Konkurrentin Blanche Ingram gelegt. Der Schwerpunkt der Arbeit wird in der Beschäftigung Janes mit den verschiedenen Varianten des „Angel in the House“-Modells wie auch in der Auseinandersetzung mit Vertretern des Patriarchats liegen. Als Konsequenz daraus ergibt sich Janes eigener Lebensweg.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Rollenmodell des „Angel in the House" im viktorianischen Zeitalter
- Verschiedene Varianten des Modells am Beispiel ausgewählter Frauenfiguren
- Helen Burns — die Inkarnation des selbstlosen Engels
- Miss Temple
- Blanche Ingram — die begabte Schönheit
- „l am not an angel" — Janes Weg zu ihrer eigenen Rolle
- Vom Enfant terrible zur disziplinierten jungen Gouvernante
- Als Gouvernante in Thornfield Hall
- Erkenntnisse einer emanzipierten Frau
- Die Begegnung mit der Konkurrentin
- Ein unverhoffter Heiratsantrag
- „Mr. Rochester, I will not be yours" — Jane folgt ihren moralischen Prinzipien
- Die Rückkehr als „independent Woman" und „a marriage between equals" in Ferndean
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Bildungsroman Jane Eyre von Charlotte Brontë, der 1847 erschien. Sie untersucht, wie die Protagonistin Jane Eyre mit dem viktorianischen Rollenmodell der Frau bricht und sich für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung einsetzt. Dabei werden die verschiedenen Facetten des „Angel in the House"-Modells anhand ausgewählter Frauenfiguren beleuchtet, die Jane während ihres Entwicklungsprozesses begegnet.
- Das „Angel in the House"-Modell und seine Auswirkungen auf Frauen im viktorianischen Zeitalter
- Janes Rebellion gegen die Unterdrückung und ihre Suche nach Selbstverwirklichung
- Die Bedeutung von Bildung und Unabhängigkeit für Janes Selbstfindung
- Die Herausforderungen der Liebe und Ehe im Kontext des viktorianischen Patriarchats
- Janes emanzipatorische Reise und ihre Suche nach einer „marriage between equals"
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Frauenrolle im viktorianischen Zeitalter ein und stellt die Protagonistin Jane Eyre vor. Sie zeichnet die Entwicklung der Frauenbewegung in drei Phasen nach und betont die Bedeutung von Bildung und Unabhängigkeit für die Selbstverwirklichung der Frau.
Kapitel 2 analysiert das viktorianische Rollenmodell der Frau, das als „Angel in the House" bezeichnet wird. Es beschreibt die strenge Gesellschaftsordnung, die Frauen in die Rolle der selbstlosen und opferbereiten Hausfrau und Mutter drängte. Die Frau wurde als „Mängelwesen" betrachtet, das sich erst durch die Verbindung zum Mann definierte.
Kapitel 3 beleuchtet drei wichtige Frauenfiguren, die als Kontrastfolien zu Jane Eyre dienen: Helen Burns verkörpert die selbstlose und demütige „Angel in the House", die sich in religiöser Hingabe auf das Jenseits konzentriert. Miss Temple ist eine gütige und mitfühlende Schulleiterin, die jedoch auch die Machtverhältnisse akzeptiert und sich den Befehlen des patriarchalischen Schulvorstehers unterordnet. Blanche Ingram ist eine wunderschöne und begabte Frau, die jedoch ihre „accomplishments" und ihre Schönheit gezielt in Szene setzt, um einen wohlhabenden Mann zu heiraten.
Kapitel 4 zeichnet Janes Entwicklung vom „Enfant terrible" zur „independent woman" nach. Es beschreibt ihre Erfahrungen in Gateshead Hall, wo sie von ihrer Tante und ihrem Cousin misshandelt und ausgegrenzt wird. In Lowood Institution begegnet sie Helen Burns und Miss Temple, die sie in ihrer Rollenfindung beeinflussen. In Thomfield Hall lernt sie ihren Arbeitgeber Edward Fairfax Rochester kennen und verliebt sich in ihn. Sie beobachtet die Beziehung zwischen Rochester und Blanche Ingram, die sich als eine „falsche Angel" entpuppt.
Kapitel 5 untersucht die Beziehung zwischen Jane und Rochester, die sich als eine „marriage between equals" erweist. Jane lehnt Rochesters Herrschaftsansprüche ab und setzt sich für ihre Unabhängigkeit ein. Sie verlässt ihn, als sie von seiner bereits bestehenden Ehe erfährt. Nach einem Jahr kehrt sie zu ihm zurück, nachdem er durch einen Schicksalsschlag körperlich gezeichnet wurde.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Bildungsroman, das viktorianische Zeitalter, das „Angel in the House"-Modell, die Geschlechterrollen, die Emanzipation der Frau, Selbstbestimmung, Bildung, Unabhängigkeit, Liebe und Ehe, die „marriage between equals", sowie die Figuren Jane Eyre, Helen Burns, Miss Temple, Blanche Ingram und Edward Fairfax Rochester.
- Citar trabajo
- Nadine Aldag (Autor), 2009, Charlotte Brontes "Jane Eyre" als kritische Auseinandersetzung mit dem Rollenmodell des "Angel in the House", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133260