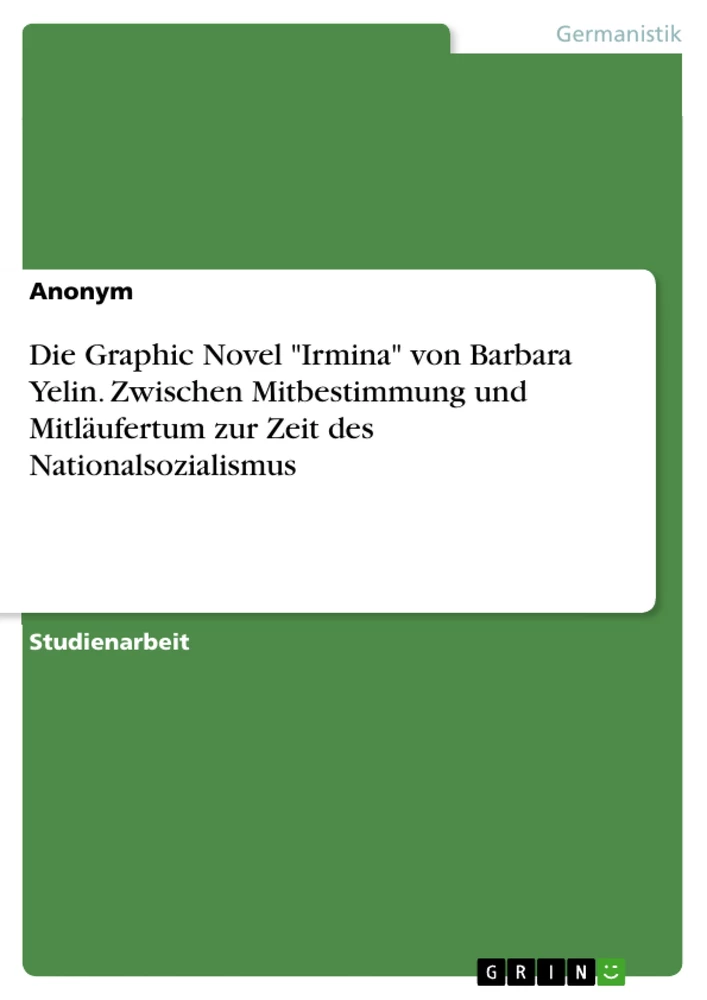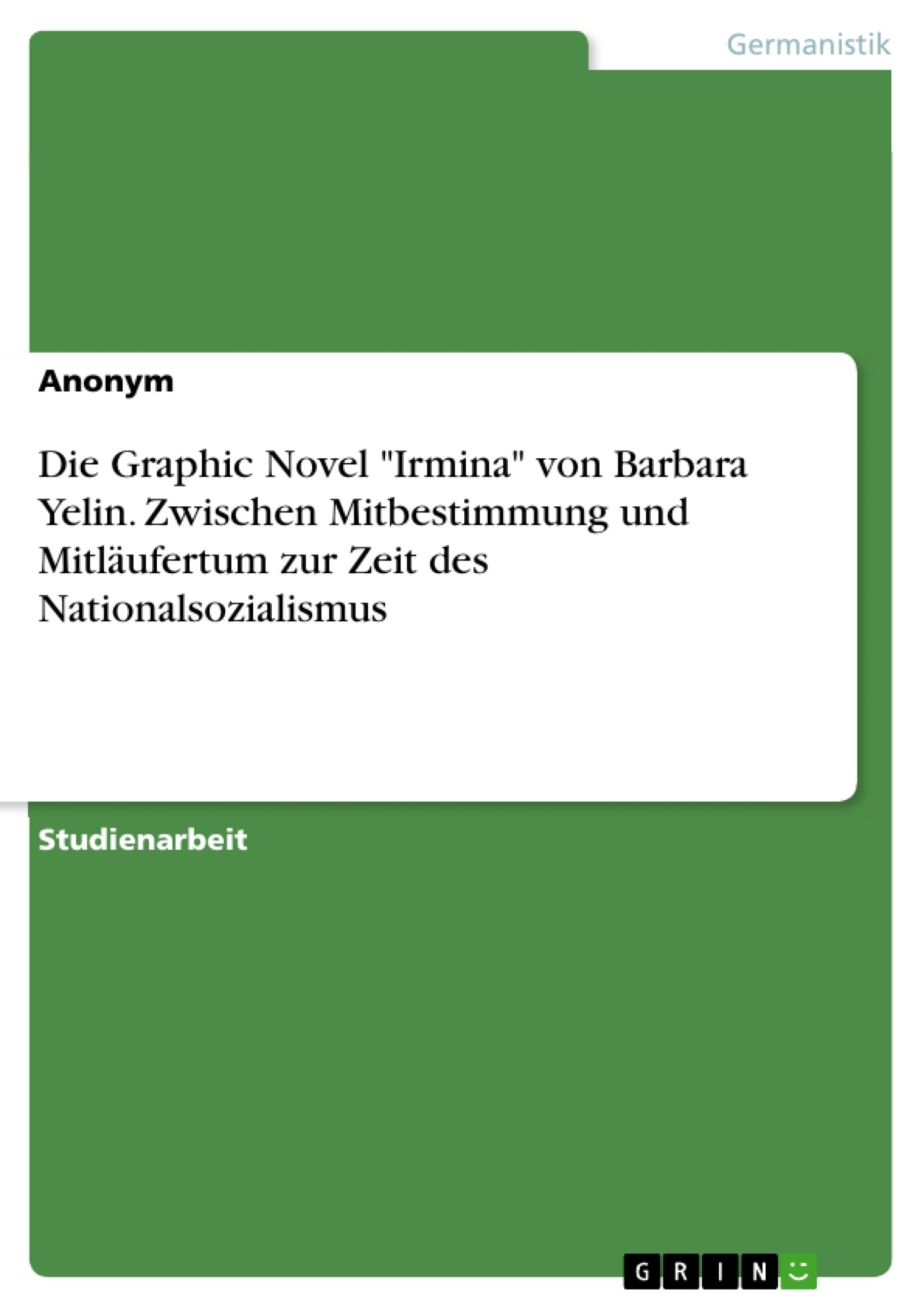Die Hausarbeit behandelt das Mitläufertum der deutschen Gesellschaft zur Zeit des Nationalsozialismus, indem die Graphic Novel "Irmina" von Barbara Yelin diesbezüglich untersucht und analysiert wird. Dabei werden prägnante Passagen der Buchs genauer betrachtet und in ihrer Wirksamkeit und Absicht interpretiert, um abschließend die Darstellungen der Graphic Novel mit der realen Historie in Verbindung zu setzen.
Die Kollektivschuld der deutschen Zivilbevölkerung an der Machtergreifung der Nationalsozialisten und somit auch an der Shoah, ist weiterhin Bestandteil vieler kontroverser Debatten. Die Frage nach der Mitschuld und dem Wissen der Bevölkerung über die Massenvernichtungslager geht einher mit Verdrängungen und Schuldabweisungen. Neben dem aktiven Unterstützen der NS, müssen ebenfalls die Handlungen hinterfragt werden, die als schweigende Akzeptanz zu werten sind. Denn nicht nur die strategische Manipulation oder die Angst vor Sanktionen, Verhaftungen oder gar Tötungen veranlassten die Menschen dem Regime Folge zu leisten. Die Graphic Novel "Irmina" von Barbara Yelin verdeutlicht, dass es auch um eigene Vorteile ging und dass das einfache Wegsehen als eine bewusste Entscheidung zu verstehen ist, die zur Mittäterschaft führt.
Somit stellt sich der Leser selbst die Frage: "Hätte die Figur Irmina Alternativen gehabt?" oder gar "Wie hätte ich zu dieser Zeit gehandelt?". Die Figur und Geschichte um Irmina ist dabei angelehnt auf die hinterbliebenen Briefe, Tagebücher und Fotos der Großmutter Yelins, die als eine nach Autonomie strebende Frau nach England reiste und sich nach ihrer Rückkehr in die deutschnationale "Volksgemeinschaft" eingliederte. Yelin selbst stellt sich die Frage, was ihre Großmutter dazu bewegte, sich aus der Freiheitssuche loszulösen und sich dem Nationalsozialismus bzw. der Anpassung hinzugeben. Jedoch handelt es sich nicht um eine reine Biographie. Ziel ist es einen Blick darauf zu verschaffen, wie es möglich war, die Gesellschaft von einem derartigen Gedankengut zu überzeugen und mitreißen zu lassen. Die Biographie der Großmutter liefert somit eine Ausgangsfrage und wird durch davon unabhängige Recherchen ergänzt bzw. ersetzt, um kein Einzelschicksal darzulegen, sondern die Fragestellung auf die deutsche Bevölkerung zur NS-Zeit zu erweitern.
Anfang der 1930er Jahre reist Irmina von Behdinger aus Stuttgart nach England, um eine Ausbildung als Fremdsprachensekretärin anzutreten. Auf einer Feier lernt sie Howard Green, einen dunkelhäutigen Oxford-Stipendiaten, der ebenfalls nach Selbstbestimmung und Freiheit strebt, kennen und wird dort nicht zuletzt mit rassistischen oder engstirnigen Äußerungen konfrontiert. Die Liebschaft der beiden wird jedoch unterbrochen, da Irmina aufgrund von Geldmangel und der sich verschärfenden politischen Situation nach Deutschland zurückkehren muss. Dort entscheidet sich Irmina für ein Leben unter dem Regime, und die geplante Rückkehr zu Howard nach England findet nicht statt. Die Weltoffenheit und das Streben nach Autonomie der Protagonistin wird im Handlungsverlauf immer mehr von kompromisslosem Ehrgeiz und egozentrischer Vorteilsnahme verdrängt. Eine Stelle im Reichskriegsministerium soll ihr den angestrebten Erfolg und Wohlstand bringen. Zudem lernt sie den Architekten und SS-Offizier Gregor Meinrich kennen, den sie später heiratet.
Dabei übernimmt sie dessen nationalsozialistische Parolen sowie die Loyalität zum deutschen Regime. Später flüchtet die Protagonistin mit dem gemeinsamen Sohn Frieder, während Meinrich im Krieg stirbt. Irminas Anpassung und ihre vermeintliche Aneignung des nationalsozialistischen Gedankenguts wird im Verlauf dieser Arbeit näher analysiert. Bei den abgebildeten Erlebnissen der Protagonistin handelt es sich um kein Einzelschicksal, das hier – wenn auch fiktiv – dargestellt wird. Daher soll die Analyse ebenfalls einen Blick auf die gesamtdeutsche Zivilbevölkerung des Dritten Reichs werfen. Die Graphic Novel endet in den 1980er Jahren mit einer Reise nach Barbados mit dem Ziel, Howard wiederzusehen. Dort angekommen wird Irmina mit ihrer Persönlichkeit aus der Zeit vor der Rückreise nach Deutschland konfrontiert und muss sich eingestehen, dass sie keine Kämpferin gegen das Unrecht ist und ihren Mut verloren hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der Graphic Novel
- Der Wandel des Charakters „Irmina“
- Beweggründe
- ,,Unwissenheit“ & Mitverantwortung_
- Erinnerung - Das Nicht-Erinnern-Wollen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Graphic Novel „Irmina“ von Barbara Yelin befasst sich mit der Frage der individuellen Verantwortung im Kontext des Nationalsozialismus. Yelin untersucht anhand der fiktiven Figur Irmina, wie es möglich war, dass sich Menschen dem NS-Regime anschlossen und die brutalen Verbrechen verdrängten. Die Arbeit beleuchtet die komplexe Dynamik zwischen individueller Selbstbestimmung, Mitläufertum und den Folgen des Schweigens.
- Der Wandel des Charakters „Irmina“ von einer jungen Frau, die nach Freiheit strebt, zu einer Person, die sich dem Nationalsozialismus anschließt und ihre eigenen Ideale verrät.
- Die Frage nach den Beweggründen für Irminas Entscheidung, sich dem NS-Regime anzupassen und die daraus resultierenden Folgen für ihr Leben.
- Die Rolle der „Unwissenheit“ und der Mitverantwortung im Kontext der Verbrechen des Nationalsozialismus.
- Die Bedeutung der Erinnerung und des Nicht-Erinnern-Wollens im Umgang mit der Vergangenheit.
- Die Darstellung der Ambivalenz und des moralischen Dilemmas, vor dem sich viele Menschen während des Nationalsozialismus befanden.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Graphic Novel spielt in London und zeichnet die Geschichte von Irmina, einer jungen Frau, die eine Ausbildung als Fremdsprachensekretärin absolviert. Sie begegnet Howard Green, einem dunkelhäutigen Oxford-Stipendiaten, und entwickelt eine tiefe Verbindung zu ihm. Dieses Kapitel betont Irminas Streben nach Freiheit und Selbstbestimmung.
Im zweiten Kapitel kehrt Irmina nach Deutschland zurück und beginnt ein Leben unter dem NS-Regime. Der Fokus liegt auf ihrer Anpassung an das nationalsozialistische Gedankengut und die Folgen dieser Entscheidung für ihre Beziehung zu Howard.
Schlüsselwörter
Die Graphic Novel „Irmina“ beschäftigt sich mit den zentralen Themen der individuellen Verantwortung, Mitläufertum, Verdrängung, Erinnerung und dem Dilemma des Nicht-Erinnern-Wollens im Kontext des Nationalsozialismus. Wichtige Begriffe sind Selbstbestimmung, Anpassung, „Volksgemeinschaft“, NS-Ideologie, Shoah, individuelle Moral und die schwierige Aufarbeitung der Vergangenheit.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Graphic Novel „Irmina“?
Das Buch thematisiert das Mitläufertum und die Anpassung der deutschen Zivilbevölkerung während des Nationalsozialismus am Beispiel einer jungen Frau.
Ist „Irmina“ eine wahre Geschichte?
Die Geschichte ist fiktiv, basiert aber auf Tagebüchern und Briefen der Großmutter der Autorin Barbara Yelin.
Wie wandelt sich der Charakter Irmina im Buch?
Sie entwickelt sich von einer weltoffenen Frau, die nach Autonomie strebt, zu einer angepassten Mitläuferin, die für persönliche Vorteile wegsieht.
Was sagt das Buch über die Mitschuld der Bevölkerung aus?
Es verdeutlicht, dass Wegsehen eine bewusste Entscheidung war und dass egozentrische Vorteilsnahme zur Mittäterschaft führen kann.
Welche Rolle spielt die Figur Howard Green?
Howard Green ist ein dunkelhäutiger Oxford-Stipendiat, dessen Beziehung zu Irmina an den rassistischen Realitäten der Zeit und Irminas späterer Anpassung scheitert.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Die Graphic Novel "Irmina" von Barbara Yelin. Zwischen Mitbestimmung und Mitläufertum zur Zeit des Nationalsozialismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1333356