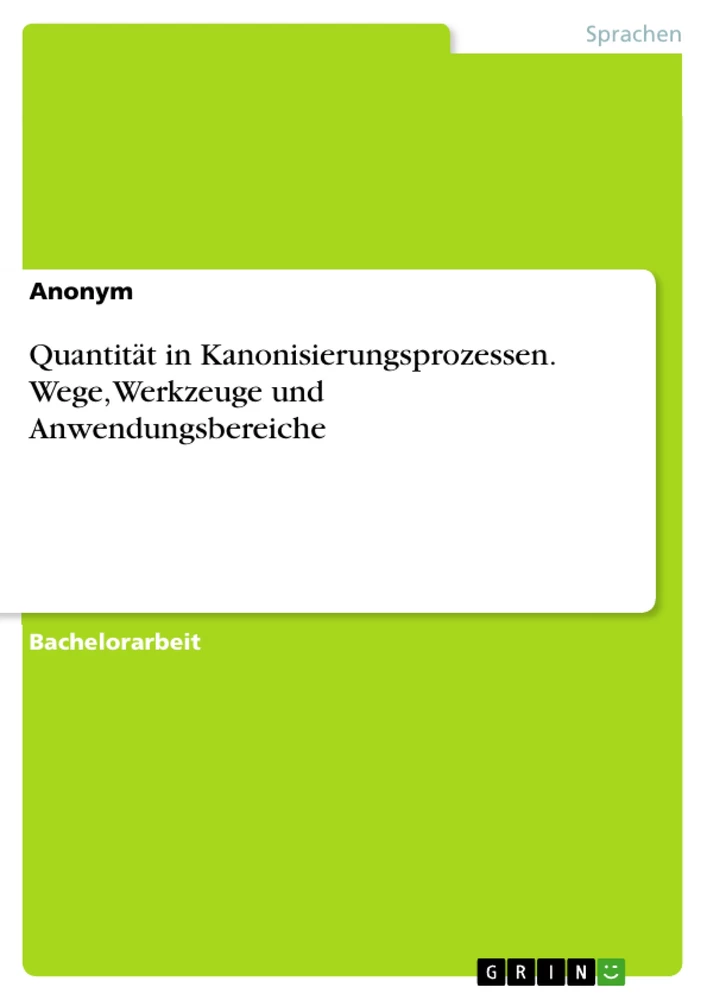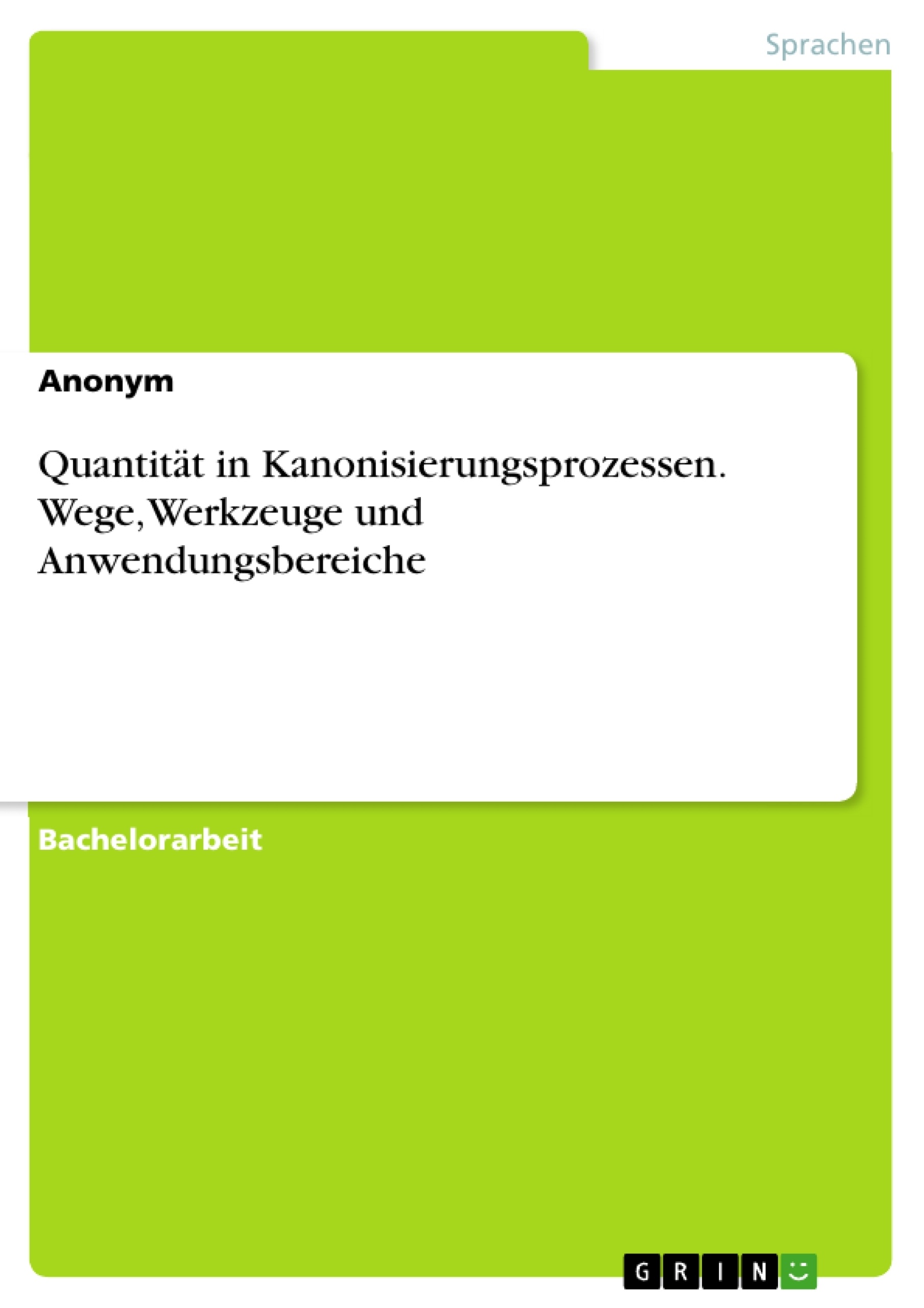Diese Arbeit setzt sich mit Kanonisierungsprozessen in der Literatur und den Auswirkungen beziehungsweise Zusammenhängen von digitalen Textanalyseprogrammen auseinander. Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird der Versuch unternommen, Quantität als Kriterium für Kanonisierungsprozesse zu untersuchen.
Im Zeitalter der Digitalisierung, Industrialisierung und Globalisierung ist dem Menschen eine unendlich große Menge an Information und Wissen zugänglich gemacht worden. Dies bezieht sich auch auf literarische Texte, welche nahezu alle mit nur einem Mausklick im World Wide Web auffindbar sind und dort fast immer kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Durch Programme und Internetseiten wie Google Books oder Projekt Gutenberg war der Zugang zu Wissen und Texten noch nie so einfach wie heute.
Doch mit diesem Wandel der Text- und Wissenskultur mussten sich auch die literaturwissenschaftlichen Methoden verändern. Man braucht eine Möglichkeit, diese Unzahl an Texten effizienter zu analysieren und zu bearbeiten. Mit der close reading Methode – eine Methode, bei der die Texte sehr genau und vor allem vollständig gelesen werden – können Literaturwissenschaftler:innen in ihrem Leben allerhöchstens einen Bruchteil des vorhandenen Textbestandes bearbeiten, ganz zu schweigen davon, dass man die meisten Werke dabei mehrmals gelesen haben sollte oder durch Faktoren wie Sprache in der Auswahl eingeschränkt bleibt.
Um dieser Masse an Informationen Herr zu werden, nimmt diese Methode, die Texte einer qualitativen Analyse zu unterziehen, viel zu viel Zeit in Anspruch und ist im heutigen, digitalen Zeitalter beinahe als veraltet zu bezeichnen. Wird die Beschaffung (literarischer) Texte einfacher und kostengünstiger, müssen sich Literaturtheorie und Methodik dementsprechend anpassen.
Da digitale Technologien diese Veränderung provoziert haben, scheinen sie auch die Lösung zu liefern. Speziell im Fall der Literatur bedeutet das das Aufkommen von Programmen wie den Google Ngram-Viewer, den Metricalizer oder Cosmas II. Große Textmengen in kurzer Zeit auf ausgewählte Kriterien zu untersuchen, kann in vielerlei Hinsicht hilfreich sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Problemstellung Subjektivität / Quantität in der Literatur
- 3. Wege, Werkzeuge und Anwendungsbereiche
- 3.1 Erste Ideenentwürfe
- 3.2 Der Metricalizer
- 3.3 Das Kontrollkorpus
- 3.4 Die Epoche
- 3.5 Die Lyrikanthologien
- 4. Applikation
- 4.1 Vergleichskorpus Freiburger Anthologie
- 4.2 Vergleiche mit den einzelnen Anthologien
- 4.3 Ergebnisauswertung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Rolle der Quantität in Kanonisierungsprozessen der neueren deutschen Literatur. Ziel ist es, die gängigen qualitativen Kriterien für Kanonbildung zu hinterfragen und die Bedeutung rein quantitativer Faktoren zu erforschen. Eine neu entwickelte Methode der Literaturanalyse wird vorgestellt und auf ihre Plausibilität getestet.
- Quantität als Kriterium für Kanonisierung
- Subjektivität vs. Objektivität in der Kanonbildung
- Digitale Methoden der Textanalyse und ihre Anwendung auf Kanonforschung
- Einfluss von digitalen Technologien auf die Literaturwissenschaft
- Bewertung existierender Kanontheorien im Lichte quantitativer Daten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Kanonisierung im digitalen Zeitalter ein. Sie betont den Wandel der Literaturwissenschaftlichen Methoden angesichts der immensen Menge an digital verfügbaren Texten und stellt die Notwendigkeit effizienterer Analysemethoden heraus. Die Arbeit fokussiert sich auf die Rolle der Quantität bei Kanonisierungsprozessen, ein bislang relativ unerforschtes Feld, das die etablierte Kanonforschung neu beleuchtet.
2. Problemstellung Subjektivität / Quantität in der Literatur: Dieses Kapitel beleuchtet die Problematik der Subjektivität in Kanonisierungsprozessen, die auf unterschiedlichen Wertmaßstäben und den oft homogenen Hintergründen kanonbildender Institutionen beruht. Es wird argumentiert, dass objektive Kanonbildung aufgrund der menschlichen Subjektivität unmöglich ist und die Arbeit daher die Rolle quantitativer Kriterien untersuchen möchte.
3. Wege, Werkzeuge und Anwendungsbereiche: Dieses Kapitel beschreibt die Methoden und Werkzeuge, die in der Arbeit zur Analyse von Kanonisierungsprozessen eingesetzt werden. Es geht auf die Entwicklung eigener Ansätze ein und beschreibt den Einsatz digitaler Werkzeuge wie dem Metricalizer zur quantitativen Textanalyse. Die Auswahl des Korpus und die Definition der relevanten Epochen und Anthologien werden detailliert dargelegt.
4. Applikation: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Analysen. Ein Vergleichskorpus, basierend auf der Freiburger Anthologie, wird mit anderen Anthologien verglichen, um quantitative Muster und Zusammenhänge in Bezug auf Kanonisierung aufzudecken. Die Auswertung dieser quantitativen Daten wird detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Kanonisierung, Quantität, Qualitative Methoden, Quantitative Methoden, Digitale Geisteswissenschaften, Digital Humanities, Literaturanalyse, Metricalizer, Lyrikanthologien, Neuere deutsche Literatur, Subjektivität, Objektivität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Quantität in Kanonisierungsprozessen der neueren deutschen Literatur
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Rolle der Quantität in Kanonisierungsprozessen der neueren deutschen Literatur. Sie hinterfragt gängige qualitative Kriterien und erforscht die Bedeutung rein quantitativer Faktoren bei der Kanonbildung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung quantitativer Faktoren in der Kanonbildung zu erforschen und eine neu entwickelte Methode der Literaturanalyse vorzustellen und zu testen. Sie möchte die Subjektivität in der Kanonisierung hinterfragen und die Möglichkeiten objektiverer Ansätze mithilfe digitaler Methoden erkunden.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit nutzt eine neu entwickelte Methode der Literaturanalyse und setzt digitale Werkzeuge wie den Metricalizer ein. Es wird ein Vergleichskorpus erstellt, basierend auf der Freiburger Anthologie, und mit anderen Anthologien verglichen. Die Analyse basiert auf quantitativen Daten und deren Auswertung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die folgenden Themenschwerpunkte: Quantität als Kriterium für Kanonisierung, Subjektivität vs. Objektivität in der Kanonbildung, digitale Methoden der Textanalyse und ihre Anwendung auf Kanonforschung, Einfluss digitaler Technologien auf die Literaturwissenschaft und die Bewertung existierender Kanontheorien im Lichte quantitativer Daten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Problemstellung Subjektivität/Quantität in der Literatur, Wege, Werkzeuge und Anwendungsbereiche (inkl. Beschreibung des Metricalizers und des Korpus), Applikation (inkl. Vergleichskorpus und Ergebnisauswertung) und Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kanonisierung, Quantität, Qualitative Methoden, Quantitative Methoden, Digitale Geisteswissenschaften, Digital Humanities, Literaturanalyse, Metricalizer, Lyrikanthologien, Neuere deutsche Literatur, Subjektivität, Objektivität.
Welche Korpora werden verwendet?
Die Arbeit verwendet ein Vergleichskorpus basierend auf der Freiburger Anthologie und vergleicht dieses mit weiteren Lyrikanthologien. Die genaue Auswahl der Anthologien wird im Kapitel "Wege, Werkzeuge und Anwendungsbereiche" detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Im Kapitel "Applikation" werden die Ergebnisse der durchgeführten Analysen präsentiert. Es werden quantitative Muster und Zusammenhänge in Bezug auf Kanonisierung aufgedeckt und detailliert ausgewertet.
Was ist der Metricalizer?
Der Metricalizer ist ein digitales Werkzeug, das in der Arbeit zur quantitativen Textanalyse eingesetzt wird. Eine genaue Beschreibung seiner Funktion und Anwendung findet sich im Kapitel "Wege, Werkzeuge und Anwendungsbereiche".
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler*innen im Bereich der Literaturwissenschaft, Digital Humanities und der digitalen Geisteswissenschaften, die sich mit Kanonisierungsprozessen, quantitativen Methoden in der Literaturanalyse und dem Einfluss digitaler Technologien auf die Forschung beschäftigen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2018, Quantität in Kanonisierungsprozessen. Wege, Werkzeuge und Anwendungsbereiche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1333960