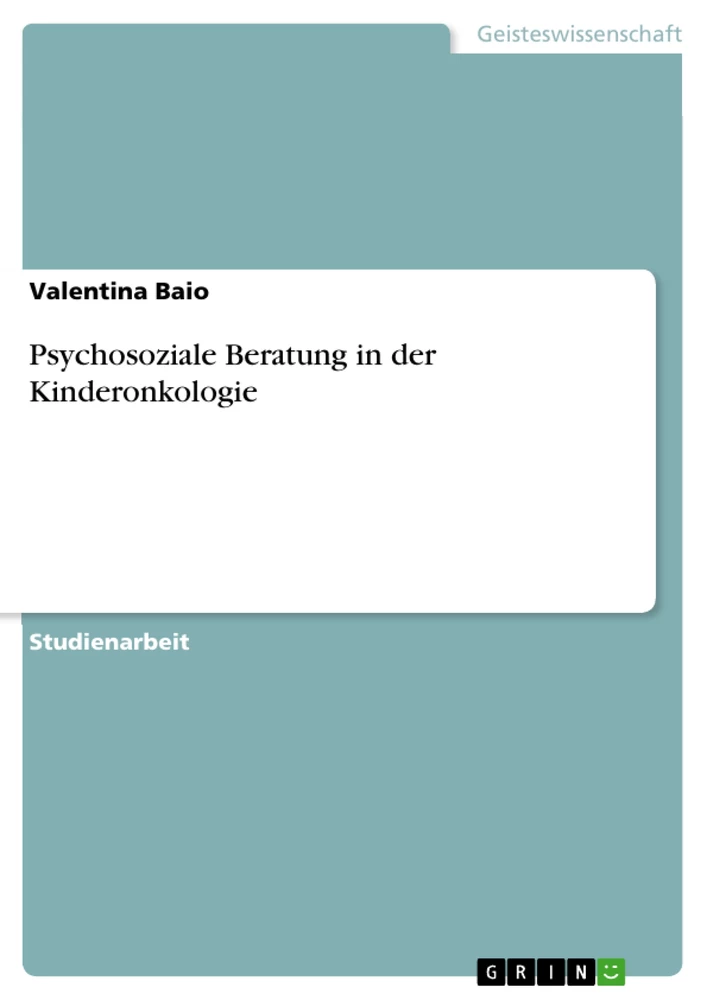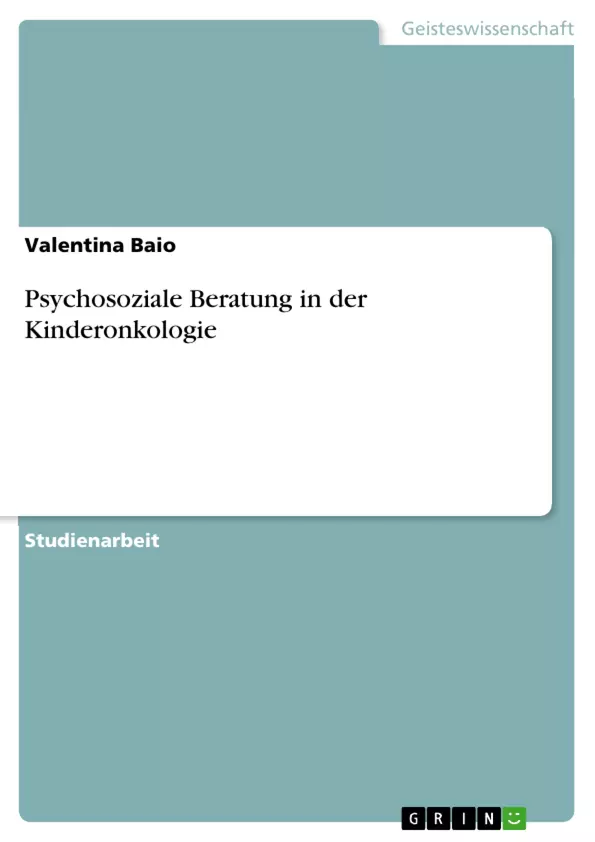Jährlich erkranken ca. 2200 Kinder an Krebs, was dazu führt, dass nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern eine schwerwiegende Zeit bevorsteht.
Die Diagnose einer Krebserkrankung des eigenen Kindes lässt nahezu alle Familien in einen Schockzustand verfallen. Dabei sind die Angehörigen der Patienten oftmals nicht in der Lage, sich bestehende Ansprüche sowie Informationen selbst zu beschaffen. Genau an diesem Punkt setzt die psychosoziale Beratung ein, indem sie die Betroffenen über das Krankheitsbild, den Verlauf sowie sozialrechtliche Fragen aufklärt.
Da die Krankheits- und Behandlungsverläufe sehr individuell verlaufen und die gesamte Familie betreffen, erweist sich die Versorgung als sehr herausfordernd. Das psychosoziale Team in der kinderonkologischen Versorgung arbeitet eng mit dem gesamten Behandlungsteam zusammen. Dabei erfolgt die Versorgung sowohl auf der psychologischen als auch auf der sozialrechtlichen Ebene. Demnach beraten Sozialarbeiter Familien zu bestehenden Unterstützungsmöglichkeiten, der Vermittlung von Hilfsmitteln, der finanziellen Unterstützung sowie der Organisation der Geschwisterbetreuung. Die psychologische Unterstützung erfolgt dabei durch die problemzentrierte Intervention in der bestehenden Krisensituation.
Es ist bedeutsam, dass die Unterstützungsangebote für die Familien zeitnah erfolgen und nicht psychologisierend sind. Dabei ist zu beachten, dass es Familien gibt, die einen höheren Belastungsgrad durch die Erkrankung des Kindes aufweisen und deshalb eine intensivere Versorgung benötigen. Dies betrifft primär Patienten mit einer schlechten Prognose, Patienten mit einem Rezidiv sowie Palliativpatienten.
Die psychosoziale Versorgung stellt eine hohe Anforderung an die Kompetenzen des Beratenden. Dabei wird vorausgesetzt, dass der Beratende Grundkenntnisse über die onkologischen Erkrankungen sowie gängige Behandlungen und deren Nebenwirkungen besitzt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretischer und empirischer Hintergrund
- 2.1. Psychosoziale Beratung in der klinischen Versorgung
- 2.2. Das Kompetenzprofil eines Sozialarbeiters bei der Arbeit mit chronisch kranken Kindern und deren Angehörigen
- 3. Zielsetzung und Fragestellung
- 4. Methode
- 4.1. Studiendesign und Vorverständnis
- 4.2. Stichprobe und Rekrutierung
- 4.3. Datenerhebung und Datenanalyse
- 5. Ergebnisse
- 6. Diskussion
- 6.1. Diskussion der Methode
- 6.2. Diskussion der Ergebnisse
- 7. Praxisreflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der psychosozialen Beratung in der Kinderonkologie und beleuchtet die Kompetenzen eines Sozialarbeiters in diesem Kontext. Die Arbeit analysiert die Rolle des Sozialarbeiters bei der Unterstützung von chronisch kranken Kindern und ihren Familien im Hinblick auf die Bewältigung der Krankheit, die Organisation der Versorgung und die Nutzung sozialrechtlicher Angebote.
- Psychosoziale Beratung in der Kinderonkologie
- Kompetenzprofil des Sozialarbeiters
- Unterstützung von Familien in Krisensituationen
- Vermittlung von Hilfsmitteln und finanzieller Unterstützung
- Soziale und psychische Belastungen durch die Erkrankung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der psychosozialen Beratung in der Kinderonkologie ein und beleuchtet die Bedeutung des Sozialarbeiters in diesem Kontext. Kapitel 2 analysiert den theoretischen und empirischen Hintergrund der psychosozialen Beratung in der klinischen Versorgung sowie das Kompetenzprofil eines Sozialarbeiters bei der Arbeit mit chronisch kranken Kindern und ihren Angehörigen. In Kapitel 3 werden die Zielsetzung und Fragestellung der Arbeit präzisiert. Kapitel 4 beschreibt die angewandte Methode, einschließlich Studiendesign, Stichprobe, Datenerhebung und Datenanalyse. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung. Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse und die Methode. Abschließend wird in Kapitel 7 die Praxisrelevanz der Erkenntnisse reflektiert.
Schlüsselwörter
Kinderonkologie, psychosoziale Beratung, Sozialarbeit, Kompetenzen, chronische Erkrankung, Familien, Unterstützung, Hilfsmittel, finanzielle Unterstützung, sozialrechtliche Beratung, Belastungen, Ressourcen, Interventionen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Aufgaben eines Sozialarbeiters in der Kinderonkologie?
Sozialarbeiter beraten Familien zu Unterstützungsmöglichkeiten, vermitteln Hilfsmittel, unterstützen bei finanziellen Fragen, organisieren die Geschwisterbetreuung und klären über sozialrechtliche Ansprüche auf.
Wie viele Kinder erkranken in Deutschland jährlich an Krebs?
Jährlich erkranken in Deutschland etwa 2200 Kinder an einer Krebserkrankung.
Welche psychologische Unterstützung wird in der Krisensituation angeboten?
Die psychologische Unterstützung erfolgt primär durch problemzentrierte Interventionen direkt in der bestehenden Krisensituation der betroffenen Familien.
Welche Patientengruppen benötigen eine besonders intensive Versorgung?
Patienten mit einer schlechten Prognose, Patienten mit einem Rezidiv (Rückfall) sowie Palliativpatienten weisen einen höheren Belastungsgrad auf und benötigen intensivere Betreuung.
Welche Kompetenzen muss ein Berater in diesem Feld mitbringen?
Neben beraterischen Fähigkeiten sind Grundkenntnisse über onkologische Erkrankungen, gängige Behandlungen und deren Nebenwirkungen zwingend erforderlich.
- Quote paper
- Valentina Baio (Author), 2022, Psychosoziale Beratung in der Kinderonkologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1335788