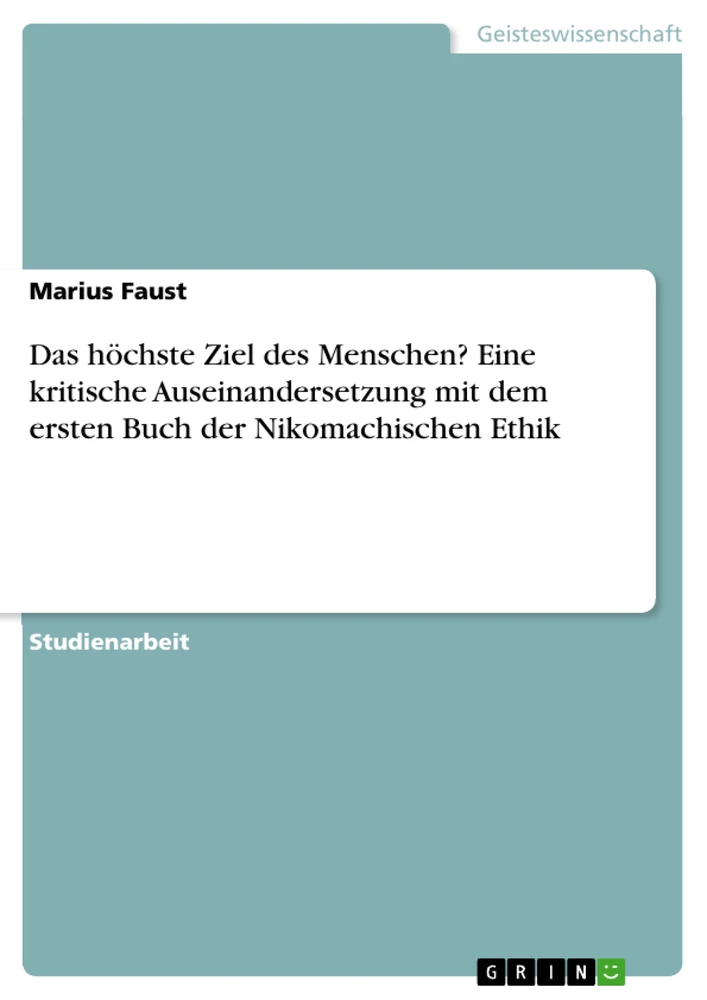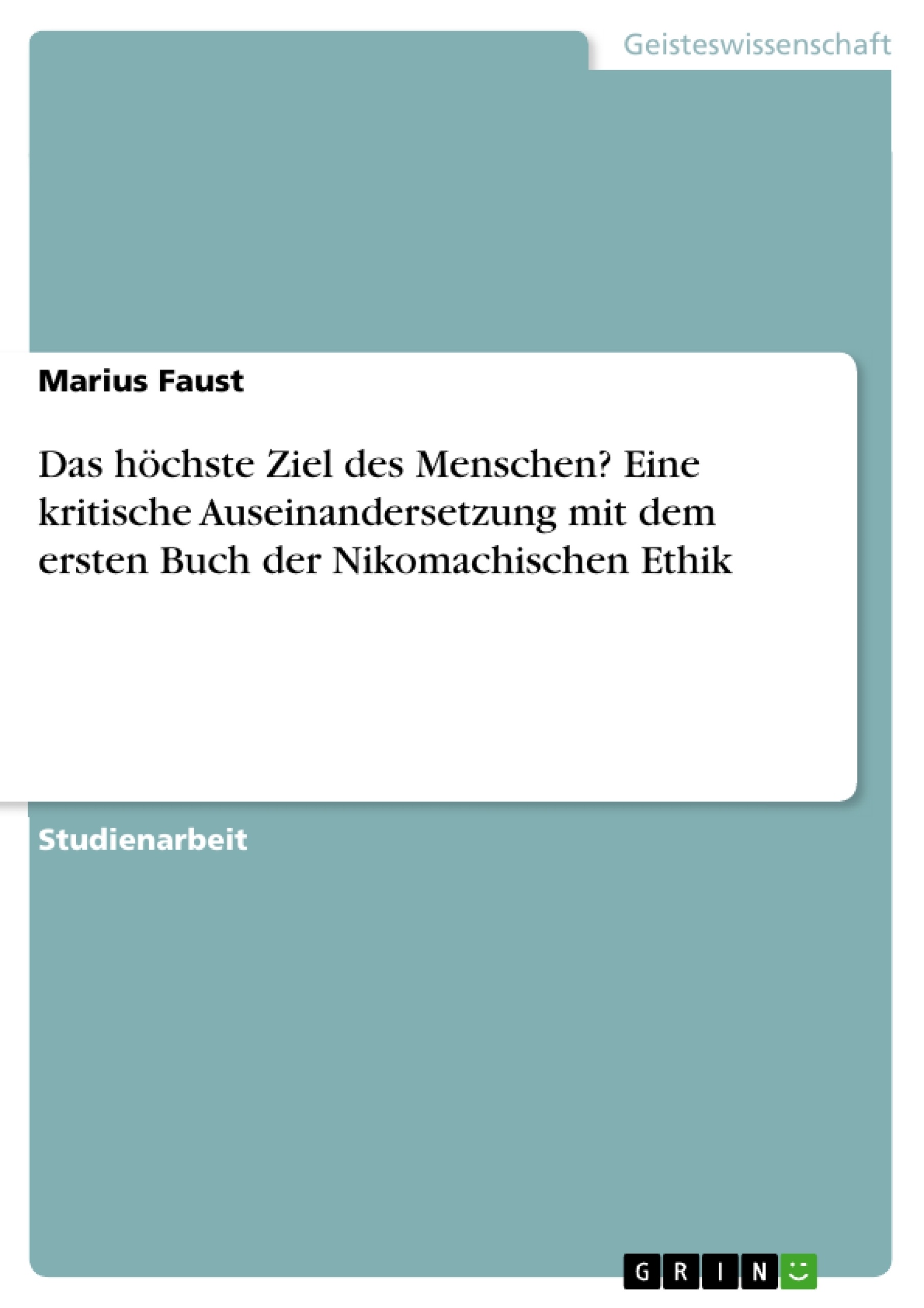Ähnlich wie Kant in seiner „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“, versucht auch Aristoteles in dem ersten Buch der Nikomachischen Ethik das höchste und beste Gut des Menschen zu bestimmen. Anders als bei Kant, der dieses höchste Gut im menschlichen Willen verortet, findet Aristoteles jenes in der eudaimonia (griechisch: Glück, Glückseligkeit).
Ein Vergleich dieser beiden Konzeptionen ist allerdings nicht Ziel dieser Hausarbeit. Stattdessen wird eine Fragestellung hinsichtlich des Abschnitts 1094a - 1097b des ersten Buches der Nikomachischen Ethik (NE) entwickelt und diese dann anhand des Kommentars von Ursula Wolf dargelegt und im Anschluss diskutiert.
Die Fragestellung beruht auf der Suche Aristoteles' nach dem höchsten Gut des Menschen und dessen, was dieses letztendlich sein soll. Innerhalb des ersten Buches der NE stellt sich für den Leser heraus, dass Aristoteles jenes gesuchte Gut in der eudaimonia verortet. Die Vorstellung dessen, wie eudaimonia zu verstehen ist und vor allem, was sie für das Leben des Menschen bedeutet, ist allerdings nicht eindeutig geklärt.
Jene Uneindeutigkeit rührt daher, dass der eudaimonia Begriff, auf zwei verschiedene Arten verstanden werden kann, die sich jedoch stark voneinander unterscheiden. Es ist einerseits die Rede von einer sogenannten „dominanten“ und andererseits von einer sogenannten „inklusiven“ Lesart, welche im Folgenden auch noch näher erläutert werden. Da die Auslegung Aristoteles' bezüglich der eudaimonia innerhalb der NE jedoch diese beiden konträren Lesarten zulässt, entsteht die Frage danach, welche von beiden wohl am ehesten mit dem aristotelischen Verständnis korrespondiert.
Angestoßen wurde diese Debatte von dem Altphilologen und Philosophiehistoriker William Francis Ross Hardie in seinem Aufsatz „The Final Good in Aristotle's Ethics“. Um die Frage nach diesen beiden Lesarten darlegen zu können, wird vorab die Fragestellung innerhalb der NE kontextualisiert. Dabei wird neben der NE von Aristoteles einen Auszug aus dem Kommentar von Ursula Wolf verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsangabe
- Nikomachischen Ethik: Das höchste Ziel des Menschen?
- Fazit
- Nachwort
- Literatur und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die kritische Auseinandersetzung mit dem ersten Buch der „Nikomachischen Ethik" von Aristoteles, um das höchste Ziel des Menschen zu verstehen. Die Arbeit fokussiert dabei auf die Frage, ob die eudaimonia (Glückseligkeit) tatsächlich das höchste Gut des Menschen darstellt und untersucht dabei zwei gegensätzliche Interpretationen, die „dominante“ und die „inklusive“ Lesart. Die Arbeit verwendet den Kommentar von Ursula Wolf als Grundlage zur Analyse.
- Das höchste Ziel des Menschen laut Aristoteles
- Die eudaimonia als höchstes Gut
- Die „dominante“ und die „inklusive“ Lesart der eudaimonia
- Die Rolle der Moral und der Tugenden in der eudaimonia
- Die Interpretation der „Nikomachischen Ethik“ durch Ursula Wolf
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Vorwort erläutert die methodische Vorgehensweise der Arbeit und stellt die beiden Hauptquellen, die „Nikomachische Ethik“ von Aristoteles und den Aufsatz „Nikomachische Ethik“ von Ursula Wolf vor. Es wird zudem auf die „strukturelle These“ von Ursula Wolf eingegangen, die für diese Arbeit von großer Bedeutung ist.
- Im ersten Kapitel wird das höchste Gut nach Aristoteles analysiert. Es werden die beiden Lesarten der eudaimonia vorgestellt und diskutiert, um die Frage nach der korrekten Interpretation der „Nikomachischen Ethik“ zu klären.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die „Nikomachische Ethik“ von Aristoteles, das höchste Ziel des Menschen, die eudaimonia, die „dominante“ und die „inklusive“ Lesart, die Moral, die Tugenden, und den Kommentar von Ursula Wolf. Diese Begriffe stellen die zentralen Themen und Konzepte der Arbeit dar.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Eudaimonia“ bei Aristoteles?
Eudaimonia wird meist als Glückseligkeit übersetzt und bezeichnet das höchste Gut und das Endziel allen menschlichen Handelns.
Was ist der Unterschied zwischen der dominanten und inklusiven Lesart?
Die dominante Lesart sieht ein einziges Ziel (z. B. Kontemplation) als höchstes Gut; die inklusive Lesart begreift Eudaimonia als Summe mehrerer Güter und Tugenden.
Wie definiert Aristoteles das höchste Gut?
Es muss autark (für sich allein genügend) sein und um seiner selbst willen angestrebt werden, nicht als Mittel zu einem anderen Zweck.
Welche Rolle spielt Ursula Wolf in dieser Arbeit?
Ihr Kommentar zur Nikomachischen Ethik dient als Grundlage für die Interpretation der aristotelischen Glückskonzeption.
Warum ist die Nikomachische Ethik heute noch aktuell?
Sie liefert grundlegende Fragen zur Lebensführung, zu Tugenden und zum Verständnis eines „guten Lebens“, die zeitlos relevant sind.
- Citation du texte
- Marius Faust (Auteur), 2015, Das höchste Ziel des Menschen? Eine kritische Auseinandersetzung mit dem ersten Buch der Nikomachischen Ethik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1335863