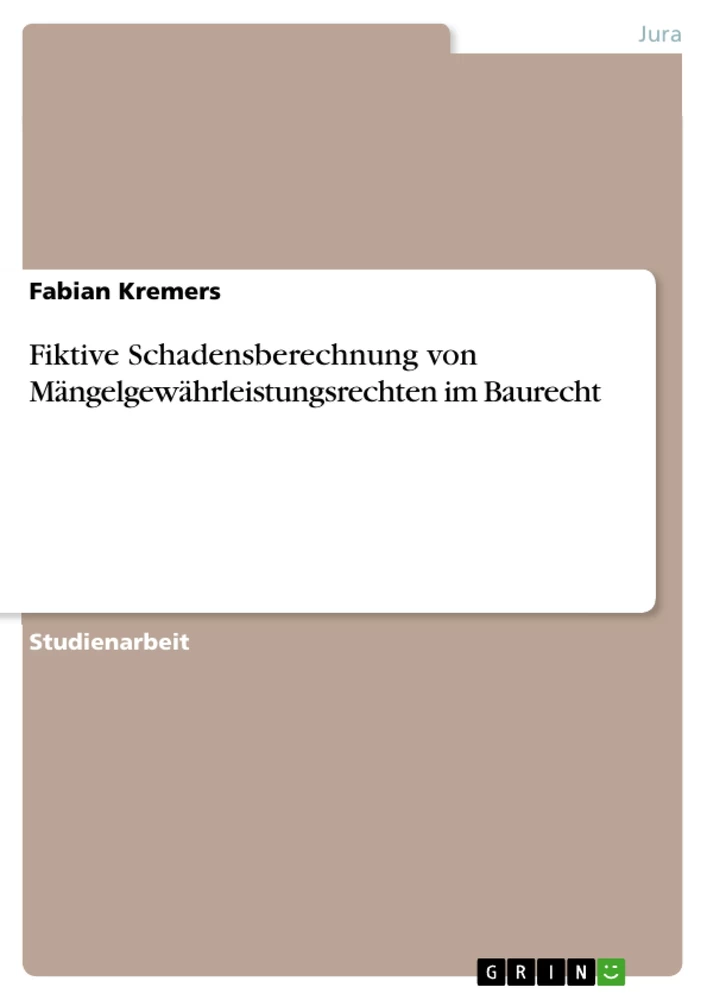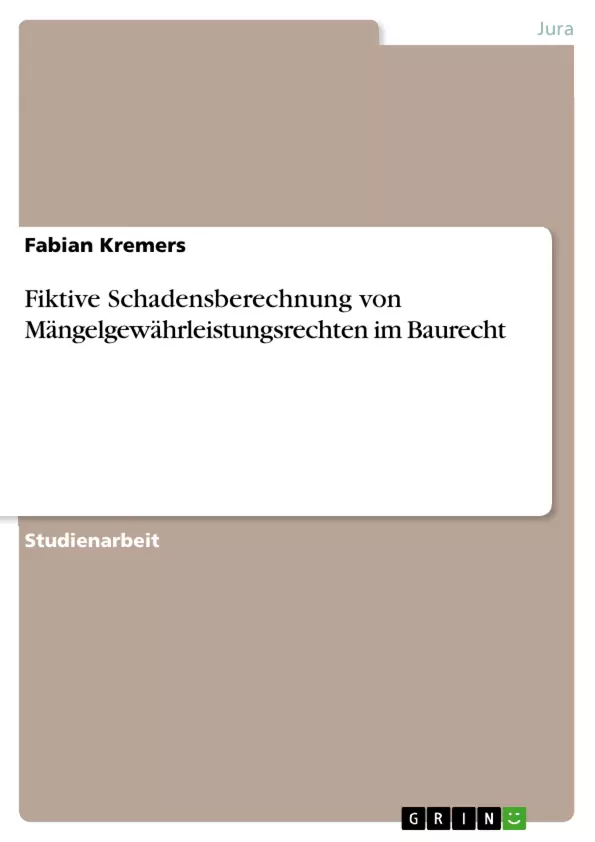Diese Arbeit beleuchtet die fiktive Schadensberechnung von Mängelbeseitigungskosten im Baurecht – ein Instrument, das lange Zeit zur Schadensbemessung herangezogen wurde, jedoch durch das BGH-Urteil vom 22.02.2018 (VII ZR 46/17) verworfen wurde.
Ausgehend von diesem Urteil wird die Problematik der Schadensberechnung im Baurecht detailliert analysiert. Im Fokus steht die Frage, ob ein Besteller, der Mängel nicht tatsächlich beseitigen lässt, dennoch Schadensersatz fordern kann. Die Arbeit setzt sich vertiefend mit der Begründung des BGH auseinander und erläutert das Konzept der fiktiven Schadensberechnung im Kontext der Mängelgewährleistung.
Dabei werden die maßgeblichen Regelungen des Werkvertragsrechts (§§ 634, 635 BGB) sowie die Bedeutung des Gefahrenübergangs (§ 640 Abs. 1 Satz 1 BGB) erörtert. Besonders praxisrelevant ist die Frage, wie sich der Umfang des Schadensersatzes bestimmen lässt, wenn die Mängelbeseitigung nicht durchgeführt wird. Diese Untersuchung gibt Aufschluss über die Auswirkungen des Urteils und die aktuelle Rechtslage in der Baupraxis.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Inhaltsangabe: Urteil vom 22.02.2018 - VII ZR 46/17
- I. Sachverhalt
- II. Urteilsgründe in der Revisionsinstanz (BGH)
- III. Nachinstanz (OLG Düsseldorf)
- C. Analyse
- I. Teleologie der fiktiven Schadensberechnung
- II. Ursprung und Entwicklung der Schadensberechnung anhand fiktiver Mängelbeseitigungskosten
- 1. Originäre Regelung
- 2. Ausbau der Grundstrukturen der fiktiven Schadensberechnung
- 3. Beginn einer restriktiven Rechtsprechungslinie
- 4. Weitere Entwicklung
- 5. Alternativen zur fiktiven Schadensberechnung
- 6. Alternative im laufenden Verfahren: Vorschuss
- III. Stellungnahme
- D. Folgen für die Praxis
- E. Ausweitung auf andere Rechtsgebiete?
- F. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die fiktive Schadensberechnung von Mängelgewährleistungsrechten im Baurecht, insbesondere anhand des Urteils vom 22.02.2018 - VII ZR 46/17. Ziel ist es, die Teleologie dieser Berechnungsmethode zu analysieren, ihre historische Entwicklung nachzuvollziehen und aktuelle Rechtsprechung kritisch zu beleuchten.
- Teleologie der fiktiven Schadensberechnung
- Entwicklung der Rechtsprechung zur fiktiven Schadensberechnung
- Kritik an der fiktiven Schadensberechnung und Alternativen
- Praktische Folgen der Rechtsprechung
- Potenzielle Ausweitung auf andere Rechtsgebiete
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Diese Einleitung dient als Einführung in die Thematik der fiktiven Schadensberechnung im Baurecht und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie legt den Fokus auf die Bedeutung der Thematik und die Notwendigkeit einer detaillierten Untersuchung der Rechtslage.
B. Inhaltsangabe: Urteil vom 22.02.2018 - VII ZR 46/17: Dieser Abschnitt präsentiert eine detaillierte Zusammenfassung des o.g. BGH-Urteils. Er beschreibt den Sachverhalt, die Verfahrensgeschichte (erste, zweite und Revisionsinstanz), die Argumentation des BGH und die wesentlichen Entscheidungsgründe. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Urteils als Ausgangspunkt für die weiterführende Analyse.
C. Analyse: Dieser zentrale Teil der Arbeit analysiert die Teleologie der fiktiven Schadensberechnung, erforscht ihren Ursprung und ihre Entwicklung, beleuchtet kritische Aspekte der Rechtsprechung und diskutiert Alternativen. Die Analyse betrachtet die Ausweitung auf Mangelfolgeschäden, die Nichtverweisung auf die objektive Minderung und die Einschränkungen in der Rechtsprechung, z.B. im Verhältnis zwischen Haupt- und Vorunternehmern. Dabei werden verschiedene Gerichtsentscheidungen und Meinungen in der Literatur eingehend diskutiert.
D. Folgen für die Praxis: Dieser Abschnitt bewertet die praktischen Auswirkungen der dargestellten Rechtsprechung auf die Abwicklung von Bauprojekten und die Schadensregulierung. Hier wird die Bedeutung der Erkenntnisse der Analyse für die Praxis hervorgehoben und mögliche Konsequenzen für die beteiligten Parteien aufgezeigt.
E. Ausweitung auf andere Rechtsgebiete?: Dieser Teil untersucht die Frage, ob die Erkenntnisse und Prinzipien der fiktiven Schadensberechnung im Baurecht auch auf andere Rechtsgebiete übertragbar sind und welche Herausforderungen und Besonderheiten sich dabei stellen könnten.
Schlüsselwörter
Fiktive Schadensberechnung, Mängelgewährleistung, Baurecht, BGH-Rechtsprechung, Mangelfolgeschäden, objektive Minderung, Schadensersatz, Bauverträge, Rechtsentwicklung, Praxisrelevanz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur fiktiven Schadensberechnung im Baurecht
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die fiktive Schadensberechnung im Baurecht, insbesondere im Kontext von Mängelgewährleistungsrechten. Sie untersucht die Teleologie dieser Berechnungsmethode, ihre historische Entwicklung und die aktuelle Rechtsprechung, unter anderem anhand des BGH-Urteils vom 22.02.2018 - VII ZR 46/17.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: die Teleologie der fiktiven Schadensberechnung, die historische Entwicklung der Rechtsprechung dazu (inkl. kritischer Betrachtung und Alternativen), die praktischen Folgen für die Abwicklung von Bauprojekten und die Schadensregulierung, sowie die potentielle Übertragbarkeit der Prinzipien auf andere Rechtsgebiete.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Abschnitte: Einleitung, Inhaltsangabe des BGH-Urteils (inkl. Sachverhalt und Verfahrensgang), detaillierte Analyse der fiktiven Schadensberechnung (Ursprung, Entwicklung, Kritik, Alternativen), Folgen für die Praxis, Übertragbarkeit auf andere Rechtsgebiete und Fazit.
Welches BGH-Urteil steht im Mittelpunkt der Analyse?
Das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 22.02.2018 - VII ZR 46/17 dient als zentraler Fallbeispiel für die Untersuchung der fiktiven Schadensberechnung im Baurecht.
Welche Aspekte der fiktiven Schadensberechnung werden kritisch beleuchtet?
Die Arbeit beleuchtet kritische Aspekte der Rechtsprechung zur fiktiven Schadensberechnung, diskutiert Einschränkungen (z.B. im Verhältnis zwischen Haupt- und Vorunternehmern) und Alternativen zu dieser Berechnungsmethode.
Welche Alternativen zur fiktiven Schadensberechnung werden diskutiert?
Die Arbeit erörtert verschiedene Alternativen zur fiktiven Schadensberechnung, darunter auch die Möglichkeit eines Vorschusses im laufenden Verfahren.
Welche praktischen Folgen hat die Rechtsprechung zur fiktiven Schadensberechnung?
Der Abschnitt "Folgen für die Praxis" bewertet die Auswirkungen der Rechtsprechung auf die Abwicklung von Bauprojekten und die Schadensregulierung, und zeigt mögliche Konsequenzen für die beteiligten Parteien auf.
Ist die fiktive Schadensberechnung auf andere Rechtsgebiete übertragbar?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob die Prinzipien der fiktiven Schadensberechnung im Baurecht auf andere Rechtsgebiete übertragbar sind und welche Herausforderungen sich dabei stellen könnten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fiktive Schadensberechnung, Mängelgewährleistung, Baurecht, BGH-Rechtsprechung, Mangelfolgeschäden, objektive Minderung, Schadensersatz, Bauverträge, Rechtsentwicklung, Praxisrelevanz.
- Quote paper
- Fabian Kremers (Author), 2019, Fiktive Schadensberechnung von Mängelgewährleistungsrechten im Baurecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1336088