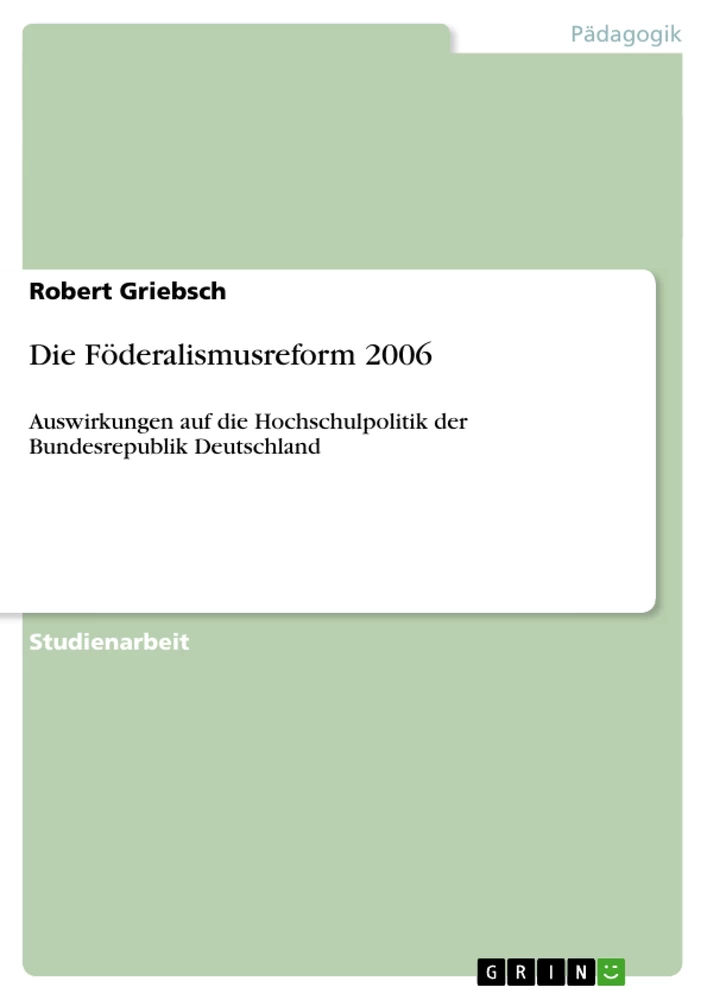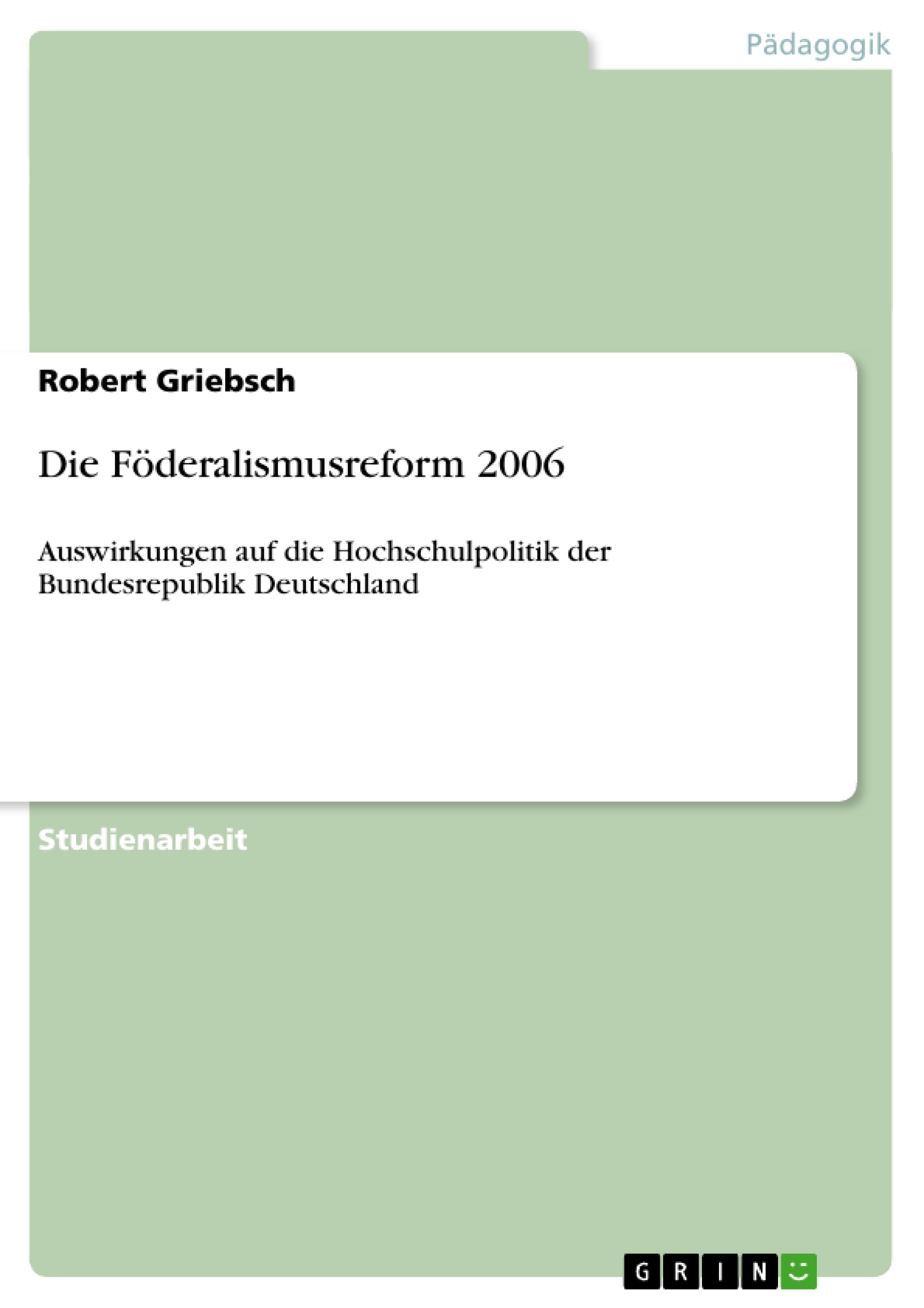Die am 1. September 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform ist die umfangreichste Grundgesetzänderung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland und regelt die Beziehungen zwischen Bund und Ländern im Bezug auf die Gesetzgebung neu. Der Durchbruch in der Föderalismuskommission scheiterte im Dezember des Jahres 2004 nicht zuletzt wegen der Differenzen bezüglich der Bildungspolitik (vgl. Sager 2007: 117). Fast alle Regelungen im Bildungsbereich wurden 1969 generiert, „um eine Bildungsexpansion zu ermöglichen“ (Lorenz 2007: 27). Nicht nur etliche Politikwissenschaftler, Soziologen oder die Industrie- und Handelskammern forderten, die Einheitlichkeit der Hochschulordnung zu bewahren (vgl. ebd.: 29),sondern auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Trotz aller Warnungen
und Bedenken wurde die Föderalismusreform samt der Änderungen für die Hochschulpolitik durchgeführt.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich deswegen mit den Warnungen und Bedenken auseinandersetzen und mich mit den Auswirkungen der Föderalismusreform auf die Hochschulpolitik befassen.
Ich werde thesenartig formulieren, warum die
Föderalismusreform meiner Ansicht nach die Probleme eher verschärft als das sie diese lösen würde.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Bildung und Bildungspolitik
3 Die Föderalismusreform
4 Föderalismusreform und Hochschulpolitik
5 Auswirkungen und Folgen – eine Bilanz
6 Quellen- und Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die am 1. September 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform ist die umfangreichste Grundgesetzänderung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland und regelt die Beziehungen zwischen Bund und Ländern im Bezug auf die Gesetzgebung neu. Die Notwendigkeit, diese Reform durchzusetzen, wird von Befürwortern unter anderem mit den langwierigen Prozessen bei der Entscheidung über neue Gesetze begründet. Hinzu käme die Tatsache, dass der Bundesrat von der jeweiligen Opposition als Blockademittel für neue, von der Regierung vorgelegte Gesetzesvorlagen missbraucht wurde (vgl. Behrens 2006; Wollenschläger 2007; Zenthöfer 2006).
Der Durchbruch in der Föderalismuskommission scheiterte im Dezember des Jahres 2004 nicht zuletzt wegen der Differenzen bezüglich der Bildungspolitik (vgl. Sager 2007: 117). Fast alle Regelungen im Bildungsbereich wurden 1969 generiert, „um eine Bildungsexpansion zu ermöglichen“ (Lorenz 2007: 27). Nicht nur etliche Politikwissenschaftler, Soziologen oder die Industrie- und Handelskammern forderten, die Einheitlichkeit der Hochschulordnung zu bewahren (vgl. ebd.: 29), sondern auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Trotz aller Warnungen und Bedenken wurde die Föderalismusreform samt der Änderungen für die Hochschulpolitik durchgeführt.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich deswegen mit den Warnungen und Bedenken auseinandersetzen und mich mit den Auswirkungen der Föderalismusreform auf die Hochschulpolitik befassen. Hierzu werde ich zunächst das Bildungssystem der Bundesrepublik Deutschland nach der Föderalismusreform 2006 skizzieren, um in einer Einführung den Stellenwert der Hochschulpolitik zu verdeutlichen. In einem zweiten Schritt möchte ich die Föderalismusreform knapp darstellen, um im darauf folgenden Artikel die genauen Reformen im Bezug auf die Hochschulpolitik beleuchten zu können. Allerdings wird bei der Vorstellung nicht auf jedes Detail eingegangen. Lediglich knapp soll die Föderalismusreform charakterisiert werden. Im letzten Kapitel werde ich dann versuchen, eine Bilanz zu ziehen und in diesem Zusammenhang neben dem Standpunkt der Forschungsliteratur meinen eigenen zu verdeutlichen. Ich werde thesenartig formulieren, warum die Föderalismusreform meiner Ansicht nach die Probleme eher verschärft als das sie diese lösen würde.
Interessant war dieses Thema für mich, da ich von der historischen Tragweite dieser Föderalismusreform sehr beeindruckt bin und diese kritisch reflektieren wollte. Die umfangreichste Grundgesetzänderung bringt natürlich viele Chancen mit sich, um Mechanismen, durch neue Möglichkeiten zu ersetzen. Allerdings verbirgt diese Reform auch Risiken, die es zu beleuchten gilt. Mich auf das Thema Hochschulpolitik zu spezialisieren, hat den einfachen Grund, dass genau dieses Feld auch Auswirkungen auf mich haben könnte.
Untersucht man die aktuelle Forschungsliteratur zu diesem Thema, so wird deutlich, dass die Kontroverse um die Vor- und Nachteile der Föderalismusreform extrem kritisch reflektiert wird (wenn man mal von Wollenschläger absieht).
Während Behrens (vgl. 2006: 35f.) und Zenthöfer (vgl. 2006: 106) für einen starken Wettbewerbsföderalismus plädieren, lehnt Lorenz die Föderalismusreform ab, da sie befürchtet, dass die Länder die Bildungsausgaben senken könnten, wenn sie Einsparungen vornehmen müssten. Ihrer Ansicht nach ist der Wettbewerbsföderalismus gar nicht möglich, da für einen Wettbewerb gleiche Voraussetzungen nötig seien (vgl. 2007: 30). Kemmler (vgl. 2007: 63) und Hofmann (vgl. 2007: 78) sehen die Föderalismusreform als notwendig an, um die Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern zu entflechten. Auch Hoff attestiert den Bundesländern Haushaltsnotlagen und sieht es ebenfalls als erwiesen an, dass am Bildungssektor gespart werden würde. Außerdem seien höchstens Ansätze einer Entflechtung zu registrieren (2007: 177ff.).
Meyer hingegen setzt sich für einen Kompromiss ein, der eine Förderung durch den Bund vorsieht, aber eine zu starke Verflechtung als unpassend ansieht. Hier seien noch Nachbesserungen nötig (vgl. 2008: 383). Konkrete Vorschläge macht hierzu Renzsch, der die Länder zur Schaffung von Studienplätzen animieren will, indem der Bund den Ländern Gelder zuweist, die studentengebunden in den jeweiligen Regelstudienzeiten zur Anwendung kommen sollen. Somit soll also die Studentenfinanzierung der Bund übernehmen (vgl. 2008: 67).
2 Bildung und Bildungspolitik
Um die Hochschulpolitik in den Bereich von Bildung bzw. Bildungspolitik einzuordnen, ist es meiner Meinung nach unumgänglich, den Begriff der Bildung zu definieren, um eine Arbeitsgrundlage zu haben.
Henning Kössler definiert den Begriff Bildung etwa wie folgt: „Bildung ist der Erwerb eines Systems moralisch erwünschter Einstellungen durch die Vermittlung und Aneignung von Wissen derart, dass Menschen im Bezugssystem ihrer geschichtlich-gesellschaftlichen Welt wählend, wertend und stellungnehmend ihren Standort definieren, Persönlichkeitsprofil bekommen und Lebens- und Handlungsorientierung gewinnen. Man kann stattdessen auch sagen, Bildung bewirke Identität [...]“ (Kössler 1989: 56).
Dieter Lenzen versteht unter Bildung all das, „[...] was der Mensch durch die Beschäftigung mit Sprache und Literatur, Wissenschaft und Kunst zu gewinnen vermag, durch die erarbeitende und aneignende Auseinandersetzung mit der Welt schlechthin“ (Lenzen 72005: 208).
Für Kössler und Lenzen ist Bildung demnach nicht nur mit dem Erwerb von Wissen durch bestimmte Lerninhalte aus den verschiedensten Fachgebieten verbunden. Die beiden Autoren schließen auch den Erwerb von Wissen, Fähigkeiten als auch Fertigkeiten in gesellschaftlicher Hinsicht mit ein. Kössler meint, dass die Bildung die Individualisierung begünstige, ja sogar erst ermögliche. Für Lenzen ist Bildung ein Prozess, der damit endet, dass die Person danach über Kenntnisse verfügt, die sie zu Beginn des Prozesses noch nicht hatte.
Festzuhalten ist also, dass Bildung nach Kössler existenziell für die Sozialisation eines Menschen ist. Darüber hinaus ist Bildung laut dem Autor die Voraussetzung für die vollständige Integration von Menschen in die Gesellschaft. Ich betone diesen Fakt so, da meiner Ansicht nach eine Bildungspolitik (Hochschulpolitik eingeschlossen), die Bundesländer benachteiligt, negative Auswirkungen auf die dortigen Bildungschancen und -erfolge hat. Dementsprechend wird auch die lokale Attraktivität (beispielsweise in Form des Wirtschaftsstandortes) negativ beeinflusst. Im Verlauf dieser Hausarbeit werde ich diese These präzisieren und belegen.
Das Bildungswesen ist seit der am 1. September 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform ausschließlich Ländersache und fällt daher in den Kompetenzbereich der Bundesländer (Artikel 70 GG). Bei der betrieblichen Berufsausbildung hat die BRD allerdings Gesetzgebungsbefugnis (Artikel 74 GG). Lediglich die Schulpflicht ist einheitlich geregelt: Nach dem „Abkommen zwischen den Ländern der Bundesrepublik zur Vereinheitlichung auf dem Gebiete des Schulwesens“ (1964, i.d.F.v. 14.10.1971) beginnt die Schulpflicht am 1. August des Jahres, in dem bis zum 30. Juni das 6. Lebensjahr vollendet wurde. Nach neun Schuljahren – diese Zeit entspricht einem Hauptschulabschluss – ist die Vollschulpflicht beendet. Die 1. bis 4. (in Berlin bis 6.) Klassenstufe in der Grundschule wird als Primarbereich, die 5. bis 9. (bzw. 10.) Klassenstufe wird als Sekundarstufe I und die Klassenstufe 11 und 12 (bzw. 13) wird als Sekundarstufe II bezeichnet. Der Abschluss der Sekundarstufe II kann als allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erfolgen. Die berufsbildenden Schulen, sowie die Berufsoberschulen und Berufskollegs sind als Sonderformen der schulischen Berufsbildung ebenfalls Teil der Sekundarstufe II. In den Sonderschulen werden die Kinder unterrichtet, denen eine, für sie notwendige Förderung, auf anderen Schulen nicht zukommen kann. Verbände oder kirchliche Einrichtungen verfügen über eigene Schulen (möglich durch Artikel 7 Abs. 4 und 5 GG). Der tertiäre Bildungsbereich umfasst Universitäten, Pädagogische-, Technische-, oder Kunsthochschulen. Der „zweite Bildungsweg“ umfasst Kollegs zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife, sowie Abendschulen zum Erwerb diverser Schulabschlüsse (vgl. Schubert & Klein 42006: 43f.).
Das Schulrecht ist Teil des öffentlichen Rechts und umfasst jene Verordnungen und Gesetze, die alle Aufgaben, die Finanzierung, die Organisation, sowie die Verwaltung von Schulen betreffen – darüber hinaus regelt das Schulrecht die Rechtsverhältnisse von Schülern, Eltern und Lehrern. Die BRD ist der Träger des öffentlichen Bildungswesens (Artikel 7 GG).
Um die Finanzierung des Bildungssystems erklären zu können, muss man zwischen der Zeit vor und nach der am 1. September 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform unterscheiden. Da die gesamten Bildungseinrichtungen vor der Föderalismusreform größtenteils in staatlicher Hand waren, erhielten sie auch die Gelder hauptsächlich aus den staatlichen Haushalten. Nach September 2006 wurde der Bildungsbereich aber ausschließlich Ländersache, somit ist auch die Finanzierung des Bildungswesens ausschließlich Ländersache. Bis 31.12.2019 wird der Bund allerdings noch Fördergelder nach einem bestimmten Prinzip zur Verfügung stellen, das ich noch vorstellen werde.
Wie erwähnt gehören Universitäten bzw. Hochschulen zum tertiären Bildungsbereich. Das Hochschulwesen ist somit Teil des Bildungswesens. Vor der Föderalismusreform 2006 existierte ein Hochschulrahmengesetz (nach Artikel 75 Abs. 1 Nr. 1a GG), das allgemeine Grundsätze zur Gestaltung des Hochschulwesens enthielt. Die Landeshochschulgesetze waren diesem Rahmen angepasst (vgl. Holtmann 32000: 250). Nach der Föderalismusreform wurde dieses Rahmengesetz allerdings gestrichen. Somit liegen also die Gestaltungsmöglichkeiten komplett bei den einzelnen Bundesländern. Hierbei bleibt die Frage bestehen, ob Föderalismus wirklich auf Kosten einer einheitlichen Bildungspolitik überbetont werden sollte. Ob man wirklich vor der Föderalismusreform von einer belasteten Länderautonomie im Bezug auf das Hochschulrahmengesetz (vgl. Zenthöfer 2006: 205) sprechen konnte, muss noch durch diese Arbeit untersucht werden.
[...]
- Quote paper
- Robert Griebsch (Author), 2008, Die Föderalismusreform 2006, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133613