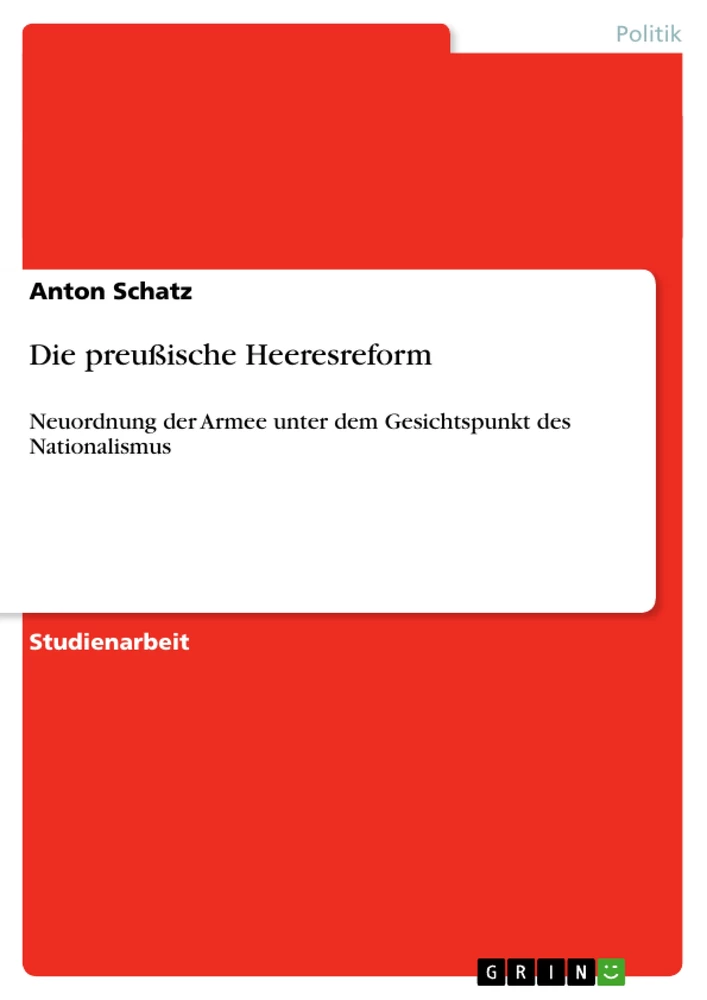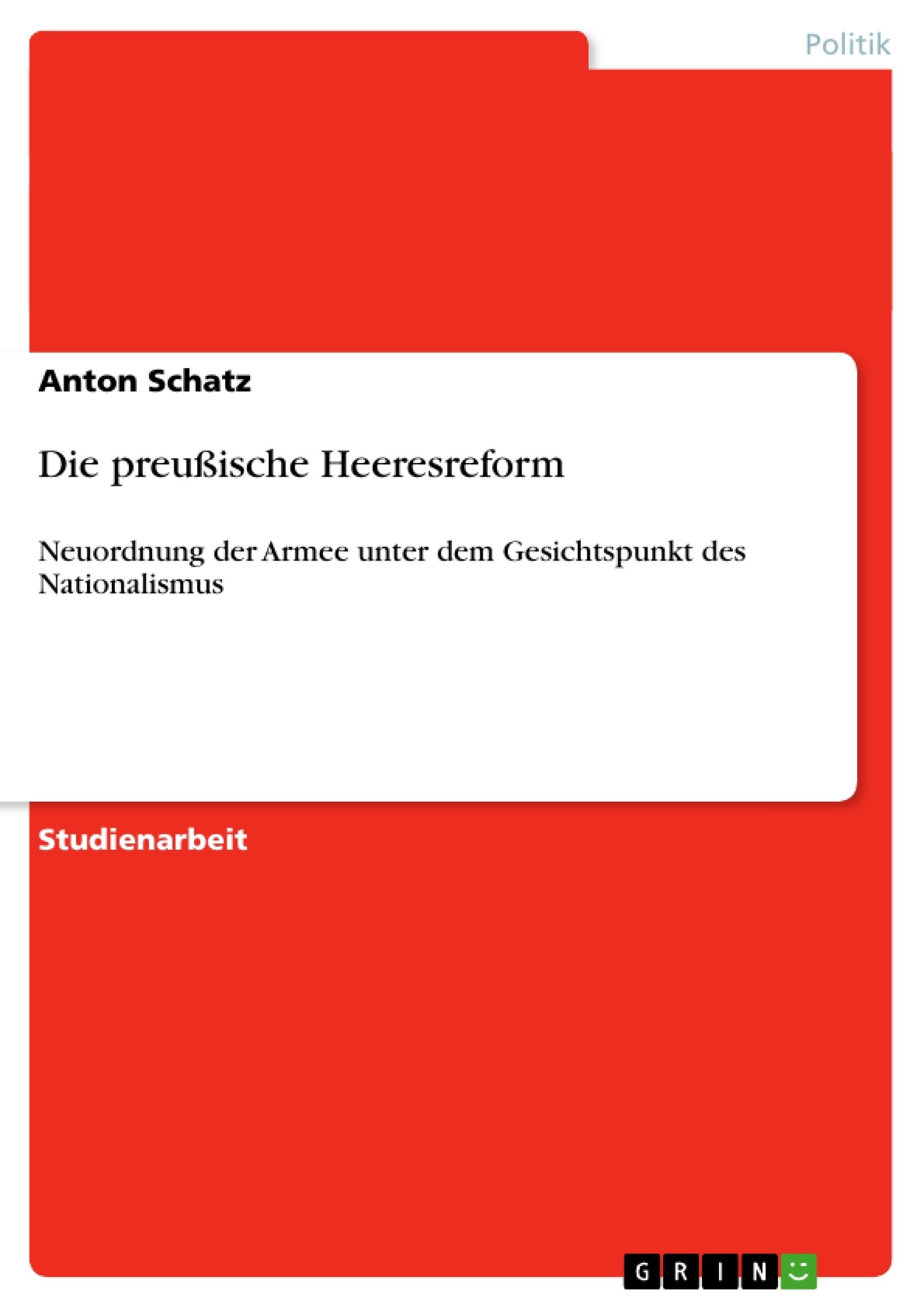Vielschichtiger Art waren die Beweggründe für die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht während der Reformen des preußischen Staatswesens. Einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss hatte unter anderem der Nationalismus auf die Väter dieser Neu- und Umgestaltungen.
Wie sich dieses nationalistische Gedankengut des beginnenden 19. Jahrhunderts auf die preußische Heeresreform ausgewirkt hat, soll im Folgenden dargelegt werden.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Hauptteil
2.1 Der Begriff: Nationalismus
2.2 Preußen vor 1806
2.3 Die preußische Heeresreform
2.3.1 Wandel des soldatischen Berufsverständnisses
2.3.2 Bestrebungen zur Verankerung im Nationalbewusstsein
2.4 Wirkung der Heeresreform
3. Ausblick
1. Einleitung
Im Jahr 2010 soll die Reform der Bundeswehr von einer rein zur Landesverteidigung befähigten Armee hin zu weltweit einsetzbaren und flexiblen Streitkräften vollzogen sein. Dies bedeutet nicht nur die Änderung der verteidigungspolitischen Richtlinien, sondern auch eine strikte Umstrukturierung von Ausrüstung und Ausbildung. Dass das vormals alles überragende Ziel der Bundeswehr, die Verteidigung des bundesdeutschen Territoriums, zusehend in den Hintergrund rückt, ist eine unmittelbare Folge jener Umgestaltung. Da wehrpflichtige Soldaten nicht in Auslandsmissionen der Bundesrepublik eingesetzt werden dürfen, scheint die im Grundgesetz verankerte und zur Tradition deutscher Streitkräfte gehörige allgemeine Wehrpflicht im Kontext der Neuausrichtung als überholtes und nahezu unnützes Relikt der weltpolitischen Lage des 19. und 20. Jahrhunderts. Manchem mag es daher nur gut und billig erscheinen für ihre Aussetzung oder gar Abschaffung einzutreten.
Käme es zu einer derartigen Entscheidung des Bundestages, bräche man mit der über 200-jährigen Geschichte der Wehrpflicht. Eben jener Institution, die zur Zeit der napoleonischen Besetzung weiter Teile Deutschlands in Preußen im Zuge der Heeresreform als große Neuerung des Heereswesens galt. Vielschichtiger Art waren die Beweggründe für die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht während der Reformen des preußischen Staatswesens. Einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss hatte unter anderem der Nationalismus auf die Väter dieser Neu- und Umgestaltungen.
Wie sich dieses nationalistische Gedankengut des beginnenden 19. Jahrhunderts auf die preußische Heeresreform ausgewirkt hat, soll im Folgenden dargelegt werden.
2. Hauptteil
2.1 Der Begriff: Nationalismus
Zunächst muss daher auf den dem heutigen Verständnis differenten Begriff des Nationalismus im Zeitgeist des frühen 19. Jahrhunderts eingegangen werden. Nationalismus zur Zeit der Befreiungskriege wurde gemeinhin als „progressiver Ausdruck für die Forderung des aufkommenden Bürgertums nach einer seiner ökonomischen Bedürfnissen entsprechenden Verkehrsform, dem Nationalstaat“[1] verstanden. Dieser Begriffsauffassung fehlt also noch das in späterer Zeit hinzugekommene übertriebene Selbstbewusstsein im Bezug auf die Wertschätzung der eigenen Nation.
2.2 Preußen vor 1806
Von einem real existierenden deutschen Nationalstaat kann jedoch in dem zu behandelnden Zeitraum noch keine Rede sein. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation war in dessen Endphase ein Zusammenschluss vieler weitestgehend souverän regierender Fürsten unter dem Mantel eines durch die Kurfürsten gewählten Kaisers. Preußen, das im 18. Jahrhundert zu dem neben Österreich mächtigsten Staat aufgestiegen war, befindet sich am Vorabend des vierten Koalitionskrieges 1806/07 in einer prekären staatsorganisatorischen wie militärischen Lage.
Als Beispiel für das Reformbedürfnis des preußischen Königreiches soll das Kabinettssystem dienen. Dieses sollte zwar dem König beratend zur Seite stehen und hatte daher auch großen Einfluss auf den Monarchen, bestand aber aus Adeligen, die zumeist nicht die nötige Sachkunde besaßen. Das Handeln einiger war zudem von persönlichen Vorbehalten, wie Vetternwirtschaft und Karrieredenken, geprägt.[2] Tiefgreifende und weitreichende Reformen des gesamten Staatswesens waren daher unumgänglich.
Auch im Bereich des Militärischen gab es gravierende Mängel. Taktisch wie strategisch operierte man nach den Führungsgrundsätzen der Armee zu Zeiten Friedrichs des Großen. Eine Umsetzung der Erfahrungen aus den vorhergehenden Koalitionskriegen hatte nicht stattgefunden. Das Offizierskorps rekrutierte sich fast ausschließlich aus Adeligen, die fachlich wie körperlich, zuhauf wegen fortgeschrittenem Alters, nicht mehr in der Lage waren eine Armee lagegerecht im Krieg zu führen.[3] Da Preußen sich dem zweiten und dritten Koalitionskrieg enthielt wurde auch der Militäretat gekürzt. Diese Maßnahme hatte gravierende Einschnitte zur Folge. So reduzierte man beispielsweise die Schießübungen der Truppe auf ein Minimum. Die Ausstattung der Soldaten mit modernen Waffen und zweckmäßigen Uniformen wurde fortwährend aufgeschoben. Eine Überarbeitung des veralteten Disziplinarwesens, welche noch die Prügelstrafe beinhaltete, wurde nicht vorgenommen.
[...]
[1] Motschmann, Jürgen / Fuchs-Heinritz, Werner: Nationalismus, in: Fuchs-Heinritz, Werner, u.a.: Lexikon zur Soziologie, Opladen 1995, S. 459.
[2] Vgl. Ranke, Leopold von: Preußische Geschichte III, Augsburg 1965, S. 30.
[3] Vgl. Kroener, Bernhard R.: Die Armeen Frankreichs und Preußens am Vorabend der Schlacht von Jena und Auerstedt, in: Opitz, Eckhardt (Hrsg.): Gerhard von Scharnhorst. Vom Wesen und Wirken der preußischen Heeresreform, Bremen 1998, S. 22f.
- Citar trabajo
- Anton Schatz (Autor), 2008, Die preußische Heeresreform, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133618