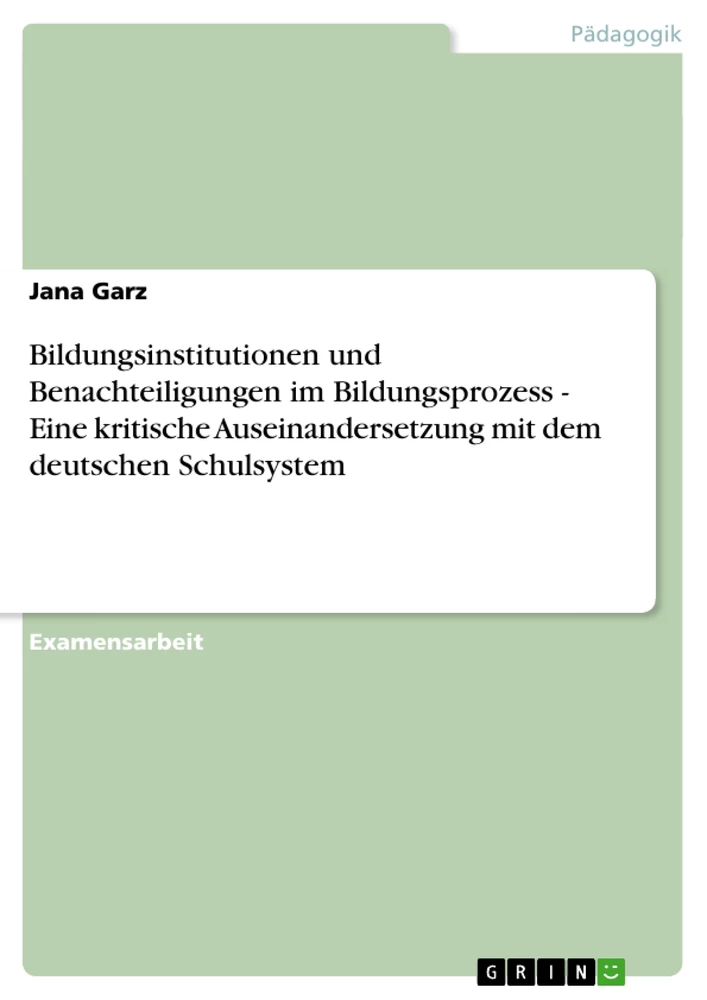In dieser Arbeit werden die Kritikpunkte unseres Schulsystem und ihre Auswirkungen anhand von Daten, Fakten und Theorien dargestellt. Es werden verschiedene Erklärungsansätze gegenübergestellt, um die Multikausalität von Benachteiligungen zu erörtern. Vorreiter wie Bordieu aber auch spätere Kritiker wie Esser und Fend werden durch PISA-Daten und Statistiken der Shell-Studie in ihren Annahmen bestätigt, dass nicht der Einzelne für seine Bildungsmisere verantwortlich ist, sondern das System. Letztlich wird versucht über den Tellerrand zu schauen und anhand anderer Länder politisch und pädagogisch versucht Lösungsansätze zu finden.
Inhalt
1 Einleitung
2 Das Deutsche Schulsystem
2.1 Historische Entwicklung von Bildungsungleichheiten
2.2 Skizzierung des derzeitigen deutschen Schulsystems
2.3 Gesellschaftliche und individuelle Funktionen des Schulsystems
3 Theoretische Erklärungsmodelle zu Bildungsungleichheiten bzw Bildungsbenachteiligungen
3.1 Forschungsansätze und Forschungslücken
3.2 Die schichtspezifische Sozialisationsforschung und die Theorie der kulturellen Reproduktion
3.3 Kritiken an Beitrag und Funktion der Schule nach Bourdieu
3.3.1 Soziale Disparitäten anhand von Bourdieu
3.4 Rational-choice-Theorien
3.5 Zur Theorie der institutionellen Diskriminierung
3.5.1 Institutionelle Effekte - Die Schule als Bildungsverteiler
3.6 Multikausalitäten von Bildungsungleichheiten
4 Bildungsbenachteiligungen an den Bildungsübergängen
4.1 Benachteiligungen durch die Zurückstellung von der Einschulung
4.2 Exkurs: zur Sprachfähigkeit als Auslesekriterium
4.3 Auswirkungen nach den Zurückstellungen
4.4 Die neue Schuleingangsphase - ein Versuch zur Förderung
4.5 Der Übergang von der Grundschule in die weiterführenden Schulen
4.5.1 Die Doppelfunktion der Grundschule
4.5.2 Die Übergangsentscheidung als Passungsproblem
4.5.3 Die Formen der Übergangsauslese
4.5.3.1 Diskussion der elterlichen Bildungsentscheidungen
4.5.3.2 Fragwürdigkeit der Leistungsbeurteilung als Kriterium der Grundschulempfehlung
4.5.3.3 Der Zusammenhang der sozialen Herkunft und der Leistungsbewertung
4.5.3.4 Aufnahmeprüfung und Tests
4.5.3.5 Die Probezeit
4.5.3.6. Ziele und Funktion der Orientierungsstufe
4.5.3.7 Die Orientierungsstufe heute
4.6 Der Eltern-Lehrer-Konflikt bei der Übergangsentscheidung
4.7 Das Problem des richtigen Bewertungsmaßstabs
4.8 Die prognostische Validität der Übertrittsempfehlungen
5 Benachteiligungen an der Sonderschule
5.1 Die Überweisung zur Sonderschule
5.2 Perspektiven und Wirksamkeit der Sonderschule
5.3 Pro und Kontra von Integration
6 Benachteiligungen an den weiterführenden Schulen
6.1 Qualitätsmerkmale und Legitimation des gegliederten Schulsystems
6.2 Die Verteilung auf die weiterführenden Schulen
6.3 Zusammenhänge von Leistungsdifferenzierung, sozialer Zusammensetzung und Leistungsentwicklung
6.3.1 Legitimation, Wertigkeit und Kernproblem der Hauptschule
6.3.2 Kompositionseffekte insbesondere an Hauptschulen
6.3.3 Der Einfluss von Kompositionseffekten bei Schülerschaften mit Migrationshintergrund
6.4 Ist die Gesamtschule der Rettungsanker?
6.4.1 Legitimation und Argumentation eines Gegenversuchs
6.4.2 Leistungsvergleich Gesamtschulen und Schulen des dreigliedrigen Systems
7 Psychologische Auswirkungen der Lernbedingungen
7.1 Selbstbewertungskonzepte zu schulischen Belastungen
7.2 Der Zusammenhang von sozialer Herkunft und Leistungsbewertung
7.3 Formen der Selbstbewertung durch schulische Bedingungen
7.4 Der Zusammenhang von Selbstbewertungen und Leistungsmotivation
7.5 Auswirkungen der negativen Selbstbewertung
8 Vergleich der Abschlüsse des deutschen Schulsystems
8.1 Abschlüsse in Abhängigkeit der sozialen Herkunft
8.2 Abschlüsse hinsichtlich des Migrantionshintergrunds
8.3 Zusammenhang von Schulform und Abschlüssen
9 Diskussion und Perspektiven unseres Schulsystems
10 Tabellenanhang
11 Literaturverzeichniss
Einleitung
Laut Grundgesetz darf in der Bundesrepublik Deutschland niemand aufgrund seiner Herkunft – womit die soziale Herkunft gemeint ist -, benachteiligt werden. Die Abhängigkeit der schulischen Leistungen und des Bildungserfolgs ist von der sozialen Herkunft im internationalen Vergleich der Schulsysteme unterschiedlich ausgeprägt. Es ist uneindeutig, welche spezifischen Merkmale der schulischen Systeme mit mehr oder weniger Selektivität einhergehen. Da die Entscheidung zwischen integrierten und gegliederten Systemen keineswegs ausreicht, um die Differenzen zu erläutern, müssen Faktoren auf der Ebene des Unterrichts, der einzelnen Schule, des Schulsystems und des gesellschaftlichen Kontexts insgesamt berücksichtigt werden.1 Eine demokratische Schule vereinnahmt nicht den ganzen Schüler2. Ob Arbeiterkind, Bauernkind oder Beamtenkind ist ersteinmal unerheblich. Die Schule kümmert sich vor allem um die Leistungen der Schüler. Damit ermöglicht sie auch die Entfaltung individueller Unterschiede in den Leistungsstärken zwischen den Kindern und fördert deren Individualität. Das gegenwärtige Sozialisationsmilieu an Gymnasien enthält durch die Pluralität der Sinnangebote große Chancen der reflexiven und eigenständigen Entwicklung der Persönlichkeit. Noch nie waren die Möglichkeiten, andere Standpunkte kennenzulernen, so groß. Die demokratische Autoritätsstruktur und die individualisierte Leistungskultur eröffnen Räume der Entfaltung von Individualität und der Entfaltung eigener Begabungsschwerpunkte. Trotzdem enthält jedes Erziehungs- und Sozialisationsmilieu auch Risiken und es gibt Gewinner und Verlierer.3
„Unterschiede der Bildung sind heute (…) zweifellos der wichtigste ständebildende Unterschied (…). Unterschiede der Bildung sind – man mag das noch so sehr bedauern – eine der allerstärksten rein innerlich wirkenden sozialen Schranken.“ 4
Bildungsbenachteiligung bedeutet, dass eine Gruppe von Kindern oder Jugendlichen im Schulsystem weniger Möglichkeiten haben, ein vorher festgelegtes Ziel zu erreichen, als andere. Beim Gebrauch dieses Begriffes geht es um die geringeren Chancen von Menschen mit weniger sozialen, finanziellen und kulturellen Ressourcen beim Erwerb von Bildung, die trotz formaler Chancengleichheit vorhanden ist. Der Begriff impliziert nicht vorsätzliche oder bewusste Diskriminierung, sondern relative, statistisch belegbare Nachteile dieser Gruppen bei der Verteilung von Bildungschancen und beim Erreichen von Bildungserfolgen. Mit Bildung und dem Ausbau des Bildungssystems war in der Vergangenheit häufig die Hoffnung verbunden, soziale Ungleichheiten abzubauen. Die kritische Prüfung, ob bestimmte Bevölkerungsgruppen im Bildungssystem systematisch benachteiligt sind, ist eine wichtige Fragestellung für die Wissenschaft in einem demokratischen Land. Sind solche Benachteiligungen nachweisbar, müssen sie so erklärt werden, dass sich erfolgversprechende Handlungskonzepte zu ihrer Überwindung entwickeln und verwirklichen lassen.5 Schon Fatke stellte 1967 fest, dass nicht das System kritisiert wird, sondern die Schüler, die darin nicht zurechtkommen. In meiner Examensarbeit werde ich mich folgenden Fragen widmen:
- Ob und inwieweit reproduziert das deutsche Schulsystem anhand seiner Institutionen Bildungsungleichheiten im Bildungsprozess?
- Wie wirkt sich die soziale Herkunft auf das Bestehen oder Nichtbestehen im Bildungsprozess aus?
- Welche Mechanismen wirken bei Bildungsungleichheiten zusammen und wie kann man sie verändern?
Dabei wird sich nur mit dem allgemein bildenden Schulsystem auseinandergesetzt, Berufsschulen sowie schulische Weiterbildungen oder sogar der zweite Bildungsweg werden nicht miteinbezogen. Zuerst befasse ich mich mit der historischen Entwicklung des deutschen Schulsystems und werde kurz darstellen, welche Strömungen zum jetzigen Schulsystem geführt haben und wie sich die immer wieder geforderte Chancengleichheit realisiert hat. Dazu wird das jetzige Schulsystem kurz skizziert.
Anhand von Helmut Fend lassen sich die gesellschaftlichen Funktionen des Schulsystems Reproduktionsfunktion, Enkulturationsfunktion, Qualifikationsfunktion, Allokationsfunktion aufzeigen und wie sie sich auf das Individuum auswirken.
Danach sollen verschiedene theoretische Modelle Erklärungen bieten, Bildungsungleichheiten bzw. Bildungsbenachteiligungen unter der Prämisse der sozialen Herkunft zu erklären. Die schichtspezifische Sozialisationsforschung, dargestellt von Hans-Günther Rolff, die Theorie der kulturellen Reproduktion durch Bourdieu und Passeron und die Rational-Choice-Theorien, die sich auf die Bildungsentschei-dungen der Eltern durch Boudon beziehen und später durch Hartmut Esser dargestellt, werden gegenübergestellt. Insbesondere bei der Benachteiligung von Migrantenkindern wird sich vorwiegend auf die Theorie der institutionellen Diskriminierung durch Mechthild Gomolla und Frank-Olaf Radtke bezogen, aber sie wird auch mit kulturalistischen Erklärungen von Heike Diefenbach oder Hartmut Esser verbunden. Wenn hier von Bildungsbenachteiligung gesprochen wird, geschieht das im Zusammenhang mit sozial schwachen Gruppen, z. B. durch Schüler mit Eltern aus der Arbeiterschicht oder aber auch durch Benachteiligungen von Schülern mit Migrationshintergrund6. Ich fasse die Gruppen in meiner Arbeit deshalb zusammen, da sich Ähnlichkeiten feststellen lassen und insbesondere bei Schülern mit Migrationshintergrund häufig auch sozial belastende Umstände zu finden sind. In der Forschung wurde immer wieder festgestellt, dass Bildungsbenachteiligungen vorwiegend an den Gelenkstellen von Bildungsprozessen auftreten. Deshalb werden der Übergang in die Schule, der Entscheidungsprozess von der Grundschule an die weiterführenden Schulen sowie die Überweisung an die Sonderschule auf benachteiligende Effekte untersucht. Beim Übergang von der Grundschule an die weiterführenden Schulen werden Konflikte zwischen Schule und Elternhaus sowie innere Konflikte der beiden Parteien aufgezeigt. Insbesondere die Empfehlungen der Lehrkräfte werden auf ihre Validität überprüft. Hierbei wird die Leistungsbewertung diskutiert und dass aufgrund schlechter Leistungen ein häufig ungewollter Schultyp folgt. Die weiterführenden Schulen, des dreigliedrigen Schulsystems werden auf benachteiligende Aspekte hin betrachtet. Hierbei wird immer wieder untersucht, inwieweit die Schule diskriminiert bzw. welche Mechanismen zu sozial bedingten Übergangsraten führen. Problematisiert wird in diesem Zusammenhang auch die Legitimation von Hauptschule und Gesamtschule, die jeweils unterschiedliche Probleme bewältigen müssen.
Auf den weiterführenden Schulen kommt es zu unterschiedlichen Leistungsdifferenzierungen, was leistungshomogene Gruppen in den Hauptschulen und leistungsheterogenere Gruppen auf den Gymnasien entstehen lässt. Dies führt wiederum zu unterschiedlichen Schülerkompositionen auf den Schulen. Untersucht wird hierbei, ob die Zusammensetzung einen Einfluss auf Leistungen und auch auf psychische Befindlichkeiten hat. Hierbei wird immer wieder der Nachteil der Schüler unterer Schichten herausgearbeitet. Es kommt schließlich bei ungünstiger Schülerzusammensetzung zur Konzentration von bildungsschwachen und sozial schwachen Kindern und Jugendlichen, insbesondere auf Hauptschulen. Dies führt dann bei den Einzelnen zu schlechten Selbstbewertungsprozessen, was letztlich wieder das Lernen und die Erfolge in der Schule beeinträchtigt. Solga und Wagner gehen davon aus, dass die Schülerzusammensetzung der bedeutendste Faktor für die Leistungsentwicklung sei.
Die Gesamtschule wird als Gegenversuch zum übrigen Schulsystem debattiert und ein Vergleich mit den Leistungen ihrer Schülerschaft mit der Schülerschaft der übrigen Schultypen soll Aufschluss über ihre Wirksamkeit geben. Letztlich soll anhand der Schulabschlüsse der Zusammenhang zur sozialen Herkunft, zum Migrationshintergrund und der Schulform aufzeigen, wie und an wen unser Schulsystem die unterschiedlichen Zertifikate verteilt. In der Diskussion werden die gewonnenen Ergebnisse miteinander abgewogen und mit Hilfe anderer Schulsysteme werden Verbes-serungen und Perspektiven überlegt sowie der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang erläutert.
2 Das Deutsche Schulsystem
2.1 Historische Entwicklung von Bildungsungleichheiten
Soziale Ungleichheit ist in der Bildungsgeschichte schon in der Neuzeit zu einer Herausforderung für Pädagogen geworden. Als nach der Reformationszeit Bildung zu einem allgemeinen Bedürfnis mit einem nützlichen Zweck wurde, und zwar die Bibel in der Muttersprache zu lesen, und daher die obligatorische allgemeine Schulbildung entstand, verknüpfte sie sich mit dem hierarchischen Standesgefüge. Das niedere Schulwesen wurde grundsätzlich getrennt vom höheren aufgebaut, denn die allgemeine Schulpflicht enthielt ein integrierendes Element, das bestehende Abgrenzungen zu minimieren drohte. Wegen der Furcht, die Kinder könnten durch den Unterricht auf innovative Gedanken kommen, waren die Obrigkeiten stets bemüht, die seit dem 17. Jahrhundert entstehende Unterrichtspflicht beim Großteil des Volkes auf Elementarkenntnisse im Dienst von Religions- und Untertanenerziehung zu belassen.7 Die protestantische Barockpädagogik protestierte gegen die Segmentierung besonders durch den bedeutenden Didaktiker Johann Amos Comenius. In seinem Arsenal findet man bereits pädagogische und gesellschaftliche Argumente gegen die frühe Trennung der Schüler und für eine gemeinsame Pädagogik. Aber auch die Aufklärung und die dazugehörige Französische Revolution stellten die Standesordnung nicht nur gesellschaftlich, sondern auch pädagogisch in Frage. Erstmals wurden in einem europäischen Nationalstaat die Menschenrechte zur Grundlage einer Verfassung, die ein für alle Bürger gemeinsames, kostenloses öffentliches Schulwesen errichtete.8 Seitdem die Philosophie der Aufklärung ihren Niederschlag in den Grundrechten der Verfassungen demokratischer Staaten fand, ist der Widerspruch zwischen dem normativen Anspruch auf Gleichheit (Art. 3 Abs. 3 GG) und der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Ungleichheit erkennbar.9 Als Sprecher des Schulausschusses der Legislative begründete der Pädagoge Concordet das Prinzip des erstrebten Bildungssystems: Chancengleichheit als Voraussetzung bürgerlicher Freiheit und staatsbürgerlicher Verpflichtung. Obwohl in den deutschen Ländern reformpädagogische Ansätze die Gleichgültigkeit des öffentlichen Bildungswesens gegenüber sozialer Ungleichheit kritisierten, ermöglichte erst die Revolution von 1918 den Beginn einer grundlegenden Bildungsreform.10 In den neuen republikanischen Verfassungen im Reich und den Ländern wurde ein gleiches Bildungsangebot als Bürgerrecht erachtet. Dabei bestimmte die Reichsverfassung, dass es beim Aufbau des öffentlichen Schulwesens eine für alle gemeinsame Grundschule geben sollte. Es sei für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule nur seine Anlage und Neigung, nicht aber die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis seiner Eltern maßgeblich. Abgeschafft wurde die Vorschule, der dreijährige Sonderweg zum Gymnasium für Oberschichtkinder. Dennoch blieb die soziale Distanz der weiterführenden Schulen (Gymnasien) gegenüber der Volksschule und bei deren konfessioneller Spaltung in Bekenntnisschulen, also bei der Benachteiligung der handarbeitenden Bevölkerung besonders auf dem Lande. In der Weimarer Verfassung wurde die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen gefördert, aber nicht die Koedukation. Demnach wurde die Trennung der Geschlechter im Schulwesen, wie die nach Konfessionen weiter ausgebaut. Was in einzelnen Ländern in der Lehrerausbildung verbessert wurde, ebnete die begrenzende Bildungspolitik des nationalsozialistischen Regimes wieder ein. Es gab dabei nicht nur Beschränkungen wegen der Rassenpolitik, sondern auch bei höherer Schulbildung zu Lasten der Mädchen, der Kinder der unteren Sozialschichten und der auf dem Lande. Umso bedeutender war nach dem totalen Zusammenbruch der grundsätzliche Neubeginn. Dieser wurde im Widerstreit zwischen konfessioneller Bekenntnisschule und republikanischer Einheitsschule versäumt. Unter der Kulturhoheit der Länder ließen die regionalen Kräfte eine mannigfaltige Bildungslandschaft entstehen, deren fehlende Einheitlichkeit bald kritisiert wurde. Dabei wurde aber nicht die Ungleichheit der Lebenschancen in den einzelnen Regionen zum Kritikpunkt. Man orientierte sich mehr am Berechtigungswesen als an der Pädagogik und hatte es auf die Kontinuität der Gymnasien und die Anerkennung der Abiturzeugnisse abgesehen.11
Nach dem Zweiten Weltkrieg forderten die drei westlichen Alliierten 1945 zwar eine Demokratisierung des Bildungswesens, akzeptierten aber vor dem Hintergrund der Ost-West-Auseinandersetzungen, dass das traditionelle und sozial selektive dreigliedrige Schulsystem mit Volksschule, Mittelschule und Gymnasium wiederhergestellt wurde. Vor dem Hintergrund der überkommenen föderalen Strukturen des Kaiserreichs und der Weimarer Republik wurde nach Verabschiedung des Grundgesetzes im Mai 1949 die Bundesrepublik Deutschland als demokratischer Bundesstaat mit den späteren zehn Ländern und Westberlin gegründet. Zu den föderativen Prinzipien der rechtsstaatlichen Verfassungsordnung gehört seitdem die Kulturhoheit der Länder. Diese spricht den einzelnen Ländern aufgrund ihrer Eigenstaatlichkeit zum einen die überwiegende Zuständigkeit für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu und verbindet sie zum anderen mit der Mitverantwortung für das Staatsganze der Bundesrepublik. Diese Mitverantwortung kommt seit 1949 durch die gegründete Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) in deren Koordinationsaufgaben zum Tragen.12 1955 wurde das Bildungssystem von den Landesregierungen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht und die überkommenen Strukturen und Standards wurden restaurativ festgelegt. Weder den Problemen der Bildungsexpansion noch dem Verlangen nach mehr Bildungsgerechtigkeit kam man damit entgegen.13 Bildungsexpansion meint die Ausweitung und Ausdifferenzierung der Bildungseinrichtungen sowie die Vermehrung der Bildungsinhalte, der Bildungsdauer und der Anzahl der Gebildeten. Die Bildungsexpansion bezeichnet das Phänomen, dass von jüngeren Generationen mehr Menschen eine (höhere) Bildung erhalten als deren Eltern. Es ist in Mitteleuropa seit dem 17. Jahrhundert zu beobachten und heutzutage in praktisch allen Entwicklungs- und Schwellenländern.14 Auf der wissenschaftlichen Ebene hat sich der französische Soziologe Pierre Bourdieu mit dem Phänomen der Bildungsexpansion beschäftigt. In den 1960er Jahren schließlich besuchten in der Bundesrepublik Deutschland, anders als in der DDR, achtzig Prozent der Heranwachsenden lediglich die Volksschule. Damit blieben viele Begabungsreserven ungenutzt. Mit Hilfe der beruflichen Ausbildung und nach betrieblichem Bedarf konnten vereinzelt höhere Bildungsabschlüsse durch den zweiten Bildungsweg nachgeholt werden, während andere mit originären Bildungspatenten vor ihnen einstiegen. Deshalb kam es zu der damals häufigen Verengung des Begriffs der Chancengleichheit auf den Zugang zu höherer Bildung für die besonders Begabten, anstatt unter Bildungsgerechtigkeit die individuelle Förderung jeder Begabung anzuerkennen.15 Dabei haben die sozialwissenschaftliche und die pädagogische Forschung eine wichtige Rolle gespielt. Engagierte Erziehungswissenschaftler wie Herwig Blankertz, Andreas Filtner, Hartmut von Hentig, Wolfgang Klafki erhoben ihre Stimme für eine realistische Wende in der Pädagogik. Der Begabungsbegriff rückte in den Kern der fachwissenschaftlichen Diskussion mit wesentlichen bildungspolitischen Konsequenzen. Der Herausforderung, die soziale Ungleichheit für die Pädagogik darstellt, wurde im öffentlichen Bildungswesen begegnet.16 Der Vereinheitlichung im allgemein bildenden Schulsystem dienten 1955 das Düsseldorfer Abkommen und seine Neufassung 1964 im Hamburger Abkommen und die Fassung von 1971 mit den vereinheitlichten Schulartbezeichnungen: Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Sonderschule. Legitimiert wurde diese aus dem Kaiserreich entstandene Gliederung bis in die 1960er Jahre mit den sozialen Schicht- und Qualifikationsprofilen, welche den praktischen (Hauptschule), praktisch-theoretischen (Realschule) und theoretischen (Gymnasium) Begabungstypen entsprechen.17 Während des anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwungs mit dauernder Nachfrage nach Arbeitskräften gelangte die Bundesrepublik in den sechziger Jahren angesichts der internationalen Bildungsexpansion unter dem Andrang starker Geburtsjahrgänge in eine Zwangslage, welche in der öffentlichen Diskussion als deutsche Bildungskatastrophe bezeichnet wurde und zu einem in der deutschen Bildungsgeschichte beispiellosen Reformschub führte. Das Modernisierungspostulat, verbesserte Leistungsfähigkeit und vermehrte Begabungsförderung anstrebend, konnte mit dem Bürgerrecht auf Bildung, mit der Forderung nach Chancengleichheit und Demokratisierung im Bildungswesen verbunden werden.18 Die Bedarfsstellung der Kultusministerkonferenz 1961-1970 bot die Grundlage für Reformen im Schul- und Hochschulwesen. Anregungen kamen vom Bremer Plan (1960), vom Deutschen Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen (1953-1965) und vom Deutschen Bildungsrat (1965-1975), der hierzu 1970 seinen Strukturplan für das Bildungswesen vorlegte. Die im Strukturplan vorgesehene horizontale Gliederung des Bildungssystems führte zur bildungspolitisch kontrovers geführten Diskussion über die Neugestaltung der Übergänge zwischen Elementarbereich (Kindergaten/Vorklasse) Primar- und Sekundarbereich (schulformabhängige oder schulformunabhängige Orientierungsstufe) sowie über die Einführung von Gesamtschulen. Während die CDU/CSU am dreigliedrigen Schulsystem festhielt, forderte die SPD eine Gesamtschule als gemeinsame Jugendschule der Zukunft. Bildungsreform für sich kann jedoch keine ökonomische und soziale Chancengleichheit herstellen, geschweige denn eine Bildungsexpansion. Die enorme Zunahme der Besucher und Besucherinnen weiterführender Schulen und Hochschulen in den letzten Jahrzehnten ist vermehrt als Erfolg durchgesetzter Chancengleichheit verstanden worden.19
Meulemann (1985) und Geißler (1999) gehen davon aus, dass eine Konstanz der herkunftsbedingten Bildungsungleichheiten geblieben ist. Demnach haben sich lediglich geringfügige Verschiebungen bei den herkunftsbedingten Bildungschancen ergeben. Trotzdem zeigen Henz und Maas (1995) an Mikrozensusdaten mit Verlaufsdaten ausgewählter Geburtskohorten, dass sich im Zuge der Bildungsreformen und Bildungsexpansion vor allem die Benachteiligung von Arbeiterkindern verringert haben soll. Allerdings fand nur für den Besuch der Realschule eine Angleichung der Bildungschancen von Arbeiter- und Beamtenkindern statt, während für den Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium weiterhin eine Chancenungleichheit nach der sozialen Herkunft besteht. Während 1965 Beamtenkinder eine 18-mal bessere Chance hatten, als Arbeiterkinder ein Gymnasium zu besuchen, ist dies 1989 immerhin noch eine 11-fache Chance. Nicht zuletzt hat die PISA-Studie gezeigt, dass die Bildungschancen signifikant vom sozialen Status des Elternhauses abhängen. Ebenfalls der Erwerb von Basiskompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften und der schulische Lernerfolg hängen maßgeblich von der sozialen Herkunft ab. Während die deutschen Schülerinnen und Schüler aus der oberen Dienstklasse einen mittleren Platz im internationalen Vergleich einnehmen, ist das Leseniveau der Arbeiterkinder im nationalen und internationalen Vergleich auffallend niedrig.20 Auch die häufig verwendete Metapher des Fahrstuhleffekts von Beck, dass alle eine Etage höher gefahren sind, ist nicht nur irreführend, sondern nach Rodax empirisch falsch. Nicht alle Sozialschichten konnten in Bezug auf die Bildung in den Fahrstuhl einsteigen und eine oder mehr Etagen nach oben fahren. Gerade Kinder sozial schwacher Familien, „Kellerkinder der Bildungsexpansion“, sind, um bei der bildhaften Sprache zu bleiben, erst gar nicht in den Fahrstuhl gelangt.21 Heute hat nur ein sehr kleiner Teil der Arbeiterkinder (insbesondere auch Migrantenkinder) Zugang zu einem Gymnasium, im Gegensatz zu Kindern des neuen Mittelstandes und fast allen Kindern höherer Beamtenfamilien. Demnach ist die Chance der begabten katholischen Tochter vom Lande gestiegen, mehr als eine Dorfschule zu besuchen, um mit dieser politischen Symbolfigur an jene Reformjahre zu erinnern. An ihre Stelle ist nun die Tochter einer allein erziehenden Arbeitsimmigrantin getreten. Die derzeitige multikulturelle Gesellschaft erfordert nach Prengel eine Pädagogik der Vielfalt, deren Vermittlung besondere Anforderungen an die öffentlichen Bildungsinstitutionen stellt. Dabei geht es um die wechselseitige Achtung jeder Person in ihrer individuellen Lebenslage. Insbesondere bei Migranten kann lediglich politische Akkulturation22 gefordert werden. Dabei sollte die Bereitschaft gezeigt werden, sich auf die politische Kultur der neuen Heimat einzulassen, ohne die kulturelle Lebensform ihrer Herkunft aufzugeben.23 Dabei muss die Spannung zwischen politischer Integration und kultureller Differenz für eine Pädagogik der Vielfalt stehen, sofern sie sich an einem erziehungswissenschaftlichen Konzept demokratischer Staatsbürger orientiert. Das Schulsystem liegt laut Artikel 7 des Grundgesetzes im Verantwortungsbereich des Staates. Im Artikel 3 § 3 wird die Gleichheit vor dem Gesetz postuliert:
„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“24
Um dem entgegenzuwirken muss eine Chancengleichheit im Schulsystem vorhanden sein. Eine Chancengleichheit im Sinne des Modells der statistischen Unabhängigkeit hieße, dass jedes Schulkind unabhängig von seiner sozialen Herkunft die gleichen Startbedingungen im Bildungssystem haben soll. Das Postulat der Chancengleichheit impliziere nach Müller und Mayer (1976) nicht die formale Chancengleichheit, nach der Bildungserfolge von den individuellen Fähigkeiten, Anstrengungen, Leistungen und Motivationen abhängen sollen. Da diese nämlich nicht unabhängig von der sozioökonomischen Lage des Elternhauses sind, würde eine formale Chancengleichheit einen hohen Grad an Chancenungleichheit zwischen den sozialen Schichten und eine dauerhafte Festschreibung bedeuten. Die Herstellung formaler Chancengleichheiten dürfte immerhin zu mehr Bildungschancen und höheren Bildungsbeteiligungen führen. Weil der Bildungserfolg über die im Lernprozess erworbenen Leistungen im Bildungssystem verteilt wird und die schulische Performanz als Voraussetzung von der sozialen Herkunft abhängt, dürfte die Herstellung von Chancengleichheit so lange Utopie bleiben, wie die Startchancen (die Voraussetzungen für den Bildungserfolg) auch an die soziale Herkunft der Schulkinder geknüpft sind.25
2.2 Skizzierung des derzeitigen deutschen Schulsystems
Kennzeichnend für den Aufbau des derzeitigen deutschen Schulsystems als Teilbereich des Bildungswesens ist zum einen die vertikale Gliederung nach Schularten und zum anderen die horizontale Struktur der aufeinander aufbauenden Schulstufen. Dazu gehören der Primarbereich (Grundschule) und der Sekundarbereich I und II (Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und das Gymnasium sowie in den einzelnen Bundesländern verschiedene integrierte Formen), die durch grundlegende schulpolitische Entscheidungen festgelegt sind. Aufgrund der Kulturhoheit der Länder enthalten die Schulgesetze der einzelnen Bundesländer unterschiedliche Aussagen zum Aufbau und zur Gliederung des Schulwesens. Unterschiedliche Regelungen gibt es zur Dauer der Grundschule, die - außer in Berlin und Brandenburg sechsjährig mit integrierter Orientierungsstufe - in allen anderen Bundesländern vierjährig ist. Differenzen existieren außerdem hinsichtlich der Gesamtschule, Regelschule oder Angebotsschule, zur Einrichtung selbstständiger Stufenschulen und zur Lehrerbildung. In allen Ländern gibt es außerdem die Sonderschule, Schule für Behinderte oder Förderschule.26 Unmittelbar fällt ins Auge, dass wir es im Anschluss an die Grundschule mit einem mehrgliedrigen Schulsystem zu tun haben. Landläufig wird es immer noch als dreigliedrig bezeichnet. Nimmt man neben Hauptschule, Realschule und Gymnasium die Gesamtschule dazu, müsste man von Viergliedrigkeit sprechen und mit Zunahme der Sonderschule sogar von Fünfgliedrigkeit.27
2.3 Gesellschaftliche und individuelle Funktionen des Schulsystems Die Schule, abgeleitet vom griechischen autonomia, meint Eigengesetzlichkeit, Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und Selbstverwaltung. Nach Artikel 7 Absatz 1 des Grundgesetzes steht das Schulwesen unter Aufsicht des Staates und die einzelne Schule besitzt keine absolute Autonomie. Mit dem Begriff Schule kann es deshalb immer nur um die Erweiterung bisheriger Verantwortung, Selbstständigkeit, Selbstverwaltung und Gestaltungsfreiheit der Einzelschule im Rahmen von verfassungsrechtlichen und schulgesetzlichen Bestimmungen gehen.28Im Schulsystem ist die Reproduktion kultureller Sinnsysteme institutionalisiert. Sie reicht von der Beherrschung grundlegender Symbolsysteme bis zur Internalisierung grundlegender Wertorientierungen. Diese Reproduktionsfunktion wird als Enkulturationsfunktion bezeichnet. Dabei bezieht sie sich auf die Reproduktion grundlegender kultureller Fertigkeiten und Verständnisformen der Welt und der Person. Ein Blick in die Geschichte der Schule zeigt, dass die Beziehung zwischen Kultur, insbesondere in Form der Religion, der Schriftlichkeit, und dem Bildungswesen immer zentral war. Durch diese Kulturinitiation werden Kinder in ihrer eigenen Kultur heimisch und bleiben keine Fremden im eigenen symbolischen Umfeld. Mit der Qualifikationsfunktion soll die Vermittlung von Fertigkeiten und Kenntnissen verstanden werden, die zur Ausübung konkreter Arbeit erforderlich ist. Im Mittelpunkt steht der Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Wissen und Fertigkeiten in einer Kultur und ihrer Überlieferung und Einübung in Bildungseinrichtungen. Dabei haben Qualifikationen die Funktion der Aufrechterhaltung und Verbesserung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit. Die Allokationsfunktion des Bildungswesens bezieht sich direkt auf die Sozialstruktur einer Gesellschaft. Unter Sozialstruktur wird die soziale Gliederung einer Gesellschaft nach Bildung, Einkommen, Kultur und sozialen Verkehrsformen verstanden. Für die Zuordnung des Bildungswesens zur gesellschaftlichen Arbeitsteilung ist das Verteilungssystem bedeutend, das unterschiedliche Qualifikationen erfordert. Dadurch verschafft das Bildungswesen über das Prüfungswesen Zuordnungen zwischen den Leistungen der Schüler und ihren Laufbahnen. Wie die empirische Forschung bestätigt, korreliert dieser Prozess mit der sozialen Herkunft des Elternhauses, so dass trotz Offenheit der Bildungswege auch hier Reproduktionsformen der älteren Generation in der jüngeren zum Ausdruck kommen. Die Aufgabe, die Verteilungen auf zukünftige Berufe und Berufslaufbahnen vorzunehmen, wird als Allokationsfunktion bezeichnet. Fend spricht deshalb nicht von Selektion, da nicht die Ausschließung aus erwünschten Bildungslaufbahnen im Vordergrund stehen kann, sondern eine legitimierbare Allokation von Personen mit bestimmten Qualifikationen zu Aufgaben mit bestimmten Anforderungen.29 Schulsysteme sind Instrumente der gesellschaftlichen Integration. In ihnen ist auch die Reproduktion von solchen Normen und Werten institutionalisiert, die zur Stabilisierung politischer Verhältnisse dienen.
„Im Rahmen des Bildungswesens wird einmal die Schaffung einer kulturellen und sozialen Identität ermöglicht, die die innere Kohäsion einer Gesellschaft mitbestimmt, und zum anderen besteht der Beitrag des Bildungssystems in der Schaffung von Zustimmung zum politischen Regelsystem und in der Stärkung des Vertrauens in seine Träger.“30
Helmut Fend beschreibt auch die Perspektive von unten, um die Sichtweise der betroffenen Schüler und Eltern mit Blick auf die Gelegenheitsstrukturen und Regelsysteme, die die Schulsysteme für die individuellen Lebensläufe bieten, darzustellen. Die Enkulturationsfunktion bietet die Möglichkeit, Autonomie im Handeln und Denken einer Person zu stärken. Die Qualifikationsfunktion bietet die Option, Wissen und Fähigkeiten zu erwerben, die eine selbstständige berufliche Lebensführung ermöglichen. Damit bietet das Bildungswesen die institutionelle Gelegenheitsstruktur zur Entwicklung der individuellen Leistungspotenziale. Die Allokationsfunktion korrespondiert mit der Chance, den beruflichen Aufstieg und die berufliche Stellung durch eigene Lernanstrengungen und schulische Leistungen zu verwirklichen. Dabei wird das Bildungswesen zur Umgebung der Planung individueller Bildungs- und Berufsbiografien, es wird zur Schaltstelle der Lebensplanung. Der Integrationsfunktion entspricht die Chance der Begegnung mit den kulturellen Traditionen eines Gemeinwesens. Dadurch werden soziale Identitätsbildung, Identifikation und soziale Bindung als Basis für soziale Verantwortung ermöglicht. In der Summe wird sichtbar, welches Potenzial das Bildungswesen für die Stärkung der Heranwachsenden enthält, das jedoch nicht allen in gleicher Weise zugänglich ist.31
3 Theoretische Erklärungsmodelle zu Bildungsungleichheiten bzw. Bildungsbenachteiligungen
3.1 Forschungsansätze und Forschungslücken
Die PISA-Studie zeigt deutlich, dass die Möglichkeit eines Facharbeiterkindes, ein Gymnasium statt eine Realschule zu besuchen, auch bei Kontrolle der Lesekompetenz noch dreimal geringer ist als die eines Kindes aus der oberen Dienstklasse. Der allgemein gut belegte Befund, dass sich die sozialen Bildungsungleichheiten trotz Bildungsexpansion in den vergangenen Jahrzehnten als weiterhin stabil erwiesen haben, widerspricht eindeutig den modernisierungstheoretischen Annahmen einer zunehmenden sozialen Offenheit und leistungsgerechten Verteilung von Bildungsabschlüssen. Damit wird eine ungleichheitsreproduzierende Funktion der Schule deutlich, die über die einfache Reproduktion des Status quo, also über die Übersetzung ungleicher familiärer Voraussetzungen in ungleiche schulische Erfolgschancen, hinausgeht.32
Es stellt sich die Frage, inwieweit die Schule aktiv zu dieser sozialen Benachteiligung beiträgt?
Wenn Kinder unterer Schichten nicht die Bildungserfolge erzielen, die sie nach kognitiver Kompetenz und schulischer Leistung eigentlich erreichen müssten, so kann dies einerseits daran liegen, dass die Schule ihnen nicht die Möglichkeit bietet, oder aber, dass sie sich selbst dabei im Wege stehen und aus mehr oder minder bewusster Entscheidung auf eine höhere Schullaufbahn verzichten. Die Frage nach den Mechanismen der Reproduktion sozialer Bildungsungleichheiten, die auf die Mikro- und Mesoebene33 schulischer Bildungsprozesse abzielt, wird in der Forschung durchaus kontrovers diskutiert. Die einflussreichsten Erklärungsansätze sind zum einen die schichtspezifische Sozialisationsforschung und die Theorien der kulturellen Reproduktion und zum anderen die rational-choice-orientierten Ansätze der rationalen Bildungsentscheidungen. Beide Forschungsrichtungen unterscheiden sich in der Art, wie der Einfluss der institutionellen Dimension modelliert wird.34
Im Zusammenhang mit der Frage, worauf die besondere Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem zurückzuführen ist werden kulturalistischen Erklärungen und die Theorie der institutionellen Diskriminierung verwendet. Die kulturalistischen Erklärungen beziehen sich auf traditionelle Wert- und Deutungsmuster, wie etwa eine traditionelle Familienorientierung, die einer erfolgreichen Bildungslaufbahn von Zuwanderern entgegenstehen können (Leenen oder Grosch 1990). Unter dieser Anschauung lassen sich Ansätze formulieren, die das Ausmaß der kulturellen Orientierung von Zuwanderern an der Herkunftsgesellschaft einerseits und an der Aufnahmegesellschaft andererseits in den Blick nehmen (Esser 2001). Diese werden in empirischen Analysen anhand der in der Familie gesprochenen Sprache, der Essgewohnheiten, der ethnischen Zusammensetzung des Freundeskreises oder der bevorzugten Musik oder Zeitungslektüre operationalisiert (Müller 1994 oder Diefenbach 2002) . Erklärungen durch die Effekte des Bildungssystems beziehen sich auf Merkmale von Bildungsinstitutionen, die nachteilige Wirkungen für Schüler mit Migrationshintergrund haben. In diese Kategorie fallen Ansätze, die den schulischen Misserfolg von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund auf Mechanismen direkter oder indirekter institutioneller Diskriminierung zurückführen – etwa auf Entscheidungen oder Empfehlungen an Schnittstellen der Schullaufbahn (Gomolla und Radtke 2002).35
3.2 Die schichtspezifische Sozialisationsforschung und die Theorie der kulturellen Reproduktion
Die schichtspezifische Sozialisationsforschung etablierte das Theorem der kulturellen Diskriminierung von Arbeiter- und Unterschichtkindern durch die Mittelschichtschule. Die These nach Hans-Günther Rolff besagt im Wesentlichen, dass Kinder unterer Schichten im Bildungssystem weniger Förderung und Anerkennung erfahren und auch bei gleicher Leistung schlechtere Bewertungen und Empfehlungen erhalten als Kinder höherer sozialer Schichten. Empirische Belege für diese These finden sich vor allem in den sozial selektiven Bewertungsmaßstäben von Lehrern. Zugleich werden auch auf Seiten der Herkunftsmilieus soziokulturelle Barrieren gegenüber den Anforderungen der Schule angenommen. Die schichtspezifische Sozialisationsforschung hebt hierbei auf einen zirkulären Zusammenhang zwischen fremdbestimmten und routinisierten Arbeitsstrukturen und einschränkenden Erziehungsstilen bei den Eltern sowie entsprechend geringen Fähigkeiten zu selbstbestimmtem schulischen Lernen bei den Kindern ab. Die Theorien der kulturellen Reproduktion betonen klassenkulturelle Orientierungen, die zu einer Selbsteliminierung aus dem Bildungssystem (Bourdieu/Passeron 1971) oder einer Selbstausbildung der Arbeitskraft führen.36 Das von Bourdieu erklärte Kulturelle Kapital beeinflusst dabei die Kompetenzen der Kinder. Je nach sozioökonomischer Lage entwickeln sich durch das Soziale Kapital verschiedene kognitive Fähigkeiten, sprachliche und soziale Kompetenzen und später dementsprechende Schulleistungen der Kinder.37 Nach Bourdieu sind unter kulturellem Kapital alle Kulturgüter und kulturellen Ressourcen zu verstehen, die als symbolische Machtmittel dazu dienen, dass in einem sozialen System die Qualifikationen, Einstellungen und Wertorientierungen vermittelt werden, die das System zu seiner Erhaltung benötigt. Bei Kulturgütern und kulturellen Ressourcen geht es nicht vorwiegend um Sachgüter wie Kunstwerke oder Literatur, sondern auch um institutionalisierte Formen potenzieller Macht wie zum Beispiel Bildungszertifikate oder Titel.38 Das Konzept des kulturellen Kapitals kann man unter funktionalem und strukturellem Gesichtspunkt betrachten. Zur strukturellen Seite gehören vor allem Bildungspatente und der Besuch prestigereicher Institutionen, in Deutschland das Gymnasium oder später auch eine Universität. Unabhängig von den tatsächlich erreichten Kompetenzen ist der Nachweis einer privilegierten Bildungslaufbahn ein symbolisches kulturelles Gut, welches sich im Sozialstatus reproduziert. Zur funktionalen Seite gehören die erwähnten Wertorientierungen, Einstellungen und Kompetenzen, die eine Basis für eine regelmäßige Teilhabe an der bürgerlichen Kultur darstellen.39 Beim sozialen Kapital gehört zum strukturellen Aspekt die Verfügbarkeit sozialer Netzwerke innerhalb der Familie; Eltern oder andere Familienmitglieder müssen existent und präsent sein und Zeit für die Kinder haben. Unter dem funktionalen Blickwinkel fallen Stil und Intensität der Kommunikation innerhalb und außerhalb der Familie.40 Die schichtspezifischen und kulturalistischen Ansätze gehen davon aus, dass von schulischen Institutionen ein aktiv benachteiligender Einfluss auf die schulische Performanz von Arbeiter- und Unterschichtkindern ausgeht. Die kulturellen Diskriminierungen, die Schüler unterer Herkunftsgruppen in der Schule erfahren, korrespondieren mit antischulischen klassenkulturellen Einstellungsmustern, die ihrerseits zur Reproduktion der Bildungsbenachteiligung und der untergeordneten Klassenpositionen beitragen. Die These der kulturellen Diskriminierung und Reproduktion hebt dabei primär auf die Ebene von Unterricht und Curriculum ab. Zu den Schwächen dieser These gehört es, dass ihre institutionellen Bezüge nicht explizit kenntlich gemacht und differenziert formuliert sind. So erscheint die benachteiligende Funktion der Schule lediglich als Resultat kultureller Klassenkämpfe im Klassenzimmer, die sich jenseits institutioneller Strukturen abspielen.41
3.3 Kritik an Beitrag und Funktion der Schule nach Bourdieu
Bourdieu und Passeron haben bereits in den 60er Jahren die Aufmerksamkeit auf den Zusammenhang vom Bildungserfolg der Heranwachsenden und deren Teilhabe an der herrschenden Kultur erforscht, die als bürgerliche Kultur nicht unabhängig von den gegebenen Strukturen ist. Die Theorie des Verhältnisses der Gesellschaftsstruktur zur Struktur schulischen Lernens ist für die Schulforschung von großer Bedeutung, da an den Bedingungen und Inhalten des schulischen Lernens selbst der Vermittlungsprozess thematisiert wird, durch den die herrschende Kultur erhalten und tradiert wird.42 Das Bildungssystem besitzt aufgrund seiner scheinbaren Autonomie und einvernehmlichen Anerkennung einen enormen gestalterischen Einfluss auf die Gesellschaft.
„Muster, die das Denken einer Zeit organisieren (, sind) nur dann vollkommen begreiflich, wenn sie in Beziehung zum Schulsystem gesetzt werden, denn dieses ist allein im Stande sie einzubürgern und sie durch das Einüben zu
gemeinsamen Denkgewohnheiten einer ganzen Generation auszubilden.” 43
Danach liegt es in der Macht der Schule, die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen zu verändern. Jedoch akzeptiert und profitiert das Bildungssystem von den Regeln des sozialen Systems und reproduziert dasselbe, indem es die dahinterstehende Systematik verschleiert.
„Damit die am meisten Begünstigten begünstigt und die am meisten Benachteiligten benachteiligt werden, ist es notwendig und hinreichend, dass die Schule beim vermittelnden Unterrichtstoff, bei den Vermittlungsmethoden und -techniken und bei den Beurteilungskriterien die kulturelle Ungleichheit der Kinder der verschiedenen gesellschaftlichen Klassen ignoriert.”44
Die verheerende Blindheit gegenüber dieser sozialen Ungleichheit legitimiert den akademischen Erfolg der Oberen als natürliche Begabung und verweigert den Unterprivilegierten den Zutritt in ein besseres Leben. „Von unten bis ganz nach oben funktioniert das Schulsystem, als bestände seine Funktion nicht darin auszubilden, sondern zu eliminieren.”45 Prof. Michael Hartmann beklagt in seinem Vortrag „Wer wird Elite?“, dass die prämiertesten Bildungseinrichtungen die sind, die es sich leisten können, die meisten Bewerber abzulehnen. Die Elite-Universität Harvard habe eine Abweisungsquote von 90 Prozent. Somit verstärkt das Bildungssystem die gesellschaftliche Ungleichheit, obwohl sie die einzige machtvolle Institution ist, die diese Ungleichheit verringern und Nachteile kompensieren könnte. Nach Bourdieu ist die Schule eine Mittelschichtinstitution, die einen Habitus verlangt und honoriert, wie er meistens in Mittelschichtfamilien ausgebildet wird. Zu diesem Habitus gehören schulrelevante Kenntnisse und Interessen, wie sie im Hintergrund gemeinsamer Aktivitäten vermittelt werden. Ein gutes Beispiel ist das Interesse am Lesen, welches Kindern die Aneignung weiterer Kulturgüter ermöglicht und deshalb eine Schlüsselvermittlung kulturellen Kapitals übernimmt.46
3.3.1 Soziale Disparitäten anhand von Bourdieu
Die soziale Herkunft von Schülern wird üblicherweise mit Hilfe der soziökonomischen Stellung ihrer Eltern bestimmt, das heißt mit Hilfe von Daten zur Position ihrer Eltern in einer sozialen Hierarchie, deren Ordnungsprinzipien in der Verfügbarkeit über finanzielle Mittel, Macht oder Prestige bestehen. Da diese Informationen nicht einfach zu bekommen sind, wird die sozioökonomische Stellung meist über die Berufstätigkeit erfasst, welche Hinweise auf jeden der drei Aspekte ihrer Stellung in der sozialen Hierarchie geben kann. Daten zum Beruf und zur beruflichen Stellung des Vaters oder beider Eltern waren in der Bildungsforschung die wichtigsten Kriterien, mit deren Hilfe die soziale Herkunft von Schülern bestimmt wurde. Erst seit einigen Jahren werden im Anschluss an die Arbeiten von Bourdieu und Colemann auch andere Aspekte der sozialen Herkunft berücksichtigt, und zwar das kulturelle und soziale Kapital der Familien, aus denen die Kinder kommen.47
Der jeweilige Klassenhabitus und dessen Bewertungsschemata sind demnach ausschlaggebend für den Schulerfolg der Kinder. Schüler unterscheiden sich subtil in ihrer Urteilskraft und ihrem kulturellen Verhalten. Obgleich Schüler verschiedener Gesellschaftsklassen eines Jahrganges denselben Unterricht genossen haben, impliziert diese Tatsache nicht zwangsläufig, dass sie alle das gleiche Wissen und die gleiche Einstellung zu ihrem Wissen besitzen. Denn „nicht Erwerb der Bildung ist entscheidend, sondern die Art und Weise, wie man sie besitzt”48.
Nach Bourdieu sind die einzelnen Klassen durch habituell bedingte Kompetenzunterschiede geprägt. Die kulturellen Kenntnisse eines Akteurs seien umso größer, desto höher dessen Schichtzugehörigkeit liegt. Diese sozialen Vorteile wandeln sich in der Schule in Bildungsvorteile um. Die obere Schicht zeichnet sich durch Macht und Besitz aus. Das Durchsetzungsvermögen im Auftreten einiger Schüler wurde in ihrer einflussreichen Familie gelernt. Diese selbstsicheren Charakterzüge verschaffen diesen Schülern einen enormen Vorteil, beispielsweise für den Vortrag eines Referats oder eine mündliche Prüfung. Das kulturelle Familienkapital „bewirkt bei gleicher Befähigung eine nach gesellschaftlichen Klassen ungleiche Erfolgsquote, vor allem in jenen Fächern, die schon vorhandenes intellektuelles Handwerkzeug, kulturelle Gewohnheiten oder finanzielle Möglichkeiten voraussetzen”49.
Die Gelehrtensprache Latein beherrschen obere Schüler bereits aufgrund ihrer lateingeschulten Eltern und haben einen Vorsprung gegenüber ihren Mitschülern aus der mittleren oder unteren Schicht, deren Eltern sie nur muttersprachlich erzogen haben. Die mittlere Schicht zeichnet sich bildungstechnisch weniger durch eine gelehrte Kultur als vielmehr durch Facharbeit und praktische Intelligenz aus. Diese Kapitalressourcen setzen sie gezielt im Arbeitsmarkt ein, um zumindest ihren bisherigen Status zu sichern und nichts an ihrem Klassenniveau einzubüßen. Die untere Schicht ist in ihrem Kapital unterprivilegiert und gilt als beherrschte Klasse. Die oberen Herrschenden sind es, die ihre Normen und Werte durchsetzen und den Beherrschten ihre zugewiesenen Aufträge aufzwingen können, so dass die Unterlegenden sich selbst fremd werden. Sie besitzen nicht das nötige Selbstbewusstsein, um sich gegen die überlegene Klasse zur Wehr zu setzen, resignieren und respektieren schließlich das bestehende Gesellschaftsverhältnis. Denn dieser Schicht fehlt eine Gelehrtenkultur bzw. ein konkurrenzfähiges Kulturkonzept, welches sie der oberen Klasse entgegenstellen könnten, um sich zu behaupten. Aus diesen klassenspezifischen Entwicklungen ergibt sich die Grundlage für die Ungleichheit in den Bildungschancen. Unterschiedliche Klassenmitglieder müssen einen unterschiedlich langen Weg zurücklegen, um beispielsweise das soziale Feld Studium zu erreichen. Das verraten nicht zuletzt die Daten der Hochschulanteile einzelner Schichten. Während ein Prozent der Kinder, deren Väter Arbeiter sind, studieren, beginnen 90 Prozent der Freiberuflerkinder ein Studium. Diese Verteilung ist weder der natürlichen Begabung noch dem Zufall geschuldet. Die Ursache liegt auch hier im Habitus.50
3.4 Rational-choice-Theorien
Die jüngeren auf Boudon (1974) zurückgehenden Ansätze der rationalen Schulwahlentscheidungen wählen einen anderen Erklärungsansatz. Sie modellieren Bildungsverläufe grundsätzlich als Ergebnis von rationalen Bildungsentscheidungen, die unter jeweils konkreten institutionellen Rahmenbedingungen und nach Maßgabe individuellen Präferenzen oder Zielvorgaben getroffen werden. Damit werden die institutionelle Strukturen des Bildungssystems nach Hillmert zwar an zentraler Stelle berücksichtigt, jedoch lediglich als Kontextbedingungen für individuelle Entscheidungsprozesse. Diskriminierende und aktiv benachteiligende Effekte der Schule auf die Bildungslaufbahnen unterer Schichten spielen in diesen Ansätzen keine Rolle und bleiben weitgehend ausgeschlossen. Im Anschluss an Boudon haben Breen/Goldthorpe ein Erklärungsmodell entwickelt, das beansprucht, ohne den Rekurs auf kulturelle Normen auszukommen. Unter den Bedingungen eines hierarchisch differenzierten Schulsystems führt allein das Motiv des Statuserhalts zu klassenspezifisch unterschiedlichen Bildungsentscheidungen, die wiederum die relativen Chancenungleichheiten reproduzieren. Um das Risiko des sozialen Abstiegs zu vermeiden, müssen höhere soziale Schichten riskantere Bildungsinvestitionen verfolgen, zumal sie aufgrund ihrer besseren Ausstattung mit ökonomischen und kulturellen Ressourcen eher dazu in der Lage sind als niedrige soziale Klassen. Diese neigen dazu, eine Bildungslaufbahn früher abzubrechen, weil sich die Inkaufnahme der Kosten und Risiken für die Erlangung höherer Bildungsabschlüsse nicht rentiert, weil der Statuserhalt bereits früher erreicht werden kann. Bei dieser Argumentation wird weder den Mechanismen einer kulturellen Diskriminierung der Arbeiter- und Unterschichtkinder durch die Schule noch den kulturellen Einstellungsmustern gegenüber institutionalisierten Lern- und Leistungskontexten ein Wert beigemessen.51
Die Beträge für Bildungsrenditen (Einkommen) und Statuserhalt sowie die Erwartungen, diese zu erfüllen, bezeichnet Hartmut Esser als elterliche Bildungsmotivation und das relative Verhältnis zwischen schulischer Leistung des Kindes und erwarteten Bildungskosten als Investitionsrisiko. Vereinfacht gesagt basieren demnach Bildungsungleichheiten nach sozialer Herkunft in den Differenzen zwischen den Sozialschichten bei der Abwägung von Vorzügen (Nutzen) und Nachteilen (Kosten) von höherer Bildung.52 Erreicht werden soll dieser Status nach Boudon mittels zweier Herkunftseffekte. Der primäre Herkunftseffekt geht von der Sozialisation im Elternhaus aus, in der vor allem kognitive Fähigkeiten erworben werden. Der sekundäre Herkunftseffekt bezeichnet die elterliche Schulwahlentscheidung. Danach beruht die Schulwahlentscheidung der Eltern in der Regel auf der Abwägung von drei Komponenten: der Bildungskosten, der erzielbaren Bildungsrenditen (erwartete Berufs- und Einkommenschancen und soziale Aufstiege oder Statussicherungen durch Vermeidung eines Abstiegs) und der Erfolgswahrscheinlichkeit (ob der entsprechende Bildungsgang auch erfolgreich bewältigt werden kann). Der sekundäre Herschaftseffekt kommt dann in den institutionellen Verteilungsprozessen zum Vorschein, die die Kinder in verschiedene weiterführende Schultypen lenken.53 Die Variante der Rational-Choice-Theorie wurde nach Boudon von Breen und Goldthorpe (1997) und von Hartmut Esser (1999) weiter ausgearbeitet.
3.5 Zur Theorie der institutionellen Diskriminierung
Die Erklärungsperspektive der institutionellen Diskriminierung geht auf die Diskussion zum institutionellen Rassismus in den USA und in Großbritannien zurück. Wichtige Vertreter sind Carmichael, Hamilton aus den 70er Jahren und Williams aus den 80er Jahren. Beim Begriff der institutionellen Diskriminierung wird Rassismus oder Sexismus als Ergebnis sozialer Prozesse gesehen. Das Wort institutionell lokalisiert die Ursachen von Diskriminierung im organisatorischen Handeln in zentralen gesellschaftlichen Institutionen (z. B. im Bildungs- und Ausbildungssektor, durch die Polizei oder im Gesundheitswesen) speziell unter der Perspektive der Ungleichheit. Nach Rodolfo Alvarez (1979) werden die Organisationen (Schulhäuser oder Schulämter) in Bezug auf das Diskriminierungsgeschehen jedoch nicht isoliert betrachtet. Es ist wichtig, den Zusammenhang zwischen breiteren sozialen Prozessen und organisatorischen Entscheidungspraktiken sichtbar zu machen. Diese bewirken, dass bestimmte soziale Gruppen systematisch weniger Belohnungen oder Leistungen erhalten als klar identifizierbare Vergleichsgruppen.54 Nach Alvarez ist institutionelle Diskriminierung im Prozess der Belohnungsverteilung in Organisationen zu erklären. Im Rückgriff auf askriptive Entscheidungskriterien der ethnischen und sozialen Herkunft sowie des Geschlechts in einem Zusammenhang, bei dem insbesondere Leistungskriterien eine legitime Entscheidungsgrundlage bilden, kann aufgezeigt werden, wie organisatorische Prozesse, in denen bestimmte Gruppen weniger bekommen als ihnen normativ zusteht, in gewissen institutionellen Arrangements mit Sinn ausgestattet und legitimiert werden. Dabei stellt sich die Frage, welche institutionellen oder organisatorischen Faktoren dafür verantwortlich sind, dass ethnische Merkmale zur Anwendung gelangen und Entscheidungen als fair beurteilt werden können. Feagin und Feagin (1986) unterscheiden zwischen indirekter und direkter institutioneller Diskriminierung. Unter direkter institutioneller Diskriminierung werden regelmäßige, intentionale Handlungen in Organisationen verstanden. Dies können hochformalisierte gesetzlich-administrative Regelungen oder auch informelle Praktiken, die in der Organisationskultur eingeübt sind, sein (ungeschriebene Regelungen). Unter indirekter institutioneller Diskriminierung ist die gesamte Bandbreite institutioneller Vorkehrungen zu verstehen, die Angehörige bestimmter sozialer oder ethnischer Gruppen (beabsichtigt oder unbeabsichtigt) überproportional negativ treffen.55
Trotz der Probleme hinsichtlich der Generalisier- und Vergleichbarkeit von Befunden in der Forschung wurde wiederholt eine Vielzahl von Nachteilen ausländischer Schüler festgestellt, und zwar in der vorschulischen institutionellen Betreuung und im Primar- und Sekundarschulbereich. Weil im stark hierarchisch gegliederten Schulsystem Deutschlands Nachteile zu einem früheren Zeitpunkt bzw. auf früheren Stufen der Bildungskarriere die Ausgangspositionen zu späteren Zeitpunkten in der Bildungskarriere deutlich verschlechtern und Wechsel zwischen den Schulformen nur eingeschränkt möglich, riskant und aufwendig sind, handelt es sich hier um eine historische Kontingenz und ist es nicht verwunderlich, dass sich Nachteile von Migrantenkindern gegenüber deutschen Kindern gleichermaßen bei der vorschulischen institutionellen Betreuung, im Primarschulbereich und im Bereich der Sekundarschulbildung erkennen lassen. Im Bildungsprozess werden Migrantenkinder von deutschen Schülern immer stärker getrennt, so dass im Ergebnis eine ethnische Differenzierung entsteht. Hierbei entwickeln sich teilweise parallele Schülerschaften mit dem Merkmal Deutsch – Nicht-Deutsch als getrennte Milieus.56
3.5.1 Institutionelle Effekte - Die Schule als Bildungsverteiler
Zum einen wird argumentiert, dass Bildungsinstitutionen und insbesondere ihre Gliederung deshalb Ungleichheiten produzieren, weil sie nach Bourdieu und Passeron (1971) Ausdruck der geistigen Elite sind. Auch wurden Belege für sozial diskriminierendes Verhalten der Lehrer gefunden. Geht man von einem derartigen Charakter des Bildungssystems aus, dann würde ein reduzierter Einfluss der Schule auf Bildungsübergänge automatisch den Abbau sozialer Ungleichheiten bedeuten. Andererseits wird nur aus einer funktionalistischen Perspektive darauf hingewiesen, dass insbesondere Bildungseinrichtungen (Schule) gesellschaftliche Orte der Kompensation herkunftsbezogener Ungleichheiten sind, weil universelle leistungsbezogene Standards angelegt werden, während die Wahrnehmung von Schülern und Eltern stärker durch lebensweltliche soziale Abhängigkeiten geprägt ist. Nun stellt sich die Frage, inwieweit die unterschiedlichen Akteure überhaupt wirksam werden können. Bildungsverläufe hängen in jedem Fall von Entscheidungen ab. Dazu gehören Entscheidungen der Eltern und der Schüler oder aber auch Entscheidungen anderer individueller und kollektiver Akteure (Organisationen). Die jeweilige Ausbildungsform legt fest, wie stark Selbst- und Fremdauswahl zu gewichten sind. Ob nun eigene lebenslaufrelevante Entscheidungen oder Entscheidungen anderer, sie erfolgen nicht voraussetzungslos, sondern innerhalb von gewissen Grenzen. Deshalb hängen Lebensverläufe mittelbar stark von den Bedingungen ab, unter denen die Entscheidungen stattfinden. Dabei lassen sich institutionelle Rahmenbedingungen, die sowohl individuelle Entscheidungsmöglichkeiten als auch ihre Grenzen definieren, feststellen.
[...]
1 Vgl. Ditton, in: Becker, 2004, S. 262.
2 In der gesamten Arbeit meine ich mit Schüler selbstverständlich auch Schülerinnen und benutze aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur den einen Begriff.
3 Vgl. Fend, 2006, S. 94 ff.
4 Vgl. Weber, in: Becker, 2004, S. 9.
5 Vgl. Kornmann, in: Auernheimer, 2003, S. 81.
6 Als Migrant soll gelten, wer Ausländer (vor allem wer nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, aber es geht auch um die Integration in die deutsche Gesellschaft), wer mindestens ein Elternteil nichtdeutscher Herkunft hat, wer einer nationalen Minderheit (natürlich keiner deutschen) angehört, wer Flüchtling ist und wer eingebürgert ist. Vgl. Herwartz-Emden, in: Cortina, 2003, S. 663.
7 Vgl. v. Friedeburg, in: Mägdefrau u. Schuhmacher, 2002, S. 7.
8 Vgl. v. Friedeburg, in: Mägdefrau u. Schuhmacher, 2002, S. 7.
9 Vgl. Schaub u. Zenke, 2000, S. 119.
10 Vgl. v. Friedeburg, in: Mägdefrau u. Schuhmacher, 2002, S. 8.
11 Vgl. v. Friedburg, in: Mägdefrau u. Schuhmacher, 2002, S. 7.
12 Vgl. Schaub u. Zenke, 2000, S. 138.
13 Vgl. v. Friedburg, in: Mägdefrau u. Schuhmacher, 2002, S. 8.
14 Vgl. Hradil, 2001, S. 147.
15 Vgl. v. Friedburg, in: Mägdefrau u. Schumacher, 2002, S. 9.
16 Vgl. v. Friedburg, in: Mägdefrau u. Schuhmacher, 2002, S. 8.
17 Vgl. Schaub u. Zenke, 2001, S. 139.
18 Vgl. v. Friedburg, in: Mägdefrau u. Schuhmacher, 2002, S. 8.
19 Vgl. Schaub u. Zenke, 2001, S. 138.
20 Vgl. Rolf Becker, 2004, S. 164 ff.
21 Vgl. Solga u. Wagner 2001, in: Becker, 2004, S. 165.
22 Kulturanpassung, Kulturübernahme, bezeichnet einerseits die Probleme und Prozesse, in denen eine fremde Kultur und ihre einzelnen Elemente von Mitgliedern eines anderen Kulturkreises erworben werden, andererseits das Phänomen der Angleichung oder Verschmelzung verschiedener Kulturen. Böhm, 2000, S. 12.
23 Vgl. v. Friedburg, in: Mägdefrau u. Schuhmacher, 2002, S. 9.
24 Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 2001, S. 47.
25 Vgl. Rolf Becker, 2004, S. 166.
26 Vgl. Schaub u. Zenke, 2001, S. 491.
27 Vgl. Herbert Gudjons, 2006, S. 262.
28 Vgl. Schaub u. Zenke, 2001, S. 476.
29 Vgl. Fend, 2006, S. 50.
30 Fend, 2006, S. 50.
31 Vgl. Fend, 2006, S. 53.
32 Vgl. Dravenau u. Groh-Samberg, in: Berger u. Kahlert, 2005, S. 104.
33 Die Mesoebene bezeichnet den mittleren Bereich zwischen der Gesamtorganisation des Schulsystems und der Einzelschule, während die Mikroebene die internen Interaktionsprozesse in der Schule umfasst. Die darüberstehende Makroebene bestimmt die äußere Organisationsstruktur der Schule im System.
34 Vgl. Dravenau u. Groh-Samberg, in: Berger u. Kahlert, 2005, S. 105.
35 Vgl. Stanat, in: Baumert u. a., 2006, S. 191.
36 Vgl. Dravenau u. Groh-Samberg, in: Berger u. Kahlert, 2005, S. 106.
37 Vgl. Vester, in: Georg, 2006, S. 16.
38 Vgl. Baumert u. Schümer, in: Deutsches PISA-Konsortium, 2001, S. 329.
39 Vgl. ebd., 330.
40 Vgl. ebd., 331.
41 Vgl. Dravenau u. Groh-Samberg, in: Berger u. Kahlert, 2005, S. 107.
42 Vgl. Baumert u. Schümer, in: Deutsches PISA-Konsortium, 2001, S. 329.
43 Bourdieu, 2001, S. 89.
44 Bourdieu, 2001, S. 39.
45 Bourdieu, 2001, S. 21.
46 Vgl. Baumert u. Schümer, in: Deutsches PISA-Konsortium, 2001, S. 330.
47 Vgl. Baumert u. a., in: Cortina, 2003, S. 119.
48 Vgl. Bourdieu, 1971, S. 129.
49 Bourdieu, 1971, S. 31.
50 Vgl. Bourdieu, 1971, S. 20.
51 Vgl. Dravenau u. Groh-Samberg, in: Berger u. Kahlert, 2005, S. 107.
52 Vgl. Becker und Lauterbach, in: Becker, 2006, S. 15.
53 Vgl. Vester, in: Georg, 2006, S. 16.
54 Vgl. Gomolla, in: Auernheimer, 2003, S. 99.
55 Vgl. Gomolla, in: Auernheimer, 2003, S. 100.
56 Vgl. Diefenbach, in: Becker, 2006, S. 231.
Häufig gestellte Fragen
Warum reproduziert das deutsche Schulsystem Bildungsungleichheit?
Die Arbeit argumentiert, dass nicht der Einzelne, sondern institutionelle Mechanismen und die soziale Herkunft den Bildungserfolg maßgeblich bestimmen.
Was besagt Bourdieus Theorie der kulturellen Reproduktion?
Schulen bevorzugen Kinder aus Schichten mit hohem kulturellem Kapital, da deren Habitus besser zu den Anforderungen des Systems passt.
Warum ist der Übergang nach der Grundschule so kritisch?
Die frühe Selektion benachteiligt Kinder aus bildungsfernen Schichten, da Lehrerempfehlungen oft unbewusst mit dem sozialen Status korrelieren.
Was ist „institutionelle Diskriminierung“?
Abläufe innerhalb der Schule (z.B. Sprachfähigkeit als Auslesekriterium), die Schüler mit Migrationshintergrund systematisch benachteiligen.
Gibt es Lösungsansätze aus anderen Ländern?
Die Arbeit blickt über den Tellerrand und diskutiert integrierte Systeme (Gesamtschulen), die eine längere gemeinsame Lernzeit ermöglichen.
- Citation du texte
- Jana Garz (Auteur), 2007, Bildungsinstitutionen und Benachteiligungen im Bildungsprozess - Eine kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Schulsystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133635