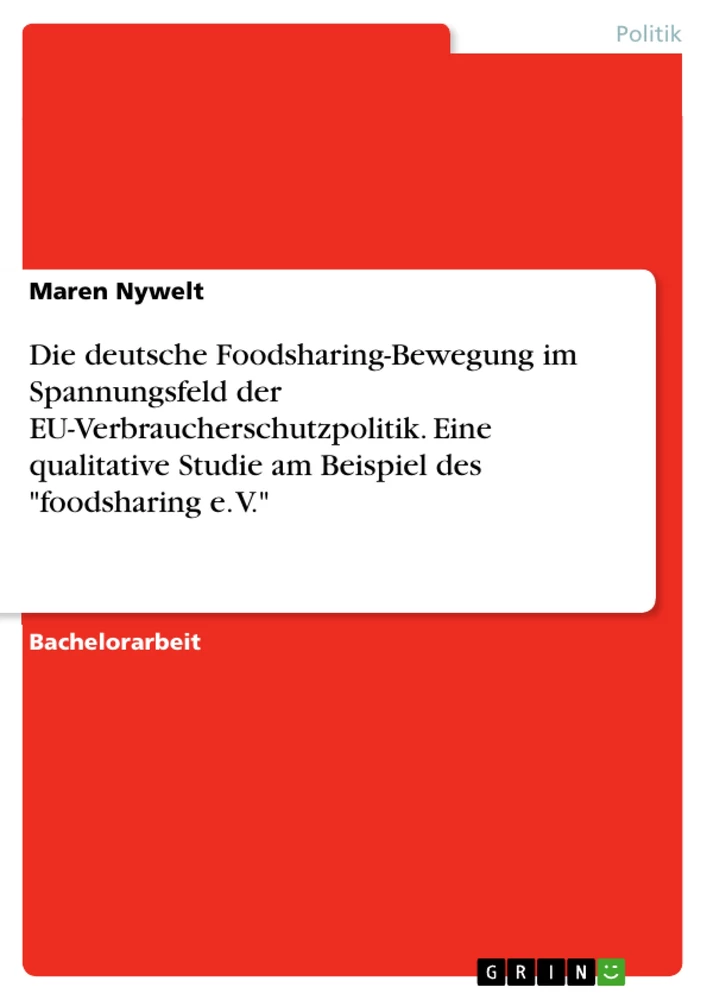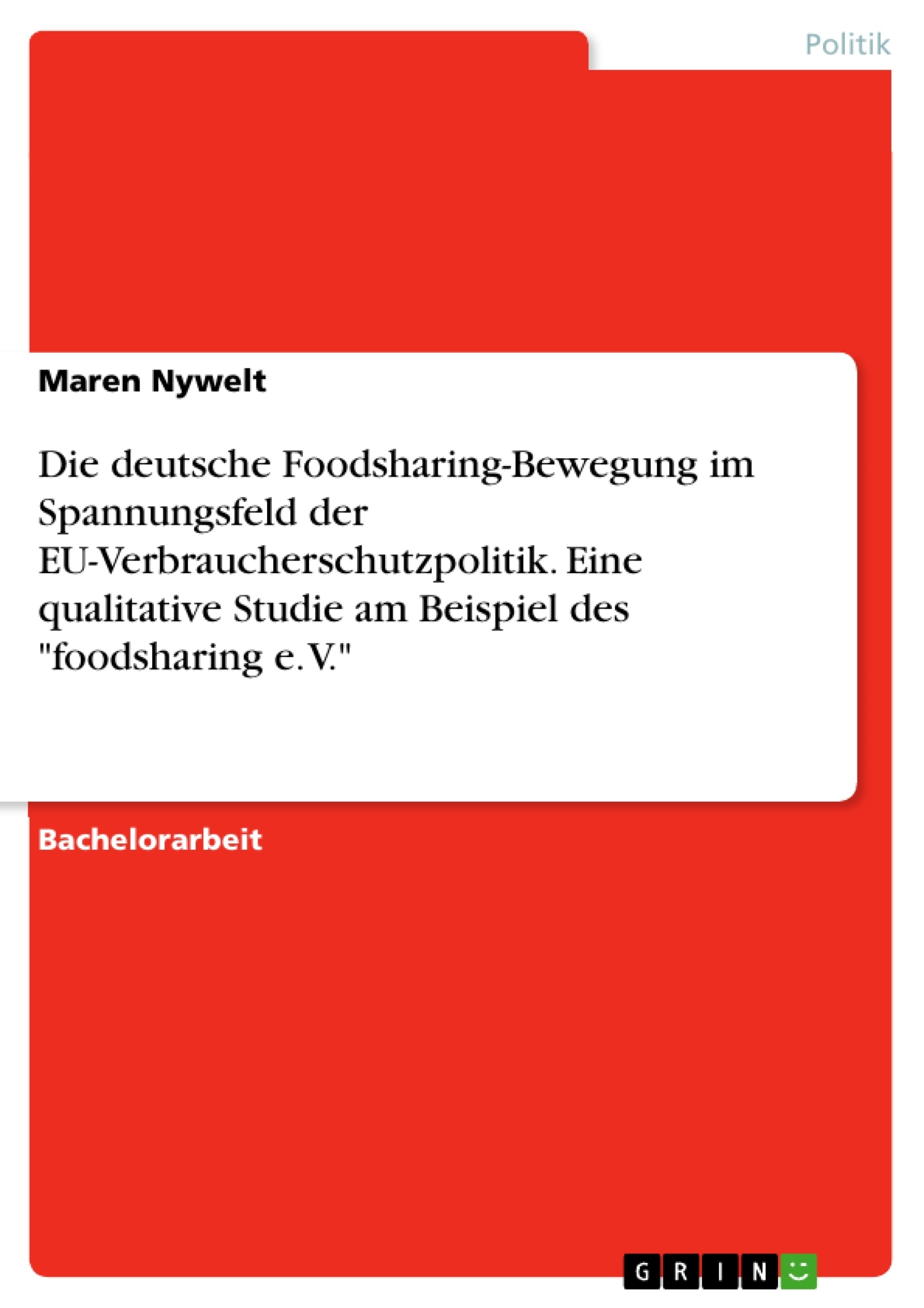Die Arbeit befasst sich mit folgender Forschungsfrage: Inwieweit können bestehende haftungs- und lebensmittelrechtliche Regelungen verändert werden, um die Lebensmittelrettung einfacher für "Foodsaver" und sicherer für Verbraucher*innen zu machen? Die Beantwortung der Forschungsfrage soll einen Beitrag zur Aufzeigung von Lösungsansätzen leisten, die für alle beteiligten Parteien realisierbar sind und auf dem Verbraucherschutz aufbauen.
Um dieses Ziel zu erreichen und die Forschungsfrage zu beantworten, wird in dieser Arbeit zum einen ermittelt welche Bewertungskriterien es gibt, die zu einer Beurteilung von "foodsharing" als Tätigkeit eines Lebensmittelunternehmens herangezogen werden. Ferner wird eruiert, was konkret geändert werden müsste, damit bestehende Regelungen des europäischen und deutschen Lebensmittelrechts an die Ressourcen vom "foodsharing e. V." und seiner Community angepasst werden können und wie eine einheitliche Linie bezüglich der Beurteilung geschaffen werden kann. Zudem wird analysiert, ob "foodsharing" bereits umfassende Maßnahmen bezüglich der Lebensmittelsicherheit- und Hygiene zum gesundheitlichen Schutz der Verbraucher*innen umsetzt oder ob gegebenenfalls weitere Maßnahmen notwendig sind, um das Lebensmittelretten noch sicherer für Verbraucher*innen zu machen, die dennoch verhältnismäßige Lösungen für die "Foodsaver" darstellen. Darüber hinaus werden anhand von Beispielen anderer Länder in der EU politische Maßnahmen zur Vereinfachung und Förderung der Abgabe von Lebensmittelspenden dargestellt. Diese sollen zugleich mehr Rechtssicherheit für die ehrenamtlichen Lebensmittelretter*innen und Spenderbetriebe schaffen und sie vor möglichen behördlichen Auflagen oder strafrechtlicher Verfolgung schützen.
Die Problematik der Lebensmittelverschwendung wird derzeit immer präsenter. Angesichts der Tatsache, dass fast eine Milliarde Menschen weltweit unterernährt sind, ist dies auch ein ethisches Problem. Der Verlust von Lebensmitteln bedeutet nicht nur den Verlust lebenswichtiger Nährstoffe, sondern auch den Verbrauch von knappen Ressourcen wie Land, Wasser und Energie, die für die Produktion, Verarbeitung und Verteilung von Lebensmitteln aufgewendet wurden. Die Mengen an noch verzehrfähigen Lebensmitteln, die jedes Jahr entsorgt werden, belaufen sich laut Einschätzung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen weltweit auf rund ein Drittel der Nahrungsmittelproduktion, was ca. 1,3 Milliarden Tonnen pro Jahr entspricht. Aus diesem Anlass haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) im Rahmen der Ziele der Vereinten Nationen beschlossen, die Menge der Lebensmittelabfälle bis 2030 zu halbieren.
Für die Verwirklichung dieses Ziels und die damit verbundene Sensibilisierung der Gesellschaft setzt sich auch die Initiative "foodsharing" ein, dessen Mitwirkende jeden Tag große Mengen überschüssige, noch genießbare Lebensmittel vor der Entsorgung retten. Pro Tag erfolgen ca. 3.500 Lebensmittel-Rettungen. Die Bewegung wird vom "foodsharing e. V." vertreten und ist 2014 aus der Fusion von foodsharing.de und lebensmittelretten.de entstanden. Der Verein und seine Gemeinschaft (im Englischen "community") ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt derzeit ca. 89.000 ehrenamtliche Lebensmittelretter*innen, die sich selbst als „Foodsaver“ bezeichnen. Der Umgang mit Lebensmitteln im öffentlichen Raum wird in der Europäischen Union (EU) durch Gesetze reguliert, die vor allem dem gesundheitlichen Verbraucherschutz dienen. Relevant sind im Rahmen von "foodsharing" insbesondere Vorgaben des europäischen und nationalen Lebensmittelrechts, aber auch Fragen der Haftung und Strafverfolgung, wenn das Umverteilen von Lebensmitteln als Tätigkeit eines Lebensmittelunternehmens angesehen wird. Ob die "Foodsaver" als Lebensmittelunternehmer*innen gelten, ist gegenwärtig ein umstrittenes Thema. Derzeit existieren lediglich europäische und einzelstaatliche Leitlinien, die zur Orientierung dienen, wie Lebensmittel umverteilende Organisationen zu behandeln sind. Eine Bewertung als solches bedeutet, dass die umverteilenden Organisationen angemessene Sicherheits-, Hygiene-, Qualitäts- und andere regulierende Vorschriften wie eine lückenlose Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel zum Zweck des Gesundheitsschutzes beachten müssen.
Damit verbunden ist zudem das Risiko einer Haftung im Fall eines gesundheitlichen Schadens, der durch ein gerettetes Lebensmittel verursacht wurde. Aus den rechtlichen und operativen Hindernissen sowie einer unterschiedlichen Auslegung der EU-Vorschriften in den EU-Ländern zur Umverteilung von überschüssigen Lebensmitteln resultiert zum einen eine Unsicherheit auf Seiten der "Foodsaver", die möglicherweise privat für ihr Handeln haften müssen. Zum anderen entsteht eine Unsicherheit auf Seiten der Bereitsteller, die sie von einer Weitergabe der Lebensmittel abhält. In diesem Zusammenhang ist überdies nicht geklärt, ob die Empfänger*innen der frei zugänglichen, unentgeltlich abgegebenen Lebensmittel überhaupt Schadensersatzansprüche geltend machen können, da die gängige kaufmännische Definition eines/einer Verbraucher*in den Erwerb von Gütern gegen ein Entgelt impliziert. Diese Unklarheiten und damit verbundene Unsicherheiten erschweren das Retten von Lebensmitteln und behindern somit die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung, Fragestellung und Zielsetzung
- 1.2. Aufbau der Arbeit
- 2. Lebensmittelverschwendung und interventive Maßnahmen in der EU
- 2.1. Begriffsdefinitionen
- 2.2. Ursachen der Lebensmittelverluste und des Lebensmittelüberschusses
- 2.3. Lebensmittelumverteilung in Deutschland und Österreich
- 3. „foodsharing e. V.“
- 3.1. Begriffsdefinitionen
- 3.2. Entstehung und Ziel
- 3.3. Struktur des Vereins und seiner „foodsharing“ Gemeinschaft
- 3.4. Funktionsweise
- 4. Verbraucherschutzpolitik in der Europäischen Union
- 4.1. Begriffsdefinitionen
- 4.2. Allgemeine Grundlagen und Ziele
- 4.3. Das europäische und das deutsche Lebensmittelrecht
- 5. Gesundheitlicher Verbraucherschutz im Rahmen von „foodsharing“
- 5.1. „foodsharing“ als Tätigkeit eines Lebensmittelunternehmens
- 5.2. Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und -hygiene
- 6. Methodik
- 6.1. Systematische Literaturrecherche
- 6.2. Qualitative Experteninterviews
- 7. Darstellung der Ergebnisse
- 7.1. Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche
- 7.1.1. „foodsharing“ als Tätigkeit eines Lebensmittelunternehmens
- 7.1.2. Haftung der „Foodsaver“ und der Spenderbetriebe - aktuelle Gesetzgebung und Lösungsansätze anderer EU-Länder
- 7.1.3. Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und -hygiene
- 7.1.4. Gesundheitlicher Schutz und Rechte der Verbraucher*innen
- 7.2. Ergebnisse der qualitativen Experteninterviews
- 7.2.1. „foodsharing“ als Tätigkeit eines Lebensmittelunternehmens
- 7.2.2. Haftung der „Foodsaver“ und der Spenderbetriebe
- 7.2.3. Lösungsansätze anderer EU-Länder zur Haftungsproblematik
- 7.2.4. Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und -hygiene
- 7.2.5. „foodsharing“ Hygienekonzept einer Verbraucherzentrale
- 7.2.6. Gesundheitlicher Schutz und Rechte der Verbraucher*innen
- 8. Diskussion der Ergebnisse
- 8.1. Diskussion der Methodik
- 8.2. Ergebnisdiskussion
- 8.2.1. „foodsharing“ als Tätigkeit eines Lebensmittelunternehmens und Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und -hygiene
- 8.2.2. Haftungsfrage und Lösungsansätze anderer EU-Länder
- 8.2.3. Gesundheitlicher Schutz und Rechte der Verbraucher*innen
- 9. Fazit und Ausblick
- 10. Zusammenfassung/Abstract
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die deutsche „foodsharing“ Bewegung im Kontext der EU-Verbraucherschutzpolitik. Sie beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der Lebensmittelumverteilung im Spannungsfeld zwischen dem Ziel der Reduzierung von Lebensmittelverschwendung und den Vorgaben des europäischen Lebensmittelrechts ergeben.
- Die Rolle von „foodsharing“ im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Lebensmittelumverteilung in der EU
- Die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und -hygiene im „foodsharing“ Kontext
- Die Frage der Haftung im Falle von Schäden durch „foodsharing“
- Der Schutz der Verbraucher*innen im Rahmen der Lebensmittelumverteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung und die Forschungsfragen, die in dieser Arbeit behandelt werden. Kapitel 2 beleuchtet die Ursachen der Lebensmittelverschwendung in der EU und die geltenden Maßnahmen zur Reduzierung dieser Verschwendung. Im dritten Kapitel wird die „foodsharing“ Bewegung in Deutschland näher betrachtet, insbesondere der Verein „foodsharing e. V.“. Kapitel 4 widmet sich der Verbraucherschutzpolitik der Europäischen Union und den geltenden Lebensmittelrechtlichen Vorgaben. Kapitel 5 analysiert die Herausforderungen im Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, die sich im Rahmen des „foodsharing“ ergeben. Das sechste Kapitel beschreibt die verwendeten Forschungsmethoden, die systematische Literaturrecherche und qualitative Experteninterviews. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Forschungsarbeit, unterteilt in Ergebnisse aus der Literaturrecherche und der qualitativen Experteninterviews. Die Diskussion der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 8, unter Berücksichtigung der Methodik und der gewonnenen Erkenntnisse. Das neunte Kapitel bietet ein Fazit und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsarbeiten. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung/Abstract in Kapitel 10.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen Lebensmittelverschwendung, „foodsharing“, EU-Verbraucherschutzpolitik, Lebensmittelsicherheit, -hygiene und Haftung. Im Fokus stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen der Lebensmittelumverteilung, die Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit und -hygiene im „foodsharing“ Kontext, sowie der Schutz der Verbraucher*innen. Die Arbeit berücksichtigt dabei die Praxis des Vereins „foodsharing e. V.“ und die aktuellen Lösungsansätze in anderen EU-Ländern.
- Citar trabajo
- Maren Nywelt (Autor), 2021, Die deutsche Foodsharing-Bewegung im Spannungsfeld der EU-Verbraucherschutzpolitik. Eine qualitative Studie am Beispiel des "foodsharing e. V.", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1336506