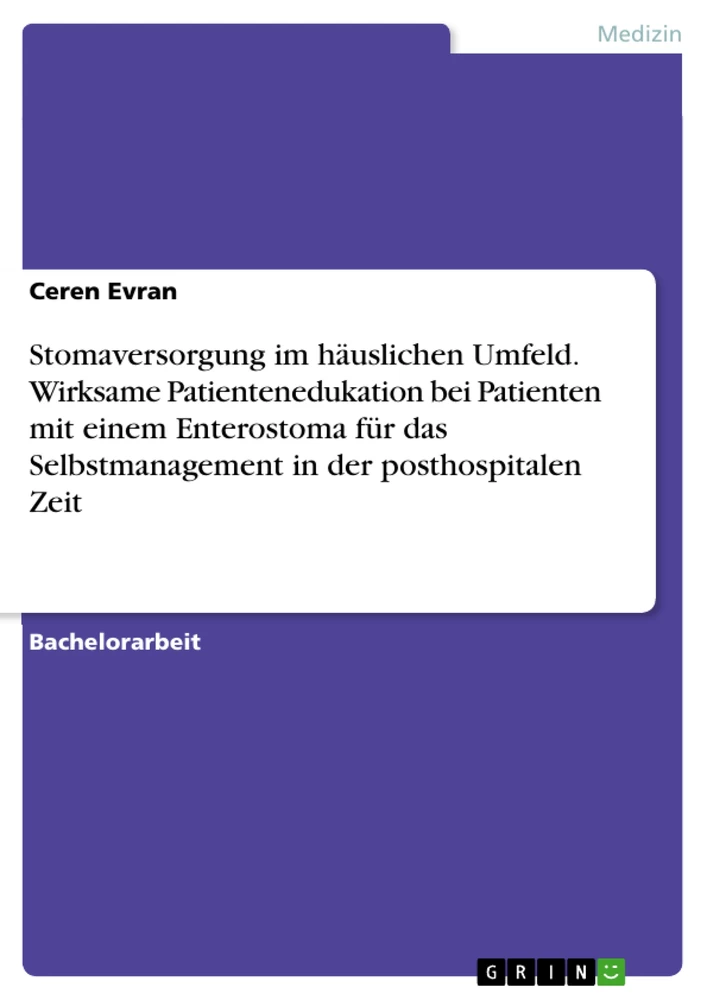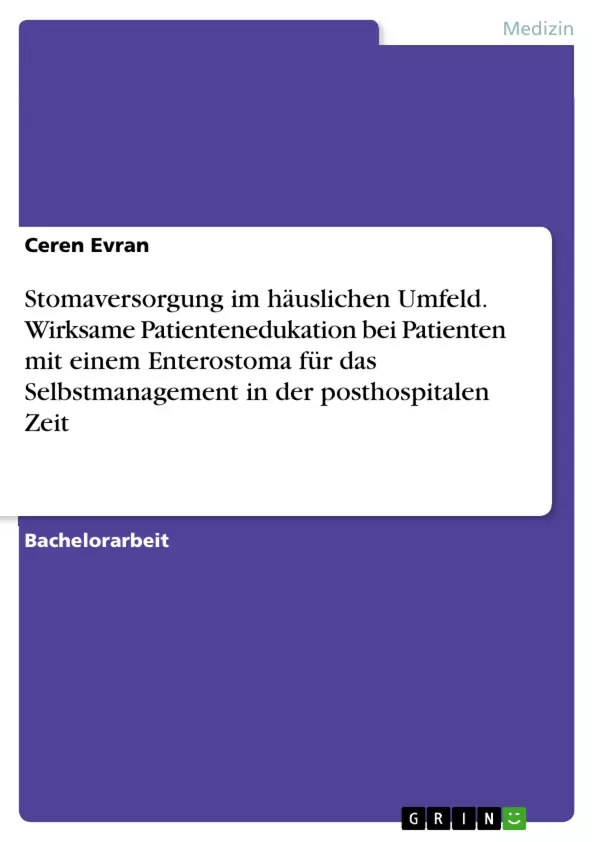Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es aufzuzeigen, welche Informationen und Fähigkeiten Patientinnen und Patienten im Akutspital brauchen, um die Stomaversogung in häuslichem Umfeld übernehmen zu können und sich dabei bei der Handhabung sicher zu fühlen. Die Betroffenen sollen nach der Entlassung die Fähigkeiten besitzen, alleine oder mit Unterstützung in ihrem Umfeld, ihr Stoma zu versorgen.
Patientinnen und Patienten mit einem neuen Stoma werden in ihre psychische, soziale und körperliche Ebene belastet. Die Pflegefachpersonen können eine entscheidende Rolle bei der Patientenedukation in der Stomaversorgung im Akutspital einnehmen und somit eine optimale Stomaversorgung für die Patientinnen und Patienten anbieten um ihr Selbstmanagement zu fördern. Der Arbeit liegt deshalb folgende Fragstellung zugrunde: "Welche Elemente sind für eine wirksame Patientenedukation bei Patientinnen und Patienten mit einem Enterostoma wichtig, um das Selbstmanagement in der posthospitalen Zeit zu erlangen?"
Für die Beantwortung der Fragestellung wurde eine breite Literaturrecherche zwischen dem September bis Oktober 2019 und Juni bis Juli 2020 in den Datenbanken wie Cochrane Library, PubMed, CINAHL und Medline durchgeführt. Daraus wurden insgesamt zehn Studien, welche bei der Beantwortung der Fragestellung hilfreich waren, analysiert und kritisch ausgewertet. Ein- und Ausschlusskriterien sowie der Suchprozess ist in einem Flow-Chart dargestellt. Zusätzlich wurde ein Expertengespräch mit einer Stoma- und Kontinenzberaterin durchgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.2 Die Ausgangslage
- 1.3 Problemschilderung
- 2. Zielsetzung und Fragestellung
- 2.1 Zielsetzung
- 2.2 Fragestellung
- 3. Theoretischer Bezugsrahmen
- 3.1 Kolon und Rektumkarzinom
- 3.2 Stoma Definition
- 3.3 Operationsverfahren
- 3.4 Postoperative Stomakomplikationen
- 3.5 Das Leben mit einem Stoma
- 3.6 Trauer
- 3.7 Selbstmanagement
- 3.8 Sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura
- 4. Methode
- 4.1 Literaturrecherche
- 4.2 Ein- und Ausschlusskriterien der Studien
- 4.3 Beurteilung der Qualität der ausgewählten Studien
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Flow Chart
- 5.2 Auswahl der Studien
- 5.3 Ergebnisse der Literaturrecherche
- 5.4 Resultate des Expertengespräches
- 6. Diskussion
- 6.1 Kritische Würdigung der Studien
- 6.2 Bezug zum theoretischen Bezugsrahmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten nach der Anlage eines Stomas im Hinblick auf eine effektive Patientenedukation. Das Hauptziel ist es, aufzuzeigen, welche Informationen und Fähigkeiten notwendig sind, um die Stomaversorgung im häuslichen Umfeld selbstständig zu bewältigen. Die Arbeit analysiert die Faktoren, die zu einem erfolgreichen Selbstmanagement beitragen.
- Notwendige Informationen und Fähigkeiten für die Stomaversorgung im häuslichen Umfeld
- Einflussfaktoren auf das Selbstmanagement von Stomapatienten
- Effektivität von Patientenedukationsprogrammen
- Rolle der Pflegefachpersonen bei der Patientenedukation
- Verbesserung der Lebensqualität durch optimales Selbstmanagement
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema ein und beschreibt die Ausgangslage. Es wird die Problematik der Herausforderungen für Patientinnen und Patienten nach der Anlage eines Stomas beleuchtet und die Bedeutung von Selbstmanagement hervorgehoben. Die zunehmende Anzahl von Stomaanlagen in der Schweiz wird im Kontext der damit verbundenen Herausforderungen für die Patienten und das Gesundheitssystem dargestellt. Die Notwendigkeit einer effektiven Patientenedukation wird als zentraler Aspekt für den erfolgreichen Übergang in die häusliche Pflege hervorgehoben.
3. Theoretischer Bezugsrahmen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über die relevanten theoretischen Konzepte. Es werden das Kolon- und Rektumkarzinom, die Stomadefinition, verschiedene Operationsverfahren, postoperative Komplikationen und das Leben mit einem Stoma detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf den psychologischen und sozialen Aspekten, wie Trauerbewältigung und der Rolle des Selbstmanagements im Umgang mit der Erkrankung. Die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura wird als theoretischer Rahmen für das Verständnis des Lernprozesses im Kontext der Stomaversorgung vorgestellt. Die Kapitelteile greifen aufeinander auf und zeigen die Komplexität der Thematik und die Bedeutung ganzheitlicher Betreuung auf.
4. Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit. Es wird detailliert auf die durchgeführte Literaturrecherche in verschiedenen Datenbanken eingegangen (Cochrane Library®, PubMedⓇ, CINAHL® MedlineⓇ). Die Auswahlkriterien der Studien sowie der Suchprozess selbst werden mit einem Flowchart visualisiert. Die kritische Bewertung der Qualität der ausgewählten Studien wird ebenfalls erläutert, um die Transparenz und die wissenschaftliche Validität der Arbeit zu gewährleisten. Zusätzlich wird die Durchführung eines Expertengesprächs mit einer Stoma- und Kontinenzberaterin beschrieben.
5. Ergebnisse: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Literaturrecherche und des Expertengespräches präsentiert. Es wird aufgezeigt, welche Patientenedukationsprogramme existieren und wie deren Wirksamkeit sich auf das Selbstmanagement und die Selbstwirksamkeit der Betroffenen auswirkt. Die Ergebnisse unterstreichen den positiven Einfluss evidenzbasierter Programme auf die Reduktion von Stoma- und Stomahautkomplikationen. Die Darstellung der Ergebnisse ist prägnant und verständlich. Die Daten werden in geeigneter Weise aufbereitet, um einen Überblick über die Studienbefunde zu ermöglichen.
6. Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse kritisch und setzt sie in Bezug zum theoretischen Bezugsrahmen. Die Stärken und Schwächen der untersuchten Studien werden analysiert und mögliche Limitationen der Arbeit werden erläutert. Die Ergebnisse werden in einen breiteren Kontext eingeordnet, um Implikationen für die Praxis zu ziehen und den Mehrwert der Arbeit hervorzuheben. Die Diskussion beleuchtet die Relevanz der Ergebnisse und deren Anwendung in der Praxis.
Schlüsselwörter
Kolorektales Karzinom, Stoma, Stomaversorgung, Selbstmanagement, Selbstwirksamkeit, Patientenedukation, Pflege
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten nach der Anlage eines Stomas
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten nach der Anlage eines Stomas im Hinblick auf eine effektive Patientenedukation. Das Hauptziel ist es aufzuzeigen, welche Informationen und Fähigkeiten notwendig sind, um die Stomaversorgung im häuslichen Umfeld selbstständig zu bewältigen und die Faktoren zu analysieren, die zu einem erfolgreichen Selbstmanagement beitragen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Notwendige Informationen und Fähigkeiten für die Stomaversorgung im häuslichen Umfeld, Einflussfaktoren auf das Selbstmanagement von Stomapatienten, Effektivität von Patientenedukationsprogrammen, Rolle der Pflegefachpersonen bei der Patientenedukation und Verbesserung der Lebensqualität durch optimales Selbstmanagement. Zusätzlich werden das Kolon- und Rektumkarzinom, verschiedene Operationsverfahren, postoperative Komplikationen und das Leben mit einem Stoma detailliert beschrieben. Die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura dient als theoretischer Rahmen.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Methodik umfasst eine detaillierte Literaturrecherche in Datenbanken wie Cochrane Library®, PubMedⓇ, CINAHL® und MedlineⓇ. Die Auswahlkriterien der Studien und der Suchprozess werden mit einem Flowchart visualisiert. Die Qualität der ausgewählten Studien wurde kritisch bewertet. Zusätzlich wurde ein Expertengespräch mit einer Stoma- und Kontinenzberaterin durchgeführt.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse zeigen, welche Patientenedukationsprogramme existieren und wie deren Wirksamkeit sich auf das Selbstmanagement und die Selbstwirksamkeit der Betroffenen auswirkt. Die Ergebnisse unterstreichen den positiven Einfluss evidenzbasierter Programme auf die Reduktion von Stoma- und Stomahautkomplikationen.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Die Diskussion analysiert kritisch die Stärken und Schwächen der untersuchten Studien und erläutert mögliche Limitationen der Arbeit. Die Ergebnisse werden in einen breiteren Kontext eingeordnet, um Implikationen für die Praxis zu ziehen und den Mehrwert der Arbeit hervorzuheben. Die Relevanz der Ergebnisse und deren Anwendung in der Praxis werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Kolorektales Karzinom, Stoma, Stomaversorgung, Selbstmanagement, Selbstwirksamkeit, Patientenedukation, Pflege.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: Einleitung (mit Ausgangslage und Problemschilderung), Zielsetzung und Fragestellung, Theoretischer Bezugsrahmen (inklusive Kolon- und Rektumkarzinom, Stomadefinition, Operationsverfahren, postoperativen Komplikationen, Leben mit einem Stoma, Trauer, Selbstmanagement und sozial-kognitiver Lerntheorie nach Bandura), Methode (mit Literaturrecherche, Ein- und Ausschlusskriterien und Qualitätsbeurteilung der Studien), Ergebnisse (mit Flowchart, Studien-Auswahl und Ergebnissen des Expertengesprächs) und Diskussion (mit kritischer Würdigung der Studien und Bezug zum theoretischen Bezugsrahmen).
- Quote paper
- Ceren Evran (Author), 2020, Stomaversorgung im häuslichen Umfeld. Wirksame Patientenedukation bei Patienten mit einem Enterostoma für das Selbstmanagement in der posthospitalen Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1338499