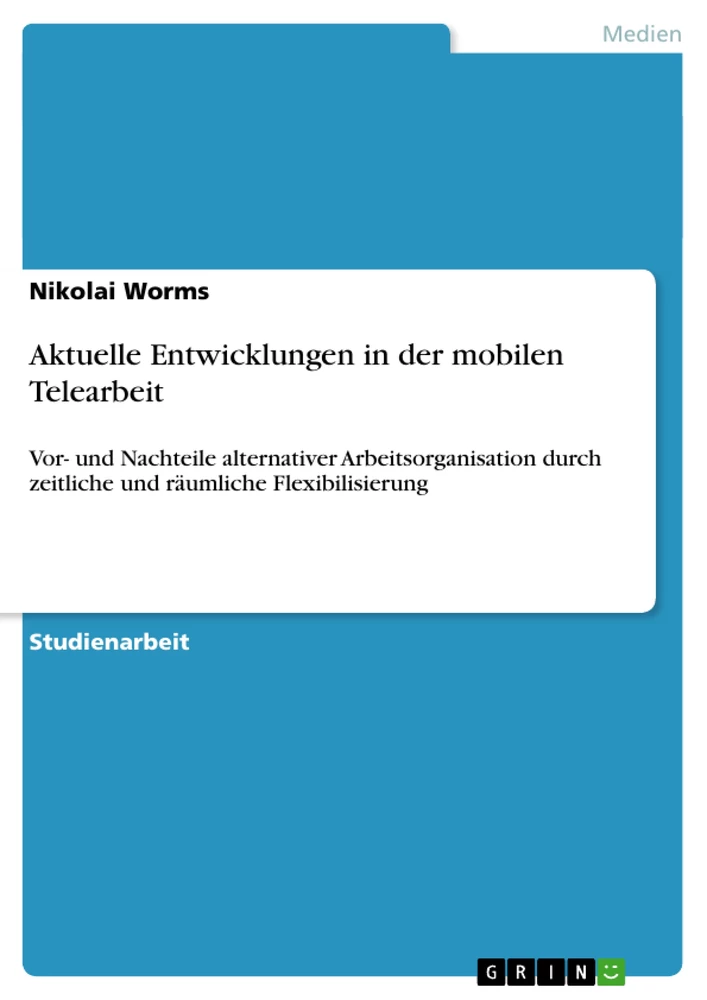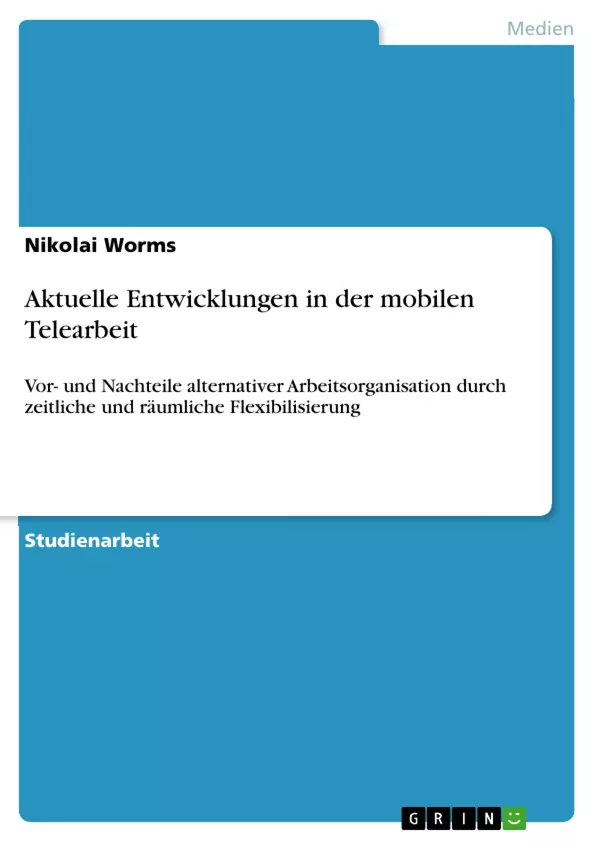Die starren Strukturen eines typischen '9-to-5-Jobs' ermöglichen keine flexible Arbeitszeitgestaltung und lassen wenig Freiraum für eine individuelle Arbeitsorganisation. Und das, obwohl heutzutage viele Arbeitsprozesse digital ablaufen, sich nicht mehr mit materiellen sondern mit Informationsgütern beschäftigen, und ohne Probleme von jedem Ort auf der Welt ausgeführt werden
könnten, an dem eine Internetverbindung zur Verfügung steht.
Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit dem Thema ubiquitärer Arbeit, das eine in der Literatur seit Jahren diskutierte Lösung hinsichtlich einer Reorganisation der Arbeitsform und -zeit für das obige Problem bildet, sich in der Praxis allerdings bisher noch nicht flächendeckend durchsetzen konnte.
Telearbeit existiert als Konzept und in der Praxis schon seit vielen Jahren, und soll in der vorliegenden Studienarbeit als Ausgangspunkt für alle weitere Betrachtungen
dienen.
Ubiquität gewinnt als Schlagwort ('Ubiquitous Computing') seit einigen Jahren an Bedeutung: Gemeint ist die allgegenwärtige Verfügbarkeit eines schnellen Internetzugangs durch entsprechende
Funktechnologien (UMTS, W-Lan, WiMAX), durch die 'echte' mobile Telearbeit ermöglicht wird.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist ein Überblick über aktuelle Entwicklungen der mobilen Telearbeit, aus denen sich Prognosen über die zukünftige Ausdehnung dieser Arbeitsform ableiten lassen.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1 Einleitung und Ausgangslage
2 Definitionen
2.1 Telearbeit
2.2 Mobile Telearbeit
2.3 Telearbeiter
2.4 Ubiquitat
3 Aktuelle technische Voraussetzungen f9r Telearbeit
3.1 Funktechnologien als Grundlage mobiler Telearbeit
3.2 Mobile Endgerate als Grundlage mobiler Buros
3.3 Kollaborative Software
4 Vorteile und Herausforderungen von (mobiler) Telearbeit
4.1 Anforderungen an (mobile) Telearbeit
4.2 Vorteile der (mobilen) Telearbeit
4.2.1 Vorteile f9r den mobilen Telearbeiter
4.2.2 Vorteile f9r den Arbeitgeber
4.2.3 Vorteile fur die Region
4.3 Herausforderungen der Telearbeit
4.3.1 Herausforderungen fur den mobilen Telearbeiter
4.3.1.1 Soziale Isolation
4.3.1.2 Fehlende Trennung von Beruf und Arbeitsleben
4.3.2 Herausforderungen f9r die Unternehmen/Personalentwic klung
5 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung und Ausgangslage
„In den Anfängen der Informationsgesellschaft wurden die Arbeitsformen der Industriegesellschaft einfach weiter fortgeführt: Zentralisierte Arbeitsstätten, hohe Arbeitsteilig keit, detailliert vorgegebene Arbeitsgänge, eine vielstufige Uberwachungs- und Kontrollhierarchie, standardisierte Produ kte und optimierte Infrastru kturen waren die Rahmenbedingungen. Groflraumbüro, [...] Standardsoftware und unflexible Stru kturen führten zu Produ ktionsstru kturen auch in der Informationsverarbeitung."
Dostal 2000: 181
Das obige Zitat beschreibt eine Situation, die von einem Groflteil der Arbeitnehmer scheinbar zunehmend als belastend und unzeitgemäfl empfunden wird [vgl. BITKOM 2009]: Die starren Stru kturen eines typischen 'Nine-to-Five-Jobs' ermöglichen keine flexible Arbeitszeitgestaltung und lassen wenig Freiraum für eine individuelle Arbeitsorganisation. Und das, obwohl heutzuta-ge viele Arbeitsprozesse digital ablaufen, sich nicht mehr mit materiellen sondern mit Informati-onsgütern beschäftigen, und ohne Probleme von jedem Ort auf der Welt ausgeführt werden k önnten, an dem eine Internetverbindung zur Verfügung steht.
Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit dem Thema ubiquitärer Arbeit, das eine in der Literatur seit Jahren dis kutierte Lösung hinsichtlich einer Reorganisation der Arbeitsform und -zeit für das obige Problem bildet, sich in der Praxis allerdings bisher noch nicht flächendec kend durchset-zen konnten.
Telearbeit, also die „Erwerbstätig keit, die ganz oder teilweise an einem externen Arbeitsplatz ausgeübt wird, der mit einem Unternehmen durch ele ktronische Kommuni kationsnetze verbun-den ist" [Die Zeit 2005: Band 14, S. 441] existiert als Konzept und in der Praxis schon seit vielen Jahren, und soll in der vorliegenden Studienarbeit als Ausgangspun kt für alle weitere Betrach-tungen dienen.
Ubiquität gewinnt als Schlagwort ('Ubiquitous Computing') seit einigen Jahren an Bedeutung: Gemeint ist die allgegenwärtige Verfügbar keit eines schnellen Internetzugangs durch entspre-chende Fun ktechnologien (UMTS, W-Lan, WiMAX), durch die 'echte' mobile Telearbeit ermög-licht wird. Nach einer einleitenden Definition der Begriffe Telearbeit, mobile Telearbeit, Telearbei-ter und Ubiquität wird die mobile Telearbeit in den folgenden Kapiteln aus mehreren Perspe kti-ven betrachtet.
Zunächst werden im dritten Kapitel die technischen Voraussetzungen für mobile Telearbeit vor-gestellt. Dazu gehören neben den a ktuellen Fun ktechnologien auch die Entwic klungen auf dem Mar kt der mobilen Endgeräte und kollaborative Office-Anwendungen. Das vierte Kapitel widmet sich den Vor- und Nachteilen der Telearbeit und untersucht, inwiefern sich diese Probleme auch in der mobilen Telearbeit manifestieren, beziehungsweise wie die mobile Telearbeit zu einer Lö-sung der beschriebenen Nachteile beitragen kann. Es werden auflerdem Probleme dis kutiert, die erst durch die Mobilität entstehen könnten.
Den Schluss der Studienarbeit bildet ein Fazit, in dem die Er kenntnisse abschlieflend zusam-mengefasst werden; es wird auflerdem ein Ausblic k auf die zu kiinftige Entwic klung gegeben. Ziel der Arbeit ist also ein Uberblic k iiber a ktuelle Entwic klungen der mobilen Telearbeit, aus de-nen sich Prognosen iiber die zu kiinftige Ausdehnung dieser Arbeitsform ableiten lassen.
2 Definitionen
In diesem Kapitel werden die Begriffe 'Telearbeit', 'Mobile Telearbeit', 'Telearbeiter' und 'Ubiqui-tät' definiert, da sie die Grundlage der späteren Erläuterungen bilden. In Kapitel 2.1 wird zu-nächst der Begriff der Telearbeit erläutert, der seit der Verbreitung des Internets immer wieder als 'Arbeitsform der Zu kunft' in der Literatur auftaucht [Rensmann/Gröpler 1998: Vorwort; Lad-wig 2003: 850]. Aufbauend darauf wird in Kapitel 2.2 die mobile Telearbeit als besondere Form der Telearbeit vorgestellt, und in Kapitel 2.3 kurz auf den Begriff des 'Telearbeiters' eingegan-gen. Danach wird in Kapitel 2.4 das Schlagwort 'Ubiquität' definiert, mit dem unter anderem die Entwic klung der IuK-Technologien hin zu einer orts- und auch zeitunabhängigen Verfügbar keit eines Internetzugangs gemeint ist. Die Definitionen dieses Kapitels bilden dann die Grundlage für die weiteren Ausführungen der folgenden Abschnitte.
2.1 Telearbeit
Telearbeit ist keinesfalls eine neuartige Erscheinung, sondern begleitet die Erfindung verschie-dener Kommuni kationsmedien in unterschiedlichen Ausprägungen. Schon in den achtziger Jah-ren wurde, trotz der im Vergleich schlichten Kommuni kationsmittel, bereits Telearbeit eingesetzt [van de Pol 2007: 11]. Aber erst in den neunziger Jahren erhielt Telearbeit den entscheidenden Schub „by new market conditions that are promoting organizational restructuring, reducing employees, eliminating offices, and giving more flexibility to remaining employees" [Wellmann/Salaff/Dimitrova 1996: 228].
So vielfältig wie die Bandbreite der Telearbeits-Konzepte in der Literatur sind auch die Definitio-nen für Telearbeit, ebenso variieren die benutzten Begriffe:
- Telewor k, (zu deutsch Telearbeit)
- Telecommunting [Baroh/Tr kman 2003: 499]
- Flexiplaces [Baroh/Tr kman 2003: 499]
- Elecronic Cottages [Baroh/Tr kman 2003: 499]
- eWor k [ver.di 2002: 5]
- Tele kooperation [Reichwald/Möslein/Sachenbacher 2000: 123].
- Home Office [z.B. Frick 2009]
Im Folgenden soll die Definition des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung gelten, die von den meisten Fachbüchern über Telearbeit aufgegriffen wird: „Telearbeit ist jede auf Informations- oder Kommuni kationstechni k gestützte Tätig keit, die ausschliefllich oder zeitweise an einem auflerhalb der zentrlen Betriebsstätte liegenden Arbeitsplatz verrichtet wird. Dieser Ar- beitsplatz ist mit der zentralen Betriebsstätte durch ele ktronische Kommuni kationsmittel verbun-den." [BMAS 2001: 10]. Telearbeit gliedert sich verschiedene Formen:
Abbildung 1: Ubersicht Ober die Formen der Telearbeit
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: BMAS 2001: 10
Von diesen Formen der Telearbeit werden in der vorliegenden Studienarbeit nur die mobile Tele-arbeit betrachtet, deren Definition und 'Wir kungsbereich' mit der Einführung des Begriffs der 'Ubiquitären Arbeit' allerdings ergänzt und ausgeweitet wird, so dass die anderen Formen mit darin eingeschlossen werden.
2.2 Mobile Telearbeit
Mobile Telearbeit ist definiert als das „ortsunabhängige Arbeiten mit mobiler Kommuni kations-techni k" [BMAS 2001: 12]. Im Gegensatz zu den anderen Formen der Telearbeit findet diese Tätig keit also an keinem definierten Ort statt, sondern kann pra ktisch von überall erfolgen — „zu Hause, beim Kunden, im Büro oder sogar im Café" [Matthies 1997: 16]; einzige Einschrän kung ist ein Internetzugang. Nach dieser Definition bildet mobile Telearbeit also eigentlich keine gleichberechtigte Form der Telearbeit neben den anderen Formen aus Abbildung 1 — vielmehr schlieflt mobile Telearbeit nach diesem Verständnis die Telearbeitsformen Heimbasierte Telear-beit, On-Site-Telearbeit und Centerbasierte Telearbeit mit ein.
Während ältere Literatur noch beschreibt, dass mobile Telearbeit hauptsächlich von „Auflen-dienstmitarbeitern oder Servicetechni kern" [BMAS 2001: 12] genutzt wird, können heute eine Vielzahl an Tätig keiten von quasi überall ausgeübt werden (das Stichwort 'Ubiquität' wird im nächsten Kapitel erläutert). Mobile Telearbeit ist nicht mehr nur für Mitarbeiter relevant, deren Arbeitsplatz sich bereits vor der Entwic klung neuer Technologien hauptsächlich auflerhalb der Unternehmenszentrale befand, sondern wird als „innovatives, flexibles Arbeitszeitmodell, bei der betriebliche und mitarbeiterbezogene Belange ausgewogen Berechtigung finden und die Mög-lich keiten der neuen Informationstechnologien voll ausgeschöpft werden" [Ladwig 2003: 850] nun auch für Mitarbeiter nutzbar, die bisher am Unternehmensstandort oder in heim- oder cen-ter-basierter Telearbeit beschäftigt waren. Durch die allgegenwärtige Verfügbar keit eines Inter-netzugangs sind Mitarbeiter nicht mehr an den Arbeitsplatz und die Arbeitszeit zu Hause oder in einem Satellitenbüro gebunden, sondern können ihre Arbeit pra ktisch von jedem Ort aus und zu jeder Zeit erledigen [Matthies 1997: 33].
Die Entwic klung hin zu mobiler Telearbeit ist mehreren Treibern geschuldet:
- technische Entwic klungen wie der Ausbau des breitbandigen und kabellosen Internetzu-gangs und die Weiterentwic klung der Empfangs- und Sendegeräte ermöglichen vielfach erst den Einsatz mobiler Telearbeit [Doppel/Brocza/Haiszan et al. 2004: 1]
- veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen [Doppel/Brocza/Haiszan et al. 2004: 1]
- Ansprüchen und Bedürfnissen der Arbeitnehmer, private und berufliche Interessen bes-ser vereinbaren zu können [Jensen/Mes ke 2000: 38; ]
Die moderne Auffassung von mobiler Telearbeit bezieht sich also nicht auf den fast schon tradi-tionellen Auflendienstmitarbeiter aus der Literatur um die Jahrtausendwende, und fo kussiert da-mit nicht allein auf die Mobilität des Arbeitsnehmers als Mer kmal. Weitere Aspe kte wie die Mobi-lität und Flexibilität der Arbeit kommen hinzu, gleiches gilt für Arbeitsort und Arbeitsorganisation. Zeit, Raum und andere Kontexte verlieren somit zunehmend an Bedeutung für die Leistungser-stellung, Schaffers/Carver/Brodt sprechen vom 'Netzwer k als Arbeitsort' [Schaffers/Carver/Brodt et al. 2003: 344].
2.3 Telearbeiter
Für kleinere Selbstständige ist das Home Office oder die Arbeit im Nachbarschaftsbüro oder Café bereits seit vielen Jahren selbstverständlich. Telearbeit im hier dis kutierten Kontext geht aber davon aus, dass sie von Angestellten in einem gröfleren Unternehmen ausgeführt wird. Wenn im Verlauf der vorliegenden Arbeit von 'Telearbeitern' die Rede ist, dann sind damit ab-hängig Beschäftigte in Unternehmen gemeint.
Allerdings werden viele der dis kutierten Vor- und Nachteile auch für selbstständige Telearbeiter zutreffend sein. Der mobile Telearbeiter ist damit definiert als eine „Person, die ihre Wohnung als Ausgangsbasis für ihre tägliche Arbeit hat, [...] mobil unterwegs sind und Informations- und Kommuni kationstechni ken am temporären oder beweglichen Arbeitsplatz nutzen" [Korte 2000: 11].
Neben der erwähnten räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung ist es auflerdem typisch für mo-bile Telearbeiter, dass sie hauptsächlich die Ressourcen 'Wissen' und 'Information' verarbeiten [van den Pol 2007: 7].
2.4 Ubiquitat
Ubiquität ist in Bezug auf die Wirtschaft definiert als „die Erhätlich keit eines Gutes an jedem Ort" [Die Zeit 2005: Band 15, S. 177]. Diese Definition zielt zwar auf tangible G9ter ab, wird in neue-rem Zusammenhang aber auch für die Allgegenwart breitbandiger Internetverbindungen und die Entwic klung entsprechender Empfangs- und Sendegeräte verwendet ('Ubiquitous Computing'). Der fast unbegrenzte Zugang zur technischen Infrastru ktur bildet den Lösungsansatz f9r die moderne Form der mobilen Telearbeit [Reichwald/Möslein/Sachenbacher 2000: 123].
Mobile Telearbeit nach einem neueren Verständnis umfasst deshalb nicht nur die 'typischen Au-flendienstberufe', sondern bietet durch den ubiquitären Zugriff auf „stets relevantes, a ktuelles und konsistentes Datenmaterial" [Reichwald/Möslein/Sachenbacher 2000: 122] die Einf9hrung der Telearbeit in verschiedensten Bereichen des Unternehmens. Es kann sich also um einzelne Personen handeln, die Teil eines Teams an einem festen Ort sind, oder ganze Teams können sich virtuell, etwa f9r die Dauer eines Proje kts, zusammenschlieflen [Hofmann/Regnet 2003: 678]. Für das Unternehmen ist es dabei grundsätzlich nicht mehr wichtig, wo die Arbeit ausge-f9hrt wird — sobald die technische Infrastru ktur und die Organisation an die neue mobile Arbeits-form angepasst worden ist, und sich die Arbeit grundsätzlich f9r die ubiquitäre Ausf9hrung an-bietet, verlieren Ort und Zeit ihrer Ausf9hrung an Bedeutung [Vogler-Ludwig/Behring/D9ll etal. 2000: 112, van den Pol 2007: 6]; „die Leistungserbringung ist nicht an ein festes Bi_iro gebun-den" [Seebass/Wallenstein 2008: 465]. Man könnte also, in Anlehnung an den Begriff des 'Ubiquitous Computing', von 'Ubiquitärer Arbeit' sprechen [van de Pol 2007: 15].
Zusammengefasst ist mit ubiquitärer Arbeit also die zeit- und ortsunabhängige Arbeit gemeint. In dieser Arbeit werden die Begriffe 'Ubiquitäre Telearbeit' und 'Mobile Telearbeit' synonym ver-wendet.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Telearbeit laut dieser Studienarbeit?
Telearbeit wird definiert als jede auf Informations- oder Kommunikationstechnik gestützte Tätigkeit, die ausschließlich oder zeitweise an einem außerhalb der zentralen Betriebsstätte liegenden Arbeitsplatz verrichtet wird. Dieser Arbeitsplatz ist mit der zentralen Betriebsstätte durch elektronische Kommunikationsmittel verbunden.
Welche Formen der Telearbeit werden unterschieden?
Die Studienarbeit erwähnt verschiedene Formen der Telearbeit, konzentriert sich aber hauptsächlich auf die mobile Telearbeit. Andere Formen sind beispielsweise heimarbeitsbasierte Telearbeit, On-Site-Telearbeit und Center-basierte Telearbeit.
Wie wird mobile Telearbeit definiert?
Mobile Telearbeit wird als das ortsunabhängige Arbeiten mit mobiler Kommunikationstechnik definiert. Im Gegensatz zu anderen Formen der Telearbeit findet diese Tätigkeit an keinem definierten Ort statt, sondern kann praktisch von überall erfolgen, vorausgesetzt, es gibt einen Internetzugang.
Was bedeutet der Begriff "Ubiquität" im Kontext der Telearbeit?
Ubiquität bezieht sich auf die allgegenwärtige Verfügbarkeit eines schnellen Internetzugangs durch entsprechende Funktechnologien, die "echte" mobile Telearbeit ermöglichen. Es steht für den fast unbegrenzten Zugang zur technischen Infrastruktur, der die moderne Form der mobilen Telearbeit ermöglicht.
Wer sind Telearbeiter im Kontext dieser Arbeit?
Telearbeiter sind abhängig Beschäftigte in Unternehmen, die ihre Wohnung als Ausgangsbasis für ihre tägliche Arbeit haben, mobil unterwegs sind und Informations- und Kommunikationstechniken am temporären oder beweglichen Arbeitsplatz nutzen.
Welche Vorteile hat Telearbeit?
Die Arbeit nennt Vorteile für den mobilen Telearbeiter, den Arbeitgeber und die Region. Details zu diesen Vorteilen werden im vierten Kapitel der Arbeit näher betrachtet.
Welche Herausforderungen birgt Telearbeit?
Die Arbeit behandelt sowohl Herausforderungen für den mobilen Telearbeiter (z.B. soziale Isolation, fehlende Trennung von Berufs- und Arbeitsleben) als auch Herausforderungen für Unternehmen/Personalentwicklung.
Welche technischen Voraussetzungen sind für Telearbeit notwendig?
Die Arbeit nennt Funktechnologien, mobile Endgeräte und kollaborative Software als aktuelle technische Voraussetzungen für Telearbeit.
Was ist "Ubiquitäre Arbeit"?
Ubiquitäre Arbeit (synonym zu mobiler Telearbeit verwendet) ist die zeit- und ortsunabhängige Arbeit, die durch die allgegenwärtige Verfügbarkeit von Internetzugängen ermöglicht wird.
- Citar trabajo
- Nikolai Worms (Autor), 2009, Aktuelle Entwicklungen in der mobilen Telearbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133925