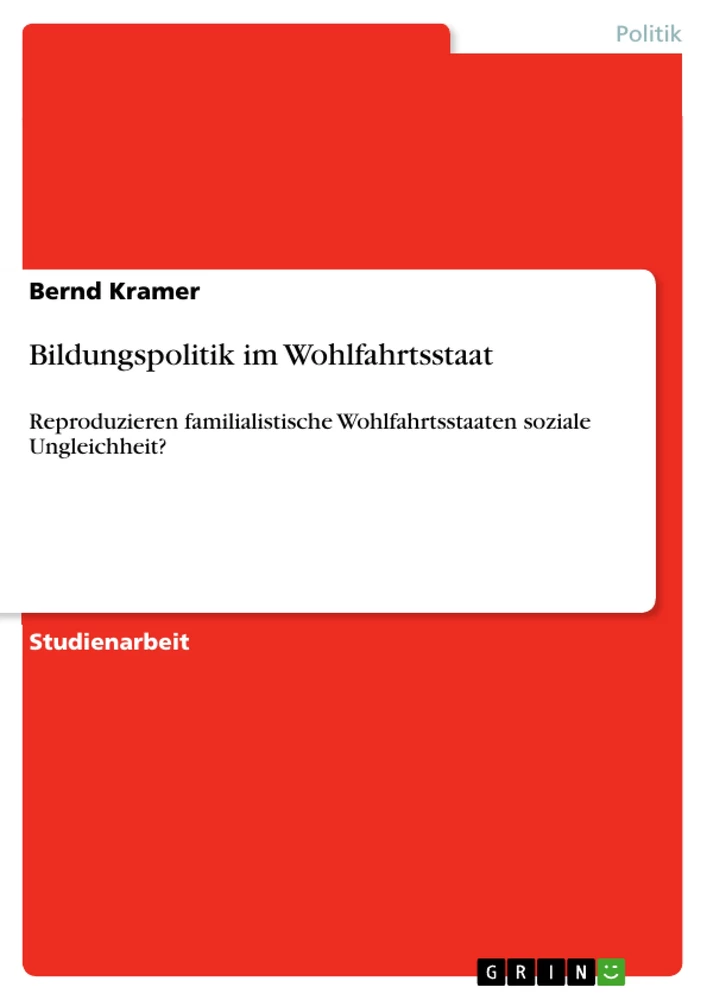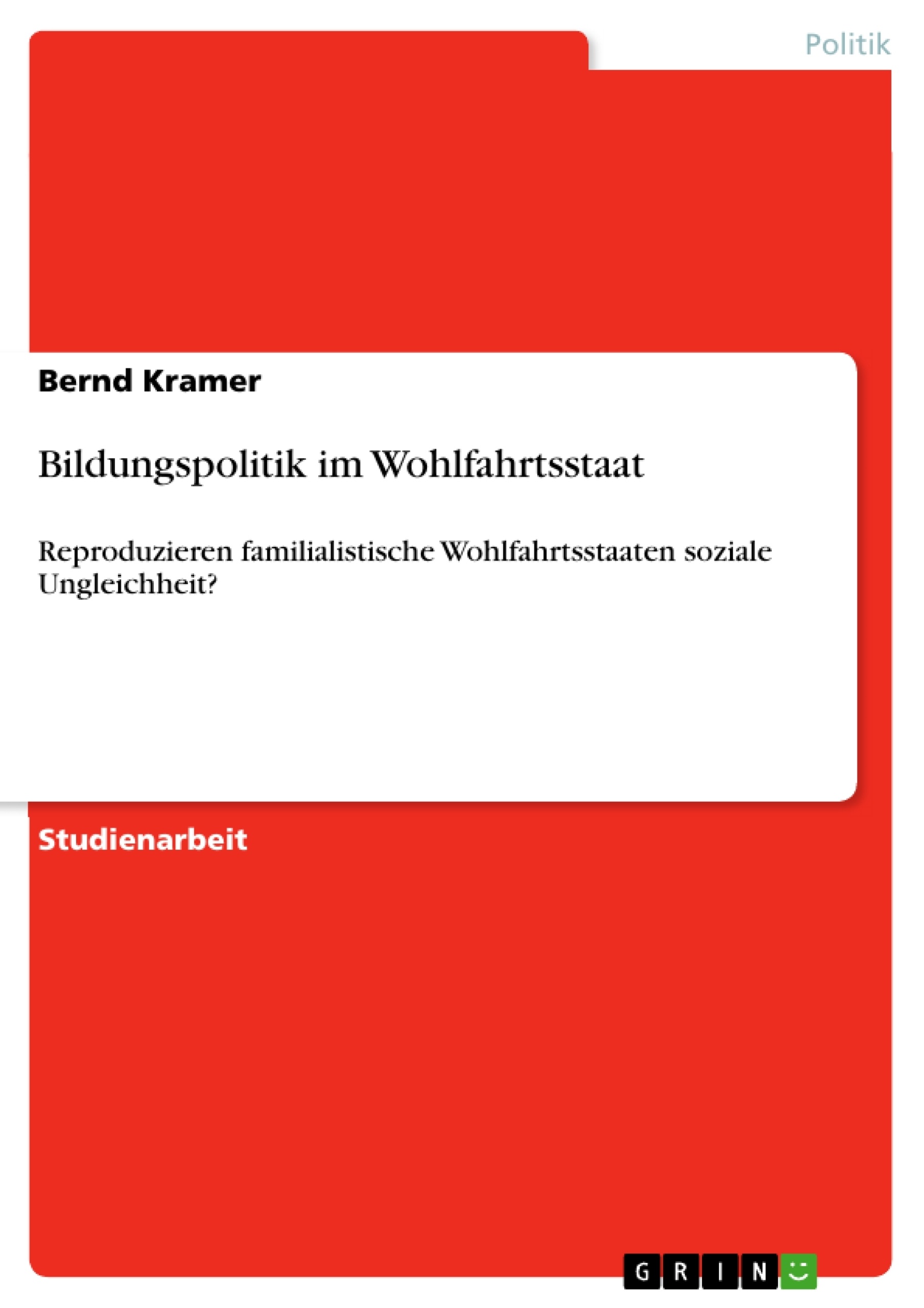Spätestens seit dem schlechten Abschneiden deutscher Schüler in der Pisa-Vergleichsstudie ist Bildungspolitik wieder in aller Munde. Wie kaum eine Studie zuvor hat Pisa den Blick darauf gelenkt, wie stark der Bildungserfolg hierzulande von der sozialen Herkunft abhängt. Parallel dazu wird Bildungspolitik in jüngster Zeit auffällig häufig im Zusammenhang mit Reformen des Sozialstaates diskutiert: Seit den 90ern Jahren avancierte Bildung europaweit zu einem Schlüsselbegriff in sozialdemokratischen Parteiprogrammen (Busemeyer 2008). Die SPD formuliert es in ihrem aktuellen Grundsatzprogramm so: „Der vorsorgende Sozialstaat begreift Bildung als zentrales Element der Sozialpolitik.“ (SPD 2007: 56)
Bildung gehört offenbar irgendwie in den Wohlfahrtsstaat – bloß wie? Warum hängt der Bildungserfolg in einigen Ländern wie etwa in Deutschland besonders stark von der sozialen Herkunft eines Schülers ab, in anderen dagegen kaum? Haben vielleicht bestimmte, typische Merkmale des Wohlfahrtsstaates einen Einfluss darauf, wie durchlässig Bildungssysteme sind?
Im Zentrum dieser Arbeit soll die Frage stehen, ob so genannte familialistische Wohlfahrtsstaaten durch ungleichere Bildungschancen nach sozialer Herkunft charakterisiert sind. In Wohlfahrtsstaaten dieser Art liegen viele Fürsorgeaufgaben typischerweise in den Händen der Familie. Defamilialistische Wohlfahrtsstaaten dagegen – so die Vermutung – sollten vor allem deswegen gleichere Bildungschancen produzieren, weil Angebote öffentlicher Kinderbetreuung weit ausgebaut sind und herkunftsbedingte Startnachteile früh ausgleichen können.
Zunächst gebe ich einen kurzen Überblick über die inzwischen klassische Wohlfahrtstypologie von Esping-Andersen. Der zweite Block geht auf das Konzept des Familialismus ein, das an Esping-Andersens Typologie ansetzt. Ein Literaturüberblick und das Beispiel Deutschlands sollen deutlich machen, warum familialistische Wohlfahrtsstaaten mit weniger durchlässigen Bildungssystemen verbunden sind. Im dritten Teil möchte ich diese Vermutung empirisch mit Daten der OECD-Länder testen: Sind Mütter mit Kindern in Staaten, die viel in Kinderbetreuung investieren, wirtschaftlich unabhängiger von ihrer Familie – und vor allem: Hängen die Bildungschancen der Kinder dort weniger von der sozialen Herkunft ab? Ein Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Bildungspolitik im Wohlfahrtsstaat
- 2. Familialistische Wohlfahrtsstaaten und ungleiche Bildungschancen
- 2.1 Familialismus als Unterscheidungsmerkmal von Wohlfahrtsstaaten
- 2.2 Familialismus als Ursache ungleicher Bildungschancen
- 2.2.1 Bildung im familialistischen Wohlfahrtsstaat: Das Beispiel Deutschland
- 3. Hypothesen
- 3. Empirische Analyse
- 3.1 Datengrundlage
- 3.2 Erwerbstätigkeit von Müttern, Lesekompetenz und Chancengleichheit
- 3.3 Einflüsse auf die Erwerbstätigkeit von Müttern
- 3.4 Einflüsse auf die soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen familialistischen Wohlfahrtsstaaten und ungleichen Bildungschancen. Ziel ist es, die Hypothese zu überprüfen, ob familialistische Systeme aufgrund der starken Betonung familiärer Fürsorge zu geringerer sozialer Durchlässigkeit im Bildungssystem führen.
- Der Einfluss familialistischer Strukturen auf Bildungschancen
- Vergleichende Analyse von Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen
- Die Rolle der Kinderbetreuung in der Gewährleistung von Chancengleichheit
- Der Zusammenhang zwischen Erwerbstätigkeit von Müttern und Bildungserfolg der Kinder
- Empirische Überprüfung der Hypothese anhand von OECD-Daten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Zusammenhang zwischen familialistischen Wohlfahrtsstaaten und ungleichen Bildungschancen. Sie erläutert die Relevanz des Themas im Kontext der PISA-Studie und der aktuellen sozialpolitischen Diskussionen. Die Arbeit skizziert den methodischen Aufbau, der eine theoretische Auseinandersetzung mit Wohlfahrtstypologien und Familialismus sowie eine empirische Analyse umfasst.
1. Bildungspolitik im Wohlfahrtsstaat: Dieses Kapitel analysiert die Einordnung von Bildungspolitik in den Kontext von Wohlfahrtsstaaten nach Esping-Andersen. Es diskutiert die Schwierigkeit, Bildung in das traditionelle Verständnis der Wohlfahrtsstaatstypologie zu integrieren, und präsentiert verschiedene Ansätze, die Bildung als Teil des wohlfahrtsstaatlichen Aufgabenspektrums definieren. Es werden unterschiedliche Funktionen von Bildungspolitik im Wohlfahrtsstaat herausgearbeitet: Statuserzeugung, Dekommodifizierung und Defamiliarisierung. Der Fokus liegt auf der defamiliarisierenden Funktion als zentraler Aspekt der Arbeit.
2. Familialistische Wohlfahrtsstaaten und ungleiche Bildungschancen: Dieses Kapitel erweitert Esping-Andersens Wohlfahrtsstaats-Typologie um den Aspekt des Familialismus. Es kritisiert die geschlechtsblinde Perspektive der ursprünglichen Typologie und stellt die Familie als weiteren Wohlfahrtsproduzenten dar. Das Kapitel diskutiert, wie das Management sozialer Risiken in der Triade Staat-Markt-Familie organisiert ist und wie der Familialismus als Merkmal verschiedener Wohlfahrtsregime verstanden werden kann. Am Beispiel Deutschlands wird illustriert, wie familialistische Strukturen mit ungleichen Bildungschancen verbunden sein können.
Schlüsselwörter
Familialistische Wohlfahrtsstaaten, Bildungspolitik, soziale Ungleichheit, Chancengleichheit, Esping-Andersen, Dekommodifizierung, Defamiliarisierung, Erwerbstätigkeit von Müttern, PISA-Studie, OECD-Daten, Sozialpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Familialistische Wohlfahrtsstaaten und ungleiche Bildungschancen
Was ist das zentrale Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen familialistischen Wohlfahrtsstaaten und ungleichen Bildungschancen. Im Fokus steht die Hypothese, dass familialistische Systeme aufgrund der starken Betonung familiärer Fürsorge zu geringerer sozialer Durchlässigkeit im Bildungssystem führen.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit kombiniert theoretische Analysen mit empirischen Untersuchungen. Theoretisch wird die Wohlfahrtsstaatstyplogie nach Esping-Andersen erweitert und kritisch beleuchtet. Empirisch werden OECD-Daten analysiert, um den Zusammenhang zwischen Erwerbstätigkeit von Müttern, Lesekompetenz und Chancengleichheit zu untersuchen.
Welche Wohlfahrtsstaatstypen werden betrachtet?
Die Arbeit bezieht sich auf Esping-Andersens Wohlfahrtsstaatstyplogie und erweitert diese um den Aspekt des Familialismus. Es wird untersucht, wie das Management sozialer Risiken in der Triade Staat-Markt-Familie organisiert ist und wie der Familialismus als Merkmal verschiedener Wohlfahrtsregime verstanden werden kann. Deutschland dient als Beispiel für einen familialistischen Wohlfahrtsstaat.
Welche Rolle spielt der Familialismus?
Der Familialismus wird als zentrales Unterscheidungsmerkmal von Wohlfahrtsstaaten betrachtet. Die Arbeit analysiert, wie die starke Betonung familiärer Fürsorge die Bildungschancen beeinflussen kann und zu ungleicher sozialer Durchlässigkeit im Bildungssystem führt. Die geschlechtsblinde Perspektive der ursprünglichen Typologie wird kritisiert.
Welche Daten werden verwendet?
Die empirische Analyse basiert auf OECD-Daten. Die Daten werden verwendet, um den Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit von Müttern, der Lesekompetenz von Kindern und der Chancengleichheit im Bildungssystem zu untersuchen.
Welche Schlüsselkonzepte werden behandelt?
Schlüsselkonzepte sind: familialistische Wohlfahrtsstaaten, Bildungspolitik, soziale Ungleichheit, Chancengleichheit, Esping-Andersen, Dekommodifizierung, Defamiliarisierung, Erwerbstätigkeit von Müttern, PISA-Studie, OECD-Daten und Sozialpolitik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Bildungspolitik im Wohlfahrtsstaat, familialistischen Wohlfahrtsstaaten und ungleichen Bildungschancen, Hypothesen, eine empirische Analyse und ein Fazit. Die Kapitel behandeln Aspekte wie die Einordnung von Bildungspolitik in die Wohlfahrtsstaatstypologie, den Einfluss familialistischer Strukturen, die Rolle der Kinderbetreuung und den Zusammenhang zwischen Erwerbstätigkeit von Müttern und Bildungserfolg der Kinder.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit im gegebenen HTML-Code enthalten. Es müsste aus dem vollständigen Text der Hausarbeit entnommen werden.)
- Quote paper
- Bernd Kramer (Author), 2009, Bildungspolitik im Wohlfahrtsstaat , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/133966