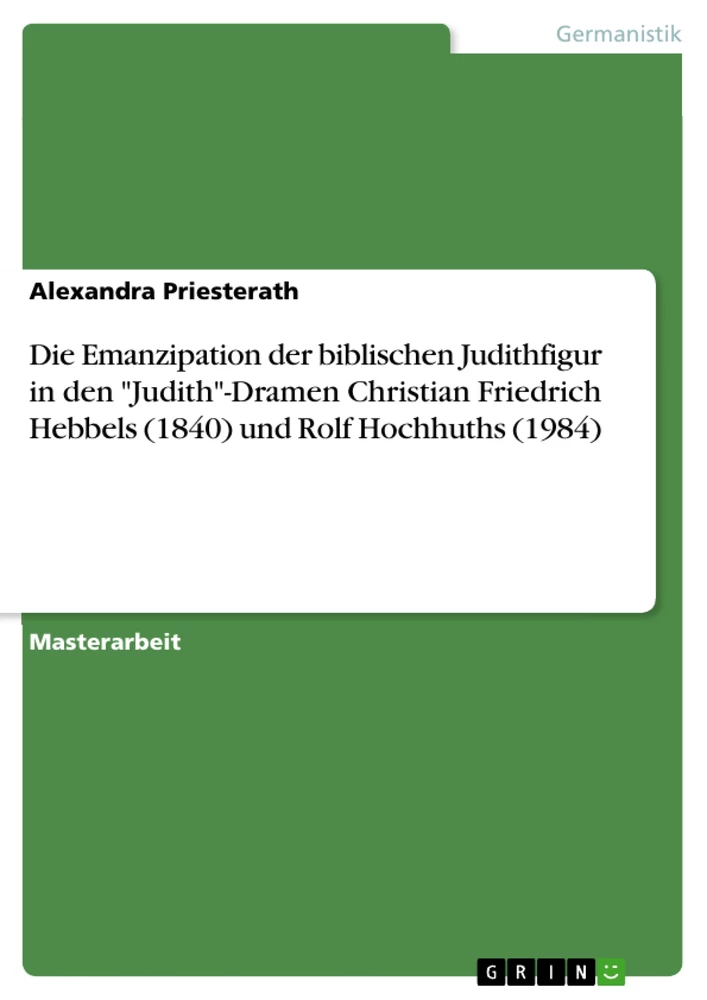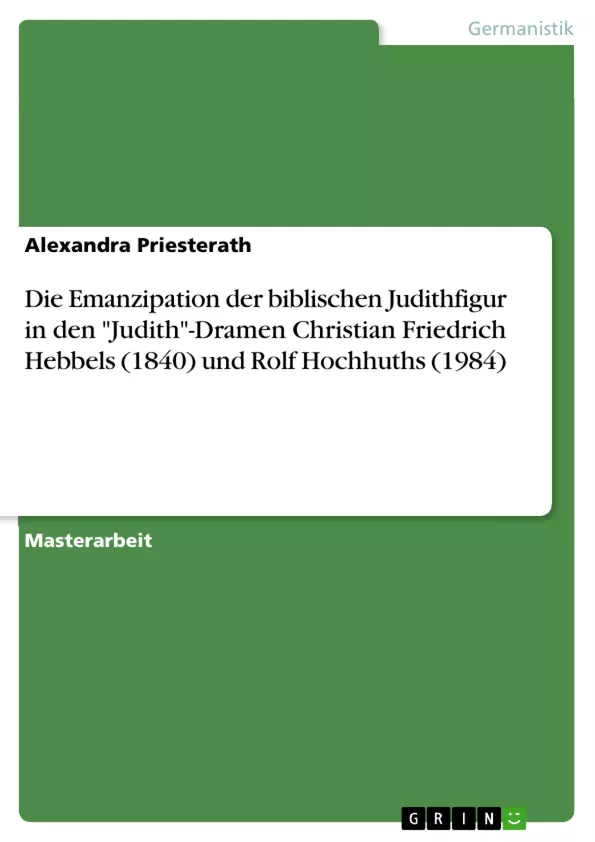Die diese Arbeit leitende Frage nach der Emanzipation der Judithfigur bei Hebbel und Hochhuth und die feministische Analyse der Juditfigur des LXX-Textes basiert auf der Annahme, dass der Urtext und die analysierten Dramen aus einer androzentrischen Perspektive verfasst wurden, sodass die Geschlechtsfrage eine essentiell wichtige für die Subjektwerdung ist.
Es muss zwischen dem biblischen Text und seiner Wirkungsgeschichte unterschieden werden, da letztere für Frauen negativer war „als viele Aussagen der Bibel selbst, die zwar in einer patriarchalischen Kultur entstanden, aber nicht ausdrücklich frauenfeindlich gemeint waren.“ Dies greift jedoch zu kurz, weil es einzig der Rezeptionsgeschichte zugeschrieben wird, dass diese aufgrund ihrer patriarchalen und sexistischen Einstellungen gegenüber Judit Frauen den positiven Zugang zur Figur unterbindet. Es wird kritisch diskutiert, ob die LXX-Version für eine androzentrische Lesart offen ist und zu einer solchen beigetragen haben kann. Die vorliegende Arbeit nimmt die biblische Juditerzählung und den in ihr erkennbaren Androzentrismus zum Anlass, die intertextuellen Bezüge mithilfe der close reading‒Methode unter Verwendung der genettschen Terminologie auf die sozialen Rollen der modernen Judithfiguren zu analysieren. Es soll gezeigt werden, dass Hebbel und Hochhuth ― wie Schriftsteller allgemein ― nicht an eine originalgetreue Übernahme der Hauptfigur in seinen Werken gebunden sind und diese zugunsten ihrer Handlung modifizierten und psychologisierten. Die Wirkungsgeschichte erzeugt somit eine kritische Rückfrage an den biblischen Text aus einer feministischen Perspektive. Zudem kann die Analyse des Urtextes auch zum kritischen Nachvollzug des (Miss-)Verständnisses in der Wirkungsgeschichte dienen. Diese Arbeit hinterfragt die Erzählweise der Juditfigur kritisch, räumt aber ein, dass das Juditbuch nicht ausschließlich misogyne Interessen verfolgt, was alleine daran festgemacht werden kann, dass dieses Buch den Namen einer weiblichen Protagonistin innehat und tradiert wurde. Die Juditerzählung wird als literarischer Text verstanden und es soll mithilfe von textimmanenten Elementen bewiesen werden, dass das Judithbuch ein fiktionaler Text ist. Diese Arbeit basiert auf dem feministischen Dekonstruktivismus, der "erläutern [will], wie Weiblichkeit konstituiert / konstruiert ist, und zwar nicht als selbstidentische Entität, sondern als Effekt kultureller, symbolischer Anordnungen."
Inhaltsverzeichnis
- I) Einführung (Quellen, Forschungsstand)
- II) Methodologische Überlegungen zur Transtextualität nach Genette
- III) Judit und ihre Verwandlung in der Literatur
- 1) Judit im biblischen Text
- 2) Hebbels Judit
- 3) Hochhuths Judit
- IV) Die Emanzipation der Juditfigur
- 1) Die Emanzipation in Hebbels Judith
- 2) Die Emanzipation in Hochhuths Judith
- 3) Judit im biblischen Text - ein emanzipatorisches Beispiel?
- V) Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Juditfigur in der Bibel und in zwei modernen Dramen von Friedrich Hebbel und Rolf Hochhuth. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und wie die Juditfigur in diesen Texten emanzipiert dargestellt wird. Die Arbeit untersucht die literarischen und intertextuellen Bezüge der drei Werke unter Verwendung der Transtextualitätstheorie von Gérard Genette.
- Intertextuelle Bezüge zwischen der Bibel, Hebbels Judith und Hochhuths Judith
- Emanzipation der Juditfigur in den drei Texten
- Feministische Analyse der Juditfigur
- Transtextualitätstheorie nach Genette
- Androzentrische Perspektive der Juditfigur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Quellen und den Forschungsstand des Juditbuches. Das zweite Kapitel führt in die Transtextualitätstheorie von Gérard Genette ein. Der dritte Teil widmet sich der Juditfigur in der Bibel, Hebbels Judith und Hochhuths Judith. Das vierte Kapitel analysiert die Emanzipation der Juditfigur in den drei Texten. Der letzte Teil fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Judit, Emanzipation, Transtextualität, Intertextualität, Androzentrismus, Bibel, Hebbel, Hochhuth, feministische Exegese und close reading.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Geschichte von Judith?
Die biblische Judith rettet ihr Volk, indem sie den feindlichen Feldherrn Holofernes verführt und enthauptet.
Wie unterscheiden sich die Dramen von Hebbel und Hochhuth?
Hebbel (1840) fokussiert auf die psychologische Zerrissenheit und die Geschlechtertragik, während Hochhuth (1984) die Figur in einen moderneren Kontext stellt.
Was ist eine feministische Exegese der Judithfigur?
Eine Analyse, die den androzentrischen (männerzentrierten) Blick des Urtextes kritisch hinterfragt und die Handlungsfähigkeit der Frau betont.
Was bedeutet Transtextualität nach Genette?
Ein literaturwissenschaftlicher Ansatz, der die Beziehungen zwischen verschiedenen Texten (z. B. Bibel und modernes Drama) untersucht.
Ist die biblische Judith ein Beispiel für Emanzipation?
Die Arbeit diskutiert dies kritisch: Einerseits ist sie eine starke Retterin, andererseits bleibt der Text in patriarchalen Denkmustern verhaftet.
- Arbeit zitieren
- Alexandra Priesterath (Autor:in), 2022, Die Emanzipation der biblischen Judithfigur in den "Judith"-Dramen Christian Friedrich Hebbels (1840) und Rolf Hochhuths (1984), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1339961