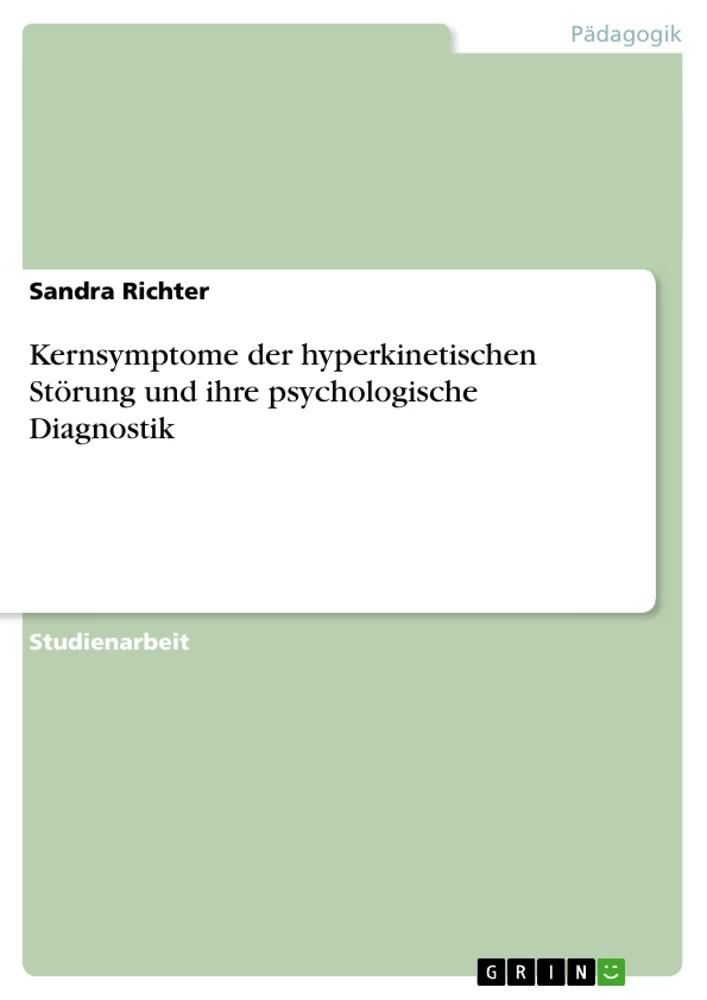Das Phänomen der hyperkinetischen Störung, wenn auch noch nicht als solches bezeichnet, wurde bereits 1845 von dem Frankfurter Nervenarzt und Autor Dr. Heinrich Hoffmann in Form des bekannten Zappel-Phillipp beschrieben.
Jedoch begann man sich erst im 20. Jahrhundert mit dem Störungsbild und dessen Ursachen näher zu beschäftigen.
Heute gehören die hyperkinetischen Störungen "zusammen mit den Störungen des Sozialverhaltens zu den am häufigsten in kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtungen gestellten Diagnosen" (Petermann, 1995, S. 169).
Das klinische Bild zeigt eine "deutliche Altersabhängigkeit" (Trott, 1993, S. 101). Dabei bestehen "bei über der Hälfte der Kinder bereits im Säuglingsalter eine ausgeprägte Unruhe und Irritierbarkeit" (Trott, 1993, S. 101), welche dann im Vorschulalter nicht mehr zu übersehen sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Kernsymptome der hyperkinetischen Störung
- Aufmerksamkeitsstörung
- Impulsivität
- Hyperaktivität
- Psychologische Diagnostik hyperkinetischer Störungen
- DSM-IV versus ICD-10
- Intervention hyperkinetischer Störungen
- Überblick
- Kernsymptome der hyperkinetischen Störung
- Schlußteil
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Störungsbild der hyperkinetischen Störung. Ziel ist es, die Kernsymptome, die psychologische Diagnostik sowie die Intervention bei hyperkinetischen Störungen zu beleuchten. Der Fokus liegt dabei auf dem Verständnis der Symptome und ihrer Auswirkungen auf das Leben Betroffener.
- Kernsymptome der hyperkinetischen Störung: Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität, Hyperaktivität
- Psychologische Diagnostik: DSM-IV versus ICD-10
- Intervention: Überblick über verschiedene Ansätze
- Altersabhängigkeit des Störungsbildes
- Bedeutung des Störungsverständnisses für die pädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Störungsbild der hyperkinetischen Störung vor und beleuchtet die historische Entwicklung des Verständnisses der Störung. Dabei wird der Fokus auf die Bedeutung der Diagnose in der pädagogischen Praxis gelegt.
Hauptteil
2.1 Kernsymptome der hyperkinetischen Störung
- Die Aufmerksamkeitsstörung wird differenziert in die Störung der selektiven Aufmerksamkeit und die Störung der Daueraufmerksamkeit.
- Die Impulsivität wird in kognitiven, motivationalen und emotionalen Bereichen betrachtet.
- Die Hyperaktivität zeigt sich in einer überschießenden motorischen Aktivität, die besonders in ruhigen Situationen deutlich wird.
2.2 Psychologische Diagnostik hyperkinetischer Störungen
Dieser Abschnitt beleuchtet die Herausforderungen der psychologischen Diagnostik bei hyperkinetischen Störungen, insbesondere die Schwierigkeit der kategorialen versus dimensionalen Einordnung der Aufmerksamkeitsdefizitstörung.
2.3 Intervention hyperkinetischer Störungen
Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über verschiedene Ansätze zur Intervention bei hyperkinetischen Störungen.
Schlüsselwörter
Hyperkinetische Störung, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS), Kernsymptome, Diagnostik, DSM-IV, ICD-10, Intervention, Pädagogische Psychologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Kernsymptome einer hyperkinetischen Störung?
Die Kernsymptome sind Aufmerksamkeitsstörung (Konzentrationsprobleme), Impulsivität (unüberlegtes Handeln) und Hyperaktivität (ausgeprägte körperliche Unruhe).
Wer beschrieb das Störungsbild bereits im Jahr 1845?
Der Frankfurter Nervenarzt Dr. Heinrich Hoffmann beschrieb die Symptome literarisch in der Figur des „Zappel-Philipp“ in seinem Buch Struwwelpeter.
Worin unterscheiden sich DSM-IV und ICD-10 bei der ADHS-Diagnostik?
Die beiden Klassifikationssysteme haben unterschiedliche Kriterienkataloge für die Diagnosestellung, was die Einordnung der Störung als kategoriales oder dimensionales Phänomen beeinflusst.
Ab welchem Alter sind hyperkinetische Störungen erkennbar?
Das klinische Bild ist altersabhängig. Bei über der Hälfte der betroffenen Kinder zeigen sich bereits im Säuglingsalter Unruhe und Irritierbarkeit, die im Vorschulalter deutlich hervortreten.
Wie wird die Aufmerksamkeitsstörung bei Kindern differenziert?
Man unterscheidet zwischen einer Störung der selektiven Aufmerksamkeit (Ablenkbarkeit) und einer Störung der Daueraufmerksamkeit (Durchhaltevermögen).
Welche Interventionsmöglichkeiten gibt es bei hyperkinetischen Störungen?
Die Arbeit gibt einen Überblick über verschiedene Ansätze, die von pädagogischen Maßnahmen über psychologische Verhaltenstherapien bis hin zu medikamentösen Behandlungen reichen können.
- Quote paper
- Sandra Richter (Author), 2002, Kernsymptome der hyperkinetischen Störung und ihre psychologische Diagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13402