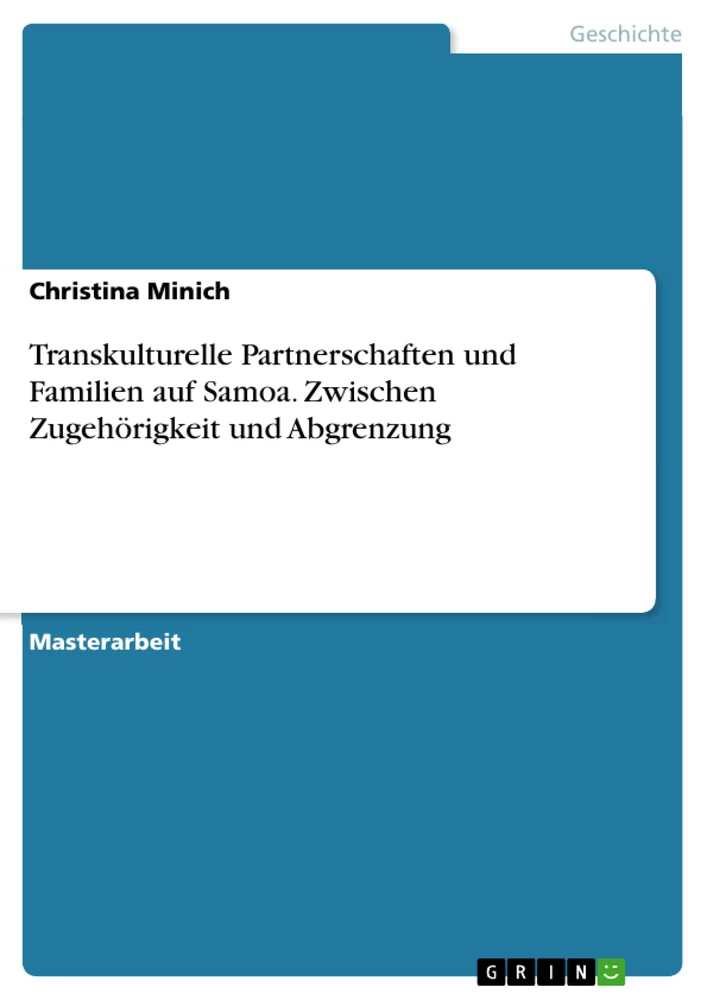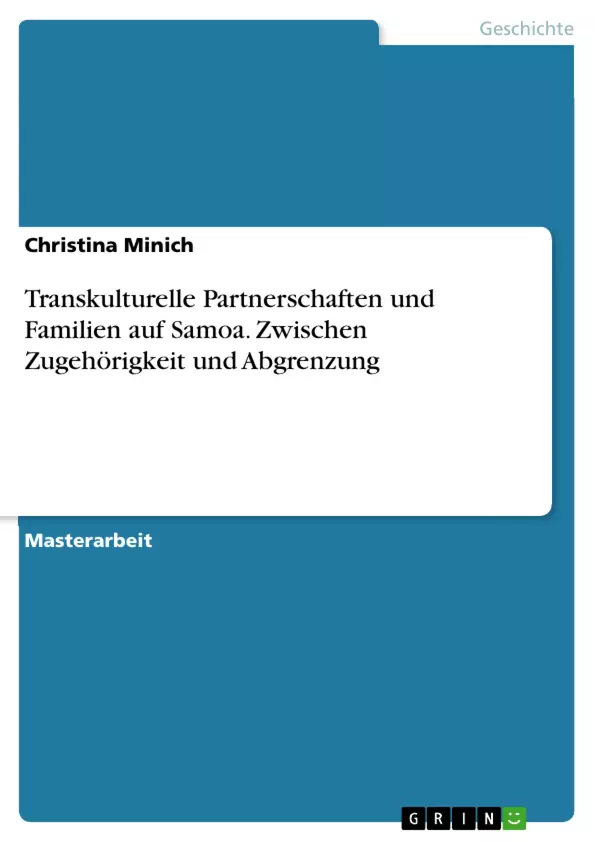Transkulturelle Partnerschaften bzw. Ehen und die aus solchen Verbindungen hervorgegangenen Kinder stellten die Kolonialverwaltung vor eine besondere Herausforderung, denn eine eindeutige Zuordnung zu den damals verbreiteten Kategorien „Eingeborene/r“ und „Nichteingeborene/r“ sowie „Schwarz“ und „Weiß“ war nicht möglich.
Bedeutsamkeit erlangten transkulturelle Ehen nicht nur in den Schutzgebieten Deutsch-Südwestafrikas und auf Samoa, wobei die meisten solcher Verbindungen auf Samoa geschlossen wurden. Im Gegensatz zu der toleranten Gesellschaft auf Samoa empfanden besonders die Konservativen im deutschen Reichstag solche Verbindungen als bedrohlich, was sich in der Debatte um das „Mischehenverbot“ (1912) niederschlug. In der Forschung wurden meistens die theoretischen Argumente in den Zeitungsartikeln und Akten rund um die „Mischehendebatte“ ausgewertet.
Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Masterarbeit zusätzlich weitere Quellensorten herangezogen, wie zum Beispiel Reiseberichte von auf Samoa lebenden oder zeitweise weilenden Schreibern, die insbesondere das Zusammenleben in den transkulturellen Partnerschaften, Ehen und Familien in den Blick nehmen. Die bislang nicht berücksichtigten Fotografien der Samoaner-Deutschen zeigen zudem, dass sich der Diskurs auch visuell vollzog.
Mithilfe dieser Quellen wird die folgende Fragestellung beantwortet: Wie wurden transkulturelle Partnerschaften, Ehen und Familien auf Samoa von deutschsprachigen Publizisten im Deutschen Kaiserreich und in der Kolonie im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert dargestellt?
Die These lautet hierbei, dass die deutschsprachigen Publizisten in ihren Darstellungen angebliche Rassendifferenzen durch kulturelle und soziale Differenzierungen ergänzten, aushebelten oder verstärkten. Verknüpft mit ihren weltanschaulichen Positionen trugen sie auf diese Weise dazu bei, vielfältige soziale Zugehörigkeiten und Abgrenzungen zu begründen und Samoa bot auch die Projektionsfläche, eigene gesellschaftliche Ideale zu formulieren.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- 1.1 Forschungsstand und -lücken
- 1.2 Zielsetzung und Fragestellungen
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
- 2.1 Konzept A
- 2.2 Konzept B
- 2.3 Modell C
- Kapitel 3: Methodisches Vorgehen
- 3.1 Forschungsdesign
- 3.2 Datenerhebung und -analyse
- Kapitel 4: Ergebnisse
- 4.1 Ergebnis 1
- 4.2 Ergebnis 2
- 4.3 Ergebnis 3
- Kapitel 5: Diskussion
- 5.1 Interpretation der Ergebnisse
- 5.2 Relevanz und Bedeutung
- 5.3 Limitationen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit [Thema der Arbeit] und zielt darauf ab, [Hauptziel der Arbeit] zu untersuchen. Sie analysiert [wichtiges Aspekt] im Kontext von [relevanter Kontext] und befasst sich mit [zentrale Fragestellung].
- Themenschwerpunkt 1
- Themenschwerpunkt 2
- Themenschwerpunkt 3
- Themenschwerpunkt 4
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Das erste Kapitel führt in das Thema [Thema der Arbeit] ein und beschreibt den aktuellen Forschungsstand sowie die Forschungslücken, die diese Arbeit adressiert. Es werden die Ziele und Fragestellungen der Arbeit erläutert.
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
Das zweite Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen, auf denen die Arbeit basiert. Es werden wichtige Konzepte und Modelle aus [relevante Disziplin] vorgestellt, die für die Untersuchung von [Thema der Arbeit] relevant sind.
Kapitel 3: Methodisches Vorgehen
Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Es erläutert das Forschungsdesign, die Datenerhebungsmethoden und die Datenanalyse.
Kapitel 4: Ergebnisse
In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert. Es werden [wichtige Ergebnisse] dargestellt und diskutiert.
Kapitel 5: Diskussion
Kapitel 5 interpretiert die Ergebnisse und diskutiert ihre Relevanz und Bedeutung. Es werden auch Limitationen der Arbeit sowie zukünftige Forschungsrichtungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit [Hauptthema der Arbeit] und verwendet Schlüsselbegriffe wie [wichtige Schlüsselbegriffe] um [Aspekt der Arbeit] zu analysieren.
- Citar trabajo
- Christina Minich (Autor), 2020, Transkulturelle Partnerschaften und Familien auf Samoa. Zwischen Zugehörigkeit und Abgrenzung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1341582