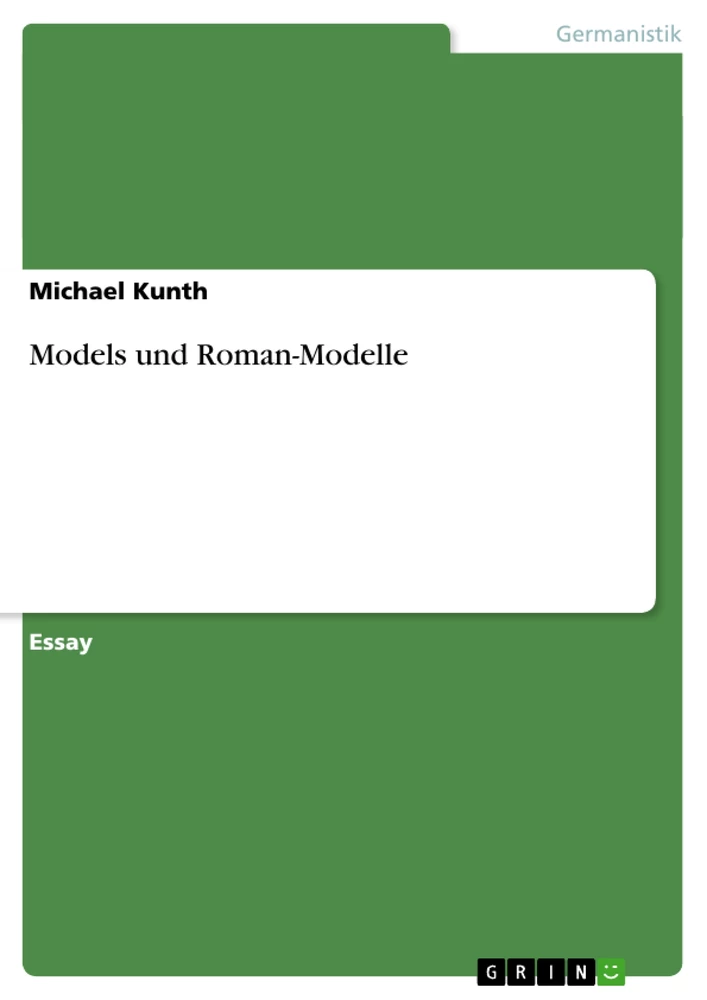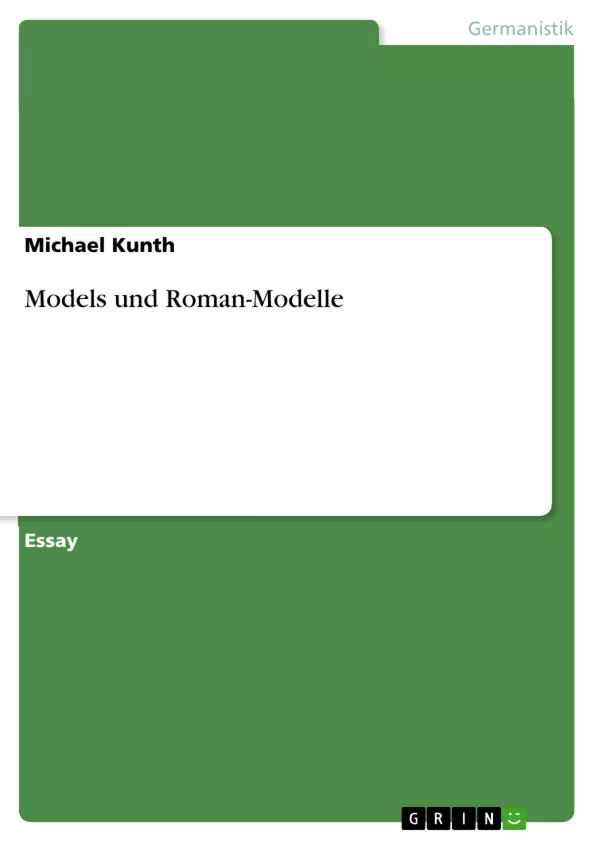Die Aufführung von sogenannten Lebenden Bildern oder tableaux vivants war ein beliebtes Gesellschaftsspiel des Bürgertums im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert.
Der Begriff bezeichnet „plastische Darstellungen von Gemälden durch lebende Personen (...).“ Nach B. Jooss handelt es sich um „szenische Arrangements von Personen, die für kurze Zeit stumm und bewegungslos gehalten werden und sich so für den Betrachter zu einem Bild formieren.“ Ein Lebendes Bild ist ein Phänomen, das zwischen bildender und darstellender Kunst anzusiedeln ist. Es ist eine spezielle Kunst- und Unterhaltungsform, die wie Gemälde oder Plastiken in erster Linie visuell erlebt wird.
Die Schau dieses Vorgangs durch das Publikum ist dabei wesentlicher Bestandteil der Aufführung selbst.
In den Beschreibungen Lebender Bilder sehen wir, dass sie zwei Irritationen beim Kunstbetrachter auslösen. Zum einen werden die zweidimensionalen Figuren aus der Bildenden Kunst durch die Darsteller verkörpert. Dadurch verschwimmen die Grenzen zwischen Darsteller und dargestellter Figur.
Zum anderen fallen die Kunstwerke aus der Bildenden Kunst aus ihrem Rahmen hinein in die Realität des Betrachters. Das Kunstwerk ist nicht weiter Medium, denn seine plastische Darstellung steht nun ganz unvermittelt Auge in Auge mit dem Zuschauer. So werden die Grenzen zwischen Darstellung und Betrachter unscharf.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- I. DIE MODELS
- Lady Emma Hamilton und Mme Henriette Hendel-Schütz
- II. DIE ROMAN-MODELLE
- Goethes 'Die Wahlverwandtschaften' und Hoffmanns 'Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza'
- II.1 Lebende Bilder und Goethes Roman 'Die Wahlverwandtschaften'
- II.1.1 Charakterisierungen von Luciane und Ottilie
- II.1.2 Lucianes,,schöner Rücken"
- II.1.3 Ottilies Marien-Tableau
- II.2 Lebende Bilder und Hoffmanns Erzählung 'Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza'
- II.2.1 Die,,doppelte Sphinx"
- II.2.2 Die heilige Cäzilie
- III. DIE MODELS UND DIE ROMAN-MODELLE - Eine Schlussbetrachtung
- BIBLIOGRAFIE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen von "Lebenden Bildern" als gesellschaftliche Mode des Bürgertums im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Wirkung dieser Kunstform auf die Betrachter und die Rolle der Protagonistinnen Lady Emma Hamilton und Mme Henriette Hendel-Schütz als "Models" und "Stars" der Tableaux.
- Die Wirkung Lebender Bilder auf das Publikum
- Die Rolle von Lady Emma Hamilton und Mme Henriette Hendel-Schütz als "Models"
- Die literarische Reflexion Lebender Bilder in Goethes "Die Wahlverwandtschaften" und Hoffmanns "Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza"
- Der Vergleich von realen Darstellungen und literarischen Roman-Modellen
- Die Grenzen zwischen Darsteller, dargestellter Figur und Betrachter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Lebende Bilder ein und erläutert deren Besonderheiten als Kunst- und Unterhaltungsform. Im ersten Kapitel werden die beiden prominenten "Models" Lady Emma Hamilton und Mme Henriette Hendel-Schütz vorgestellt, ihre Bedeutung für das Genre und die Faszination ihrer Darbietungen beleuchtet. Kapitel II untersucht die literarische Reflexion Lebender Bilder in Goethes "Die Wahlverwandtschaften" und Hoffmanns "Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza" und analysiert, wie die beiden Autoren die "Irritationen" von Darsteller, dargestellter Figur und Betrachter literarisch übersetzen.
Schlüsselwörter
Lebende Bilder, Tableaux Vivants, Lady Emma Hamilton, Mme Henriette Hendel-Schütz, Goethe, Hoffmann, "Die Wahlverwandtschaften", "Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza", Darsteller, dargestellte Figur, Betrachter, Kunst, Literatur, Gesellschaft, Bürgertum, Mode.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "Lebende Bilder" (Tableaux Vivants)?
Es handelt sich um Darstellungen, bei denen reale Personen berühmte Gemälde oder Plastiken stumm und bewegungslos nachstellen.
Wer waren Lady Hamilton und Mme Hendel-Schütz?
Sie waren berühmte "Models" und Stars ihrer Zeit, die durch ihre ausdrucksstarken Darstellungen Lebender Bilder europaweit bekannt wurden.
In welchen literarischen Werken werden Lebende Bilder thematisiert?
Die Arbeit analysiert Goethes "Die Wahlverwandtschaften" und Hoffmanns "Nachricht von den neuesten Schicksalen des Hundes Berganza".
Welche Irritationen lösen Lebende Bilder beim Betrachter aus?
Die Grenzen zwischen zweidimensionaler Kunst und Realität sowie zwischen dem Darsteller und der dargestellten Figur verschwimmen.
Warum war dieses Gesellschaftsspiel im Bürgertum so beliebt?
Es verband Bildung (Kenntnis klassischer Kunst) mit geselliger Unterhaltung und bot eine Bühne für ästhetische Selbstdarstellung.
- Citation du texte
- Michael Kunth (Auteur), 2001, Models und Roman-Modelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13422