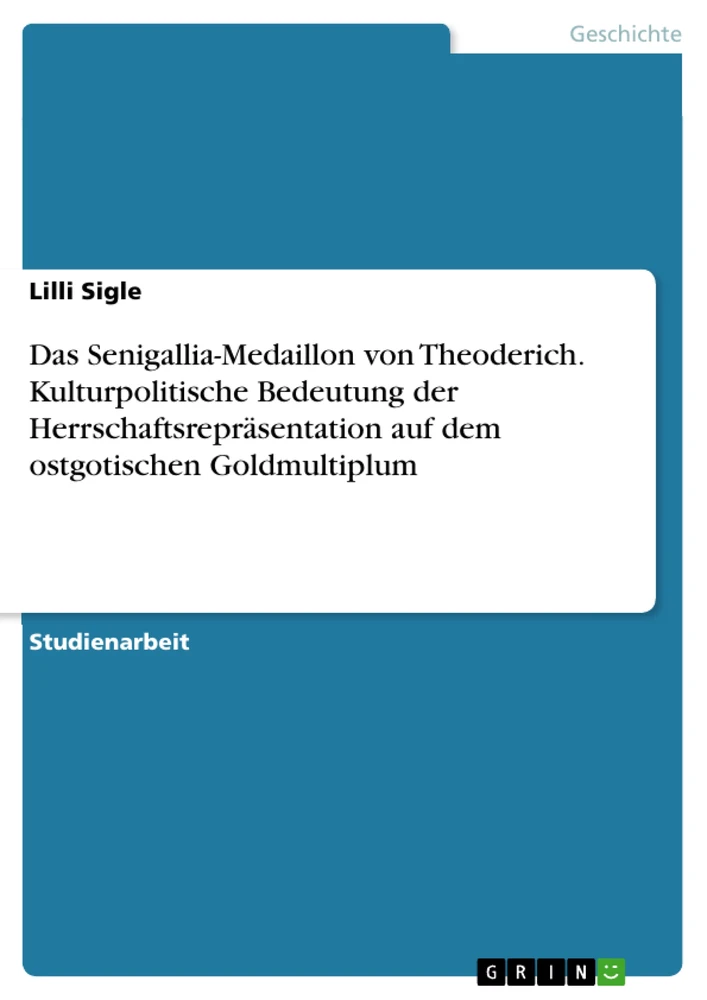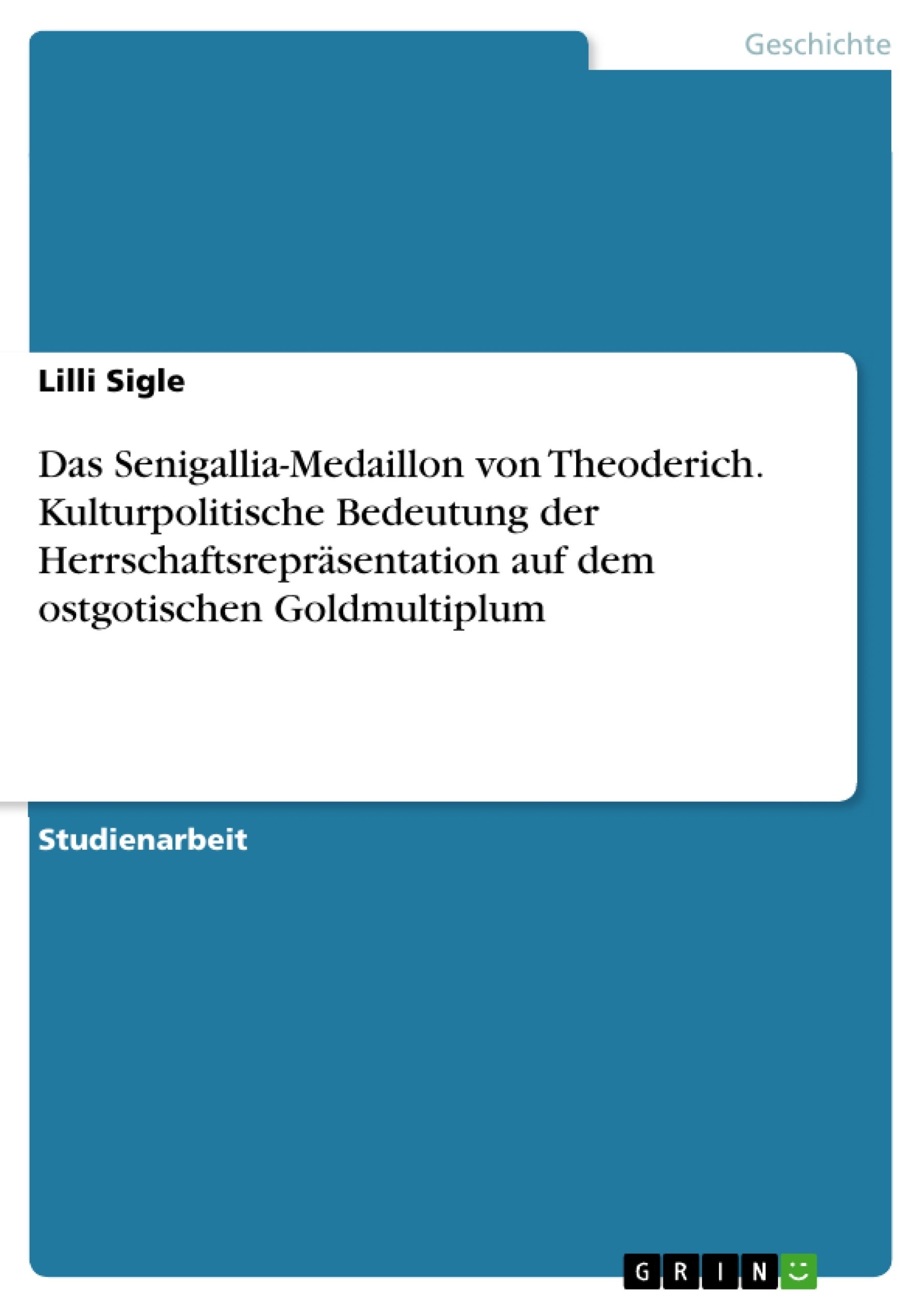Ziel dieser Hausarbeit ist es, herauszuarbeiten, wie sich die Herrschaftsrepräsentation von Theoderich auf dem Senigallia-Medaillon im Spannungsfeld zwischen römischen und gotischen bzw. nicht-römischen Identitäten positionierte. Außerdem wird erforscht, welche Bedeutung seine Darstellungskonventionen im Rahmen des bi- bzw. multiethnischen Ostgotenreiches hatte.
Dafür werden die Abbildungen und die Legende des multiplen Solidus’ im Einzelnen inhaltlich betrachtet. Hierzu wird in der Hausarbeit nach einer allgemeinen Beschreibung des Medaillons, die Kleidung und die Haartracht, mit der Theoderich abgebildet ist, kulturell eingeordnet. Anschließend hinterfragt die Autorin, welche Signifikanz seine Herrschaftsdarstellung für seiner Rolle als gotischer König und als Herrscher über Römer hatte. Der Fokus liegt dabei jeweils auf der gotischen und römischen Oberschicht, da diese das direkte Herrschaftsumfeld Theoderichs bildeten und durch die Quellen besser erfassbar sind.
Als weitere Quellen werden hierzu die "Variae" des Cassiodor, der "Panegyrikus" von Ennodius, "Bellum Gothicum" von Prokop und die Chronik des "Anonymus Valesianus" herangezogen, da diese die wichtigsten Zeugnisse des Ostgotenreichs darstellen. Neben der einschlägigen Literatur zum Gotenkönig, wie der Monografie von Dorothee Kohlhas-Müller, bezieht sich diese Hausarbeit auf Abhandlungen, die soziale, ethnische und gesellschaftliche Aspekte des Ostgotenreiches in den Blick nehmen. Hier sind unter anderem Patrick Amory oder Hans-Ulrich Wiemer zu nennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeine Beschreibung des Goldmultiplums
- Theoderichs Aussehen: Haare und Kleidung
- Theoderich als König einer Kriegergemeinschaft
- Theoderichs imitatio imperii
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der kulturpolitischen Bedeutung des Senigallia Medaillons, einer Goldmünze, die den ostgotischen Herrscher Theoderich darstellt. Ziel der Arbeit ist es, die Herrschaftsrepräsentation Theoderichs auf dem Medaillon im Spannungsfeld zwischen römischen und gotischen Identitäten zu analysieren. Dabei soll untersucht werden, welche Bedeutung die Darstellungskonventionen des Medaillons für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Ostgotenreiches hatten.
- Analyse der kulturellen Bedeutung der Darstellung Theoderichs auf dem Medaillon
- Untersuchung der Rolle des Medaillons im Kontext der Herrschaftsausübung Theoderichs
- Bedeutung des Medaillons für die verschiedenen Bevölkerungsgruppen des Ostgotenreiches
- Bewertung der Herrschaftsrepräsentation Theoderichs im Spannungsfeld zwischen römischen und gotischen Identitäten
- Einordnung des Medaillons in die kulturelle und politische Landschaft des 6. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt das Senigallia Medaillon vor, beschreibt seine Bedeutung als Quelle für die Forschung zum ostgotischen Herrscher Theoderich und benennt die Zielsetzung der Arbeit. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit, die kulturpolitische Bedeutung des Medaillons in den Blick zu nehmen, um die komplexen Beziehungen zwischen Römern und Goten im Ostgotenreich besser zu verstehen.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung des Goldmultiplums, indem es auf seine Materialität, Größe und ikonografischen Merkmale eingeht. Es wird die Bedeutung des Medaillons als Geschenk an gotische Krieger der Oberschicht diskutiert und die Inschrift auf der Münze interpretiert.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel analysiert die Darstellung Theoderichs auf dem Medaillon, indem es seine Kleidung und Haartracht in den Kontext der römischen und gotischen Mode des 6. Jahrhunderts einordnet. Es untersucht die Signifikanz der Kleidung und Haartracht für die Darstellung von Macht und Autorität.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung Theoderichs als König einer Kriegergemeinschaft. Es analysiert die Symbole auf dem Medaillon und deren Bedeutung für die gotische Kriegerkultur. Es wird untersucht, wie Theoderich seine Macht und Herrschaft über die gotische Kriegergemeinschaft auf dem Medaillon präsentiert.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der "imitatio imperii", der Nachahmung des römischen Kaisertums, in Theoderichs Darstellung auf dem Medaillon. Es untersucht, wie Theoderich seinen Anspruch auf die Herrschaft über das weströmische Italien durch die Verwendung römischer Herrschaftssymbole auf dem Medaillon zum Ausdruck bringt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Herrschaftsrepräsentation, Kulturpolitik, Identität, Ostgotenreich, Theoderich, Senigallia Medaillon, römische und gotische Kultur, imitatio imperii, Goldmultiplum, Numismatik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Senigallia-Medaillon?
Es handelt sich um ein seltenes Goldmultiplum (Münze), das den ostgotischen König Theoderich darstellt und als bedeutendes Zeugnis seiner Herrschaftsrepräsentation gilt.
Wie wird Theoderich auf dem Medaillon dargestellt?
Theoderich wird mit einer spezifischen Haartracht und Kleidung abgebildet, die Elemente sowohl der gotischen Kriegerkultur als auch der römischen Herrschaftstradition vereinen.
Was bedeutet „imitatio imperii“ in diesem Zusammenhang?
Es bezeichnet die Nachahmung des römischen Kaisertums durch Theoderich, um seinen Herrschaftsanspruch gegenüber der römischen Bevölkerung und dem Adel zu legitimieren.
An wen richtete sich die Botschaft des Medaillons?
Das Medaillon diente als Repräsentationsmittel gegenüber der gotischen und römischen Oberschicht, die das direkte Umfeld des Königs bildeten.
Welche Rolle spielten die gotischen Krieger für Theoderich?
Theoderich musste sich stets als legitimer Anführer einer Kriegergemeinschaft präsentieren, weshalb das Medaillon auch militärische Stärke und gotische Identität symbolisiert.
- Quote paper
- Lilli Sigle (Author), 2022, Das Senigallia-Medaillon von Theoderich. Kulturpolitische Bedeutung der Herrschaftsrepräsentation auf dem ostgotischen Goldmultiplum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1342663