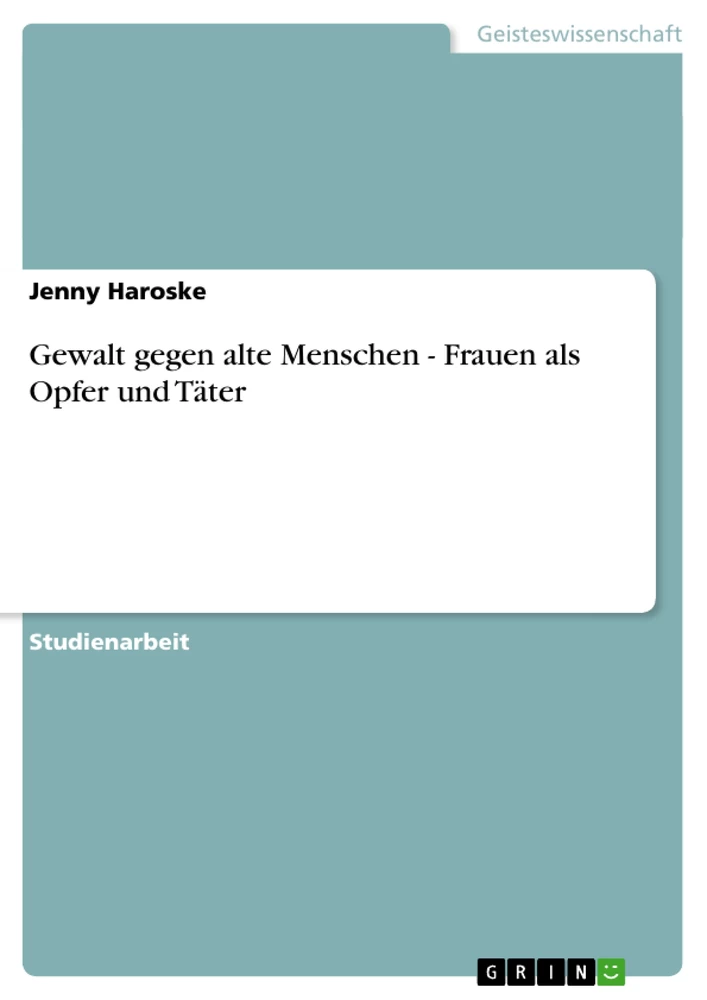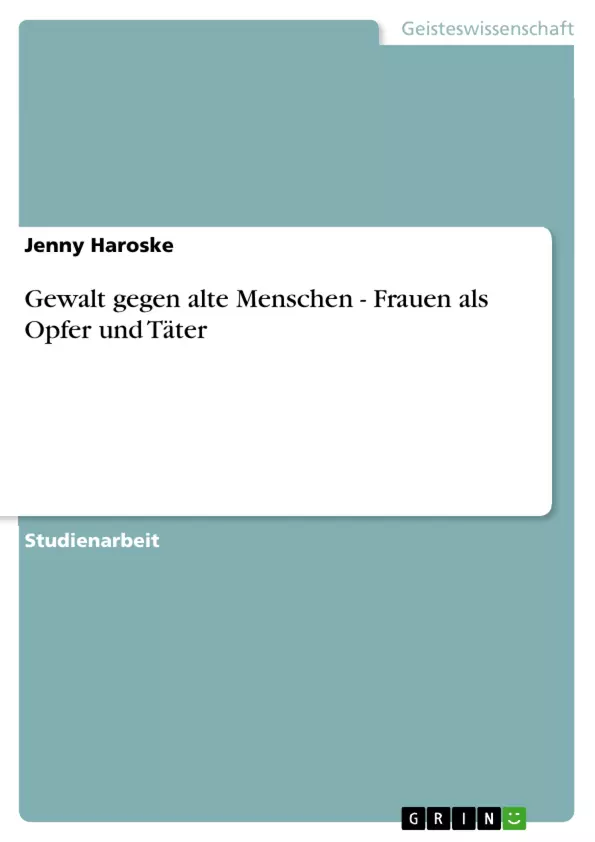Diese Arbeit soll einen Teilbereich der Gerontologie fokussieren, der erst seit den
70er Jahren eine breitere öffentliche Beachtung erfahren durfte.
Die Gewalt gegen ältere Menschen ist in unserer Gesellschaft mit ungleich stärkeren
sozialen Tabuisierungen besetzt als die Gewalt gegen Kinder oder Ehepartner. Dies
schlägt sich schon in so alten Aufzeichnungen wie der Bibel nieder, wo geschrieben
steht: „Du sollst Vater und Mutter ehren“ bzw. „Wer Vater und Mutter schlägt, der soll
des Todes sterben“ (2. Buch Moses, Kap. 21, Verse 15/ 17).
Aufgrund dieser stärkeren Tabuisierung erfuhr das Thema der Altenmisshandlung
sozialwissenschaftlich erst gegen Ende der 70er/ Anfang der 80er Jahre, lange nach
der „Entdeckung“ von Kindes- und Frauenmisshandlung, eine breitere öffentliche
Beachtung. Man kann deshalb mit Berechtigung davon sprechen, dass die Erforschung
dieses sozialen Tatbestandes noch in den Kinderschuhen steckt (Fattah/
Sacco 1989, S. 229); entsprechend ungesichert und streitbar sind auch empirische
Befunde und theoretische Ansätze auf diesem Gebiet.
Nach einer Begriffsdefinition und einführenden Vorstellung dieses Themas im Allgemeinen
möchte ich mich einem Teilaspekt zuwenden, den ich in dieser Art bisher in
keiner Abhandlung finden konnte: der Rolle der Frau beim Auftreten von Beziehungsgewalt
in Generationenbeziehungen.
Zunächst ist also zu betrachten, welchen sozialen Normen, Verpflichtungen und Erwartungen
die Frau in der Familie ausgesetzt ist, welche Rollen sie im Familiengefüge
übernimmt, welchen Benachteiligungen sie unterworfen ist. In engem Zusammenhang
damit steht die Tatsache, dass Frauen sehr viel häufiger Familien- und Pflegearbeiten
nicht nur zugunsten von Betagten auf sich nehmen; ein Phänomen, das von
der zunehmenden Eingliederung der Frau in den Arbeitsmarkt nicht beeinflusst zu
werden scheint.
Einen entscheidenden Einfluss üben hier die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung
zwischen Mann und Frau und die teilweise diametral entgegengesetzten Normen
und Erwartungen an die Geschlechter in der westlichen Industriegesellschaft aus. Ich
möchte dabei versuchen, eine Reihe von typischen Risikofaktoren aufzuzeigen, die
aus der Konstellation der weiblichen Pflegeperson und ihres (oft, aber nicht immer
pflegebedürftigen) älteren Familienmitglieds entstehen können. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1) Gewalt im Alter
- a) Begriffliche Eingrenzung: Gewalt gegen Ältere im sozialen Nahraum
- b) Definition
- c) Empirische Fakten
- 2) Familienbeziehungen und informelle soziale Netzwerke
- a) Definition
- b) Die Rolle der Frau im sozialen Wandel
- c) Feminisierung des Alters
- 3) Gewalt in Pflegebeziehungen
- a) Pflege in Familien durch Frauen
- b) Empirische Fakten
- c) Frauen als „Täter“: Risikofaktoren
- d) Frauen als „Opfer“: Risikofaktoren
- 4) Auswirkungen des gesellschaftlichen Wertewandels auf familiale Pflege
- 5) Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Thema Gewalt gegen ältere Menschen, mit Fokus auf die Rolle der Frau als Opfer und Täter in familiären Pflegebeziehungen. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die spezifischen Herausforderungen und Risiken aufzuzeigen, die mit der zunehmenden Feminisierung des Alters und der traditionellen Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau in diesem Kontext verbunden sind.
- Gewalt gegen ältere Menschen als gesellschaftliches Tabu
- Die Rolle der Frau in der Familie und in Pflegebeziehungen
- Risikofaktoren für Gewalt in Pflegebeziehungen
- Die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wertewandels auf familiale Pflege
- Geschlechtsspezifische Unterschiede des Alters
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Gewalt gegen ältere Menschen. Sie stellt die Bedeutung dieses Themas im Kontext der Gerontologie dar und beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Hintergründe. Im Anschluss werden die Begriffe und Definitionen von Gewalt gegen Ältere im sozialen Nahraum geklärt, gefolgt von einer Darstellung der empirischen Fakten.
Kapitel 2 widmet sich den Familienbeziehungen und den informellen sozialen Netzwerken, insbesondere der Rolle der Frau im sozialen Wandel und der daraus resultierenden Feminisierung des Alters. Das dritte Kapitel fokussiert auf die Gewalt in Pflegebeziehungen, betrachtet die Rolle der Frau als Pflegende und untersucht die Risikofaktoren für Frauen als Täter und Opfer.
Im vierten Kapitel werden die Auswirkungen des gesellschaftlichen Wertewandels auf familiale Pflege beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Gewalt gegen alte Menschen, Familienbeziehungen, Pflegebeziehungen, Feminisierung des Alters, gesellschaftlicher Wertewandel, Risikofaktoren, Frauen als Opfer und Täter.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Gewalt gegen alte Menschen ein Tabuthema?
Gesellschaftliche Normen wie „Du sollst Vater und Mutter ehren“ führen dazu, dass Gewalt im Alter stärker tabuisiert wird als Gewalt gegen Kinder.
Welche Rolle spielen Frauen in der häuslichen Pflege?
Frauen übernehmen den Großteil der Familien- und Pflegearbeit, was sie in eine zentrale Rolle sowohl als potenzielle Opfer als auch als Täterinnen bringt.
Was sind Risikofaktoren für Gewalt in Pflegebeziehungen?
Überlastung der Pflegeperson, mangelnde Unterstützung, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die psychische Belastung durch die Pflegesituation zählen zu den Hauptfaktoren.
Was versteht man unter der „Feminisierung des Alters“?
Dies beschreibt den Umstand, dass Frauen eine höhere Lebenserwartung haben und somit im hohen Alter die Mehrheit der Bevölkerung und der Pflegebedürftigen stellen.
Wie beeinflusst der gesellschaftliche Wertewandel die familiale Pflege?
Veränderte Rollenbilder und die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen kollidieren oft mit traditionellen Erwartungen an die häusliche Pflege.
- Citar trabajo
- Jenny Haroske (Autor), 2000, Gewalt gegen alte Menschen - Frauen als Opfer und Täter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13431