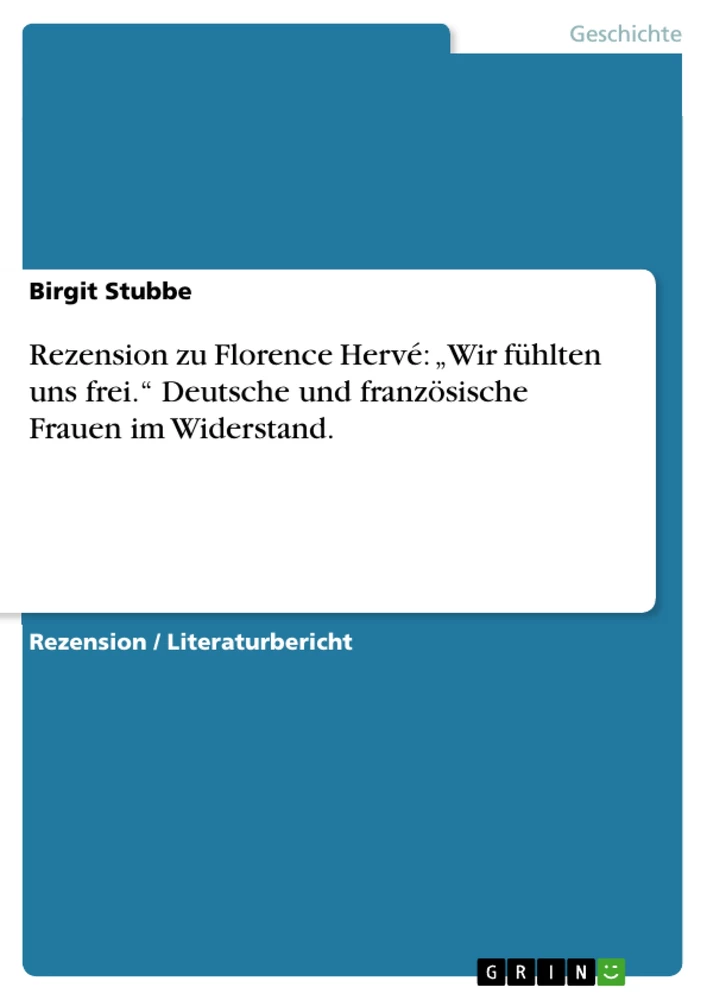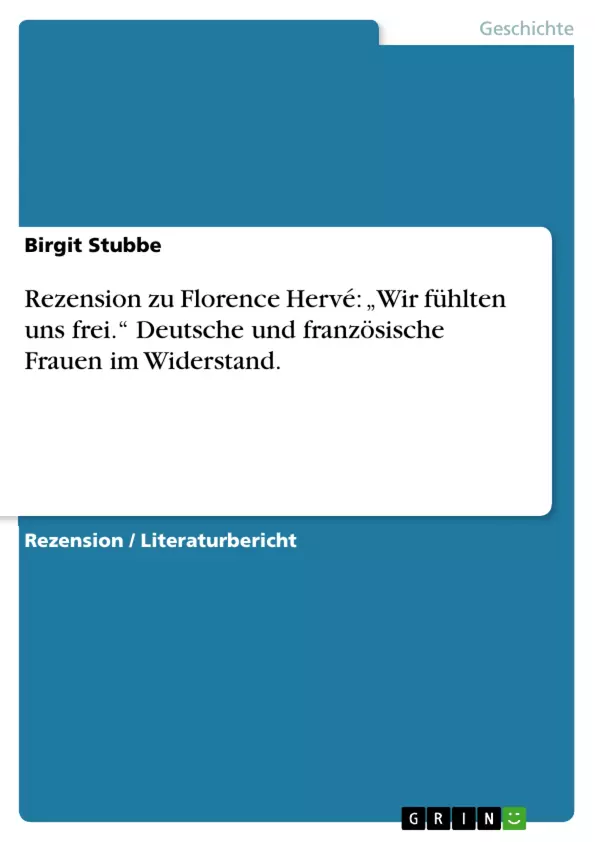Die Bewertung des Widerstandes in der Zeit des Nationalsozialismus wird bis in die heutige Zeit kontrovers diskutiert. So ist allein schon der Begriff WiderstandskämpferIn in Deutsch-land aus kaum begreiflichen Gründen nicht immer positiv konnotiert. Wenn dieses Thema in Deutschland überhaupt behandelt wird, dann meist begrenzt auf einige berühmte Männer und Gruppen. Frauen wird hierbei zumeist höchstens die Rolle der stillen Helferin zugestanden, andere Formen weiblichen Widerstands, wie zum Beispiel auch den an der Waffe, werden lieber verschwiegen. Auch einen Vergleich des Widerstandes der verschiedenen Nationen wird man nur schwerlich finden können. Die Autorin des vorliegenden Werkes, Florence Hervé, ist französische Germanistin und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Ihr kultureller Hintergrund veranlasste die Autorin zu die-sem erstmaligen Vergleich des Widerstands deutscher und französischer Frauen. Ihr Hauptau-genmerk legt Hervé dabei auf die Frage der Motive dieser couragierten Frauen wobei sie auch versucht herauszufinden „Hätte ich es geschafft den aufrechten Gang zu gehen?“ (S. 9) Des-weiteren konzentriert sich die Autorin vor allem auf genderspezifische Fragestellungen: „Gab es einen frauenspezifischen Widerstand gegen Faschismus und Krieg? Wie sahen die Alltags-formen des Frauenwiderstandes aus? Gab es nationalspezifische Varianten und wie war das Verhältnis zur eigenen Nation? Wie gestalteten sich die Geschlechterverhältnisse? Welche Auswirkungen hat der Widerstand auf das Bewusstsein der Frauen gehabt?“ (S.190). Zur Beantwortung dieser Fragen hat Hervé ihr Werk in sechs Unterabschnitte gegliedert. Nach einer recht persönlich konnotierten Einleitung, in der sie auch auf die aktuelle For-schungslage eingeht, widmet die Autorin jeweils ein Kapitel einem kurzen Abriss über den Frauenwiderstand in Deutschland und Frankreich. In diesen Kapiteln geht sie jeweils auf die politische und kulturelle Lage der Frauen unter dem Pétain- bzw. dem Hitler-Regime ein. Darauf folgt die Beschreibung des Widerstandes, der Geschlechterverhältnisse und der Aus-wirkungen des Widerstandes auf die Lage der Frauen in der Nachkriegszeit.
Florence Hervé: „Wir fühlten uns frei.“ Deutsche und französische Frauen im Widerstand. Klartext-Verlag. Essen 1997, 190 Seiten.
Die Bewertung des Widerstandes in der Zeit des Nationalsozialismus wird bis in die heutige Zeit kontrovers diskutiert. So ist allein schon der Begriff Widerstandsk ä mpferIn in Deutsch- land aus kaum begreiflichen Gründen nicht immer positiv konnotiert. Wenn dieses Thema in Deutschland überhaupt behandelt wird, dann meist begrenzt auf einige berühmte Männer und Gruppen. Frauen w ird hierbei z umeist höchstens di e R olle de r s tillen Helferin z ugestanden, andere Formen weiblichen Widerstands, wie zum Beispiel auch den an der Waffe, werden lieber v erschwiegen. Auch einen Vergleich des W iderstandes de r v erschiedenen N ationen wird man nur schwerlich finden können.
Die Autorin des vorliegenden Werkes, Florence Hervé, ist französische Germanistin und lebt seit vielen Jahren in Deutschland. Ihr kultureller Hintergrund veranlasste die Autorin zu die- sem erstmaligen Vergleich des Widerstands deutscher und französischer Frauen. Ihr Hauptau- genmerk legt Hervé dabei auf die Frage der Motive dieser couragierten Frauen wobei sie auch versucht herauszufinden „Hätte ich es geschafft den aufrechten Gang zu gehen?“ (S. 9) Des- weiteren konzentriert sich die Autorin vor allem auf genderspezifische Fragestellungen: „Gab es einen frauenspezifischen Widerstand gegen Faschismus und Krieg? Wie sahen die Alltags- formen de s Frauenwiderstandes a us? Gab e s na tionalspezifische Varianten und wie war da s Verhältnis z ur ei genen Nation? W ie gestalteten sich die G eschlechterverhältnisse? Welche Auswirkungen hat der Widerstand auf das Bewusstsein der Frauen gehabt?“ (S.190).
Zur B eantwortung dieser F ragen hat H ervé ihr Werk in sechs U nterabschnitte gegliedert. Nach einer r echt pe rsönlich konnotierten Ei nleitung, in der s ie auch auf di e aktuelle F orschungslage ei ngeht, widmet d ie Autorin jeweils e in Kapitel einem kurzen A briss übe r de n Frauenwiderstand in Deutschland und F rankreich. In diesen Kapiteln geht sie jeweils auf die politische und kulturelle Lage der Frauen unter dem Pétain- bzw. dem Hitler-Regime ein. Darauf folgt die Beschreibung des Widerstandes, der Geschlechterverhältnisse und der Auswirkungen des Widerstandes auf die Lage der Frauen in der Nachkriegszeit.
Das vierte Unterkapitel dient der Besprechung der Forschungsliteratur und der Rezeptionsge- schichte. Die Autorin beginnt mit dem Abriss „Vom Schweigen zum Historikerstreit“ (S. 88), in dem sie vor allem die Standpunkte der deutschen Historiker Ernst Nolte, Michael Stürmer und Hans Mommsen diskutiert. Im Anschluss daran vergleicht Hervé die verschiedenen lite- rarischen Darstellungen der Widerstandskämpferinnen beider Länder. Hierbei betont sie, dass diese i n Frankreich als H eldinnen v erehrt w orden s eien. I n de n be iden Teilen Deutschlands jedoch hätten die W iderstandskämpferinnen fast ke ine Er wähnung gefunden. I n de r D DR hätte eine (zumeist m ännliche) Heroisierung de s kom munistischen Widerstandes stattgefunden, während der Widerstand in der BRD fast gänzlich verschwiegen worden wäre. In einem späteren Stadium h ätte da nn eine s äuberliche D ifferenzierung s tattgefunden. Als B eispiel hierfür dient der Autorin eine Rede des Altbundeskanzlers Helmut Kohl von 1994: „die Männer des 20. Juli wurden hiermit offiziell als die eigentlichen Widerstandskämpfer erklärt, die Bundeswehr als Nachfolgerin des Widerstands“ (S. 92).
Einen Schwerpunkt dieses Kapitels bilden die verschiedenen Arten der D arstellung i n der deutschen und fra nzösischen L iteratur, d ie di e A utorin v orstellt, diskutiert u nd vergleicht. Hierbei verfolgt sie de n Gang de r Literatur von de r unmittelbaren Nachkriegszeit bis i n die 90er Jahre. Direkt nach Kriegsende seien vor allem (auto-)biographische Berichte von überle- benden Frauen erschienen. Von diesen vergleicht H ervé zwei miteinander (Denise Dufour- nier: Le maison des mortes Ravensbr ü ck und Lina Haag: Eine Hand voll Staub), indem sie sie auf die genannten Motive und auf die Darstellung der Geschlechterbeziehungen abklopft. Im weiteren Verlauf ihrer Untersuchung urteilt sie, dass de r Kalte Krieg ke ine gute Zeit f ür die A ufarbeitung de r G eschichte des F rauenwiderstands gewesen sei. S o seien i n de n 50er und 60e r J ahren Frauen fast völlig unberücksichtigt geblieben. In de n 70e r und 8 0er J ahren hätte es z war i n beiden Ländern nicht v iel be sser aus gesehen, „das N eue an dieser Z eit i st aber, im Zusammenhang mit der neuen Frauenbewegung, eine Aneignung der eigenen Ge- schichte und e in Bewusstwerden der weiblichen Identität der Frauen“ (S. 109). Hier sei nun damit begonnen worden die Vielfalt des Widerstands in beiden Ländern darzustellen, anstatt der Hervorhebung einiger weniger Frauen. In der allgemeinen deutschen Literatur dieser Zeit seien Frauen aber nach wie vor kaum berücksichtigt worden. Zwei positive Ausnahmen, die Hervé hi er v orstellt s ind die A rbeiten von Hanna El ling ( Frauen im de utschen Widerstand, 1978) und Gerda Szepansky (Frauen leisten Widerstand, 1985), die beide für ein breites Pub- likum bestimmt waren. Erst in den 90er Jahren jedoch sei in beiden Ländern der Frauenwider- stand im universitären und wissenschaftlichen Rahmen untersucht und das Geschlechterver- hältnis thematisiert worden. Hervé bezieht sich hier vor allem auf Christl Wickert (z.B. Frau- en g egen di e D iktatur, T agungsband v on 1995) und auf di e A nalysen de r Z eitschrift C LIO von 1995.
Die letzten beiden Kapitel könnten als Hervés Fazit gelesen werden. Das fünfte fasst die Er- gebnisse de s de utsch-französischen Vergleichs z usammen. Hierbei z eigt s ich, dass e s z wi- schen dem Widerstand in Deutschland und in Frankreich sowohl Konvergenzen als auch Di- vergenzen gab. So schreibt sie „in beiden Ländern beteiligten sich Frauen an allen Formen des Widerstandes. (…) Z wischen den beiden Ländern sind jedoch Unterschiede festzustellen, im Umfang und in der Art der Teilnahme und was den Zeitraum angeht“ (S. 119). Dies ist auch bei de r B eschreibung de r s ozialen H erkunft de r Fall. S o s eien z war i n b eiden Ländern di e meisten Widerstandskämpferinnen aus de r A rbeiterklasse g ekommen, jedoch hätte es i n Frankreich vermehrt auch Frauen aus der Mittelschicht und sogar aus dem Großbürgertum in die R ésistance g ezogen. Für i hren Vergleich der l iterarischen D arstellung z ieht d ie A utorin unter anderem auch die deutsche und französische Memoirenliteratur heran und stell fest, dass der „ Freiheitsbegriff in Frankreich viel öfter erwähnt [wird] als in Deutschland; in Deutsch- land dagegen die `Pflicht´“ (S. 125). Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem „Einfluss der Geschichte, der g esellschaftlichen Verhältnisse, der pa triarchalischen Strukturen und der Frauenbewegung“ (S. 129). Hier w iederholt s ie, da ss da s pol itische, soziale und kul turelle Umfeld seinen Teil dazu beigetragen hätte, ob sich eine Frau aktiv am Widerstand beteiligte oder nicht.
Das W erk Hervés bi etet e inen er stmaligen Vergleich des Frauenwiderstandes i n Frankreich und in Deutschland. Hierbei stellt die Beschreibung der historischen, kulturellen und sozialen Situationen dieser Frauen einen guten Überblick dar und trägt zum Verständnis der verschie- denen Entwicklungen in den be iden Ländern bei. Allerdings ent hält di eses Werk auch zwei Defizite: D as er ste ist, das kaum a uf di e w ichtige A rbeit de utscher Frauen i n de r fra nzösi- schen Résistance (Deutsche Arbeit, Travail alemand) eingegangen wird, sondern jede Nation abgesondert für sich beschrieben wird. Das zweite Defizit ist die ungenügende Beschäftigung mit der Situation in der ehemaligen DDR. Es wird zwar kurz erwähnt, dass hier eine Heroisie- rung de s kom munistischen W iderstandes s tattgefunden h abe, j edoch w ird a nsonsten ni cht weiter darauf eingegangen, sondern im weiteren Verlauf immer generalisierend von den „bei- den L ändern“ - Deutschland und Frankreich - gesprochen. Diese D efizite w erden jedoch durch die umfangreiche Darstellung der Literatur wieder ausgeglichen, da sie zum Weiterle- sen anregen und de n Gang de r Forschung, m it a llen U mwegen, w iderspiegeln. D ieses Buch ist da her ni cht nur für i nteressierte Laien, s ondern v or a llem a uch für F achkundige a us de n Bereichen der Geschichte und der Gender Studies zu empfehlen, da es auch in diesen Diszip- linen noch große Lücken zum Thema des Frauenwiderstands gibt. So findet man bei der Re- cherche meist Memoiren- und Gedenkliteratur, wissenschaftliche Darstellungen über die ver- schiedenen Formen des Frauenwiderstands sind hingegen nur spärlich gesät.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Wer ist Florence Hervé?
Florence Hervé ist eine französische Germanistin und Autorin, die Pionierarbeit beim Vergleich des Widerstands deutscher und französischer Frauen im Zweiten Weltkrieg geleistet hat.
Gab es einen spezifisch weiblichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus?
Ja, Frauen leisteten Widerstand in vielen Formen – von Alltagsverweigerung und dem Verstecken von Verfolgten bis hin zum bewaffneten Kampf in der Résistance.
Wie unterscheidet sich die Erinnerung an Widerstandskämpferinnen in DE und FR?
Während Widerstandskämpferinnen in Frankreich oft als Heldinnen verehrt wurden, wurden sie in Deutschland (sowohl BRD als auch DDR) lange Zeit kaum erwähnt oder nur auf die Rolle stiller Helferinnen reduziert.
Welche Motive hatten Frauen für den Widerstand?
Die Motive waren vielfältig: politische Überzeugung (oft kommunistisch oder sozialistisch), religiöser Glaube, moralische Empörung oder der Wunsch nach Freiheit.
Was kritisiert die Autorin an der bisherigen Forschung?
Sie kritisiert die männliche Heroisierung des Widerstands und die Tatsache, dass die Leistungen von Frauen oft verschwiegen oder als zweitrangig dargestellt wurden.
- Quote paper
- Birgit Stubbe (Author), 2009, Rezension zu Florence Hervé: „Wir fühlten uns frei.“ Deutsche und französische Frauen im Widerstand., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134312