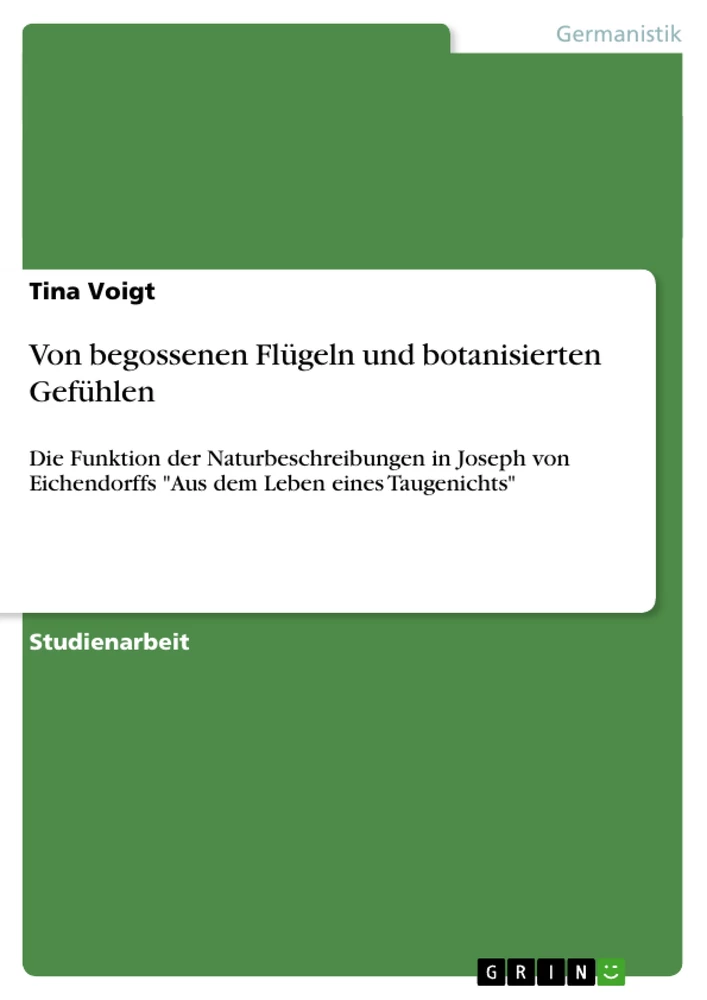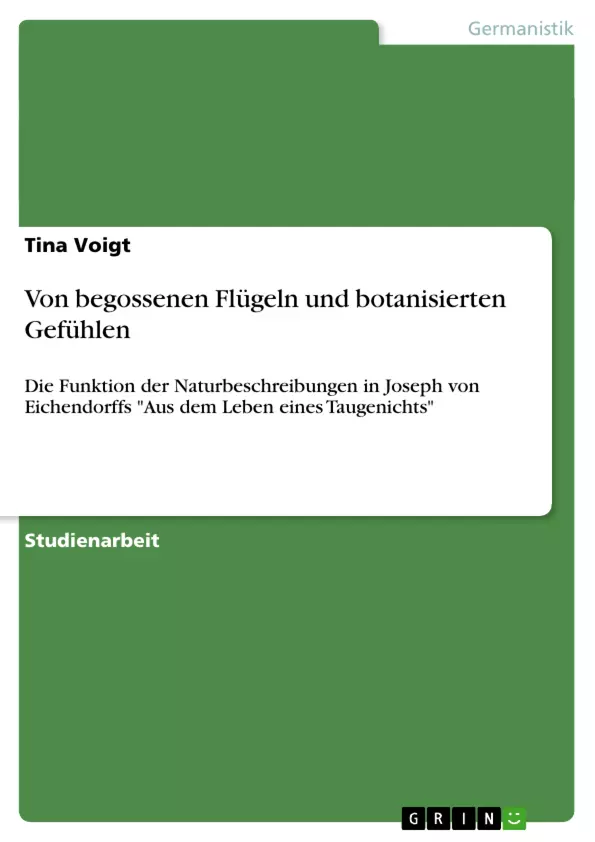Mondschein, Morgenkühle und Nachtmusik. Gärten, Gräser und Gesträuch. Grüne Wiesen, klare Luft und schimmernde Landschaften. Schönste Blumen, lustig singende Vögel und prächtige Sonnenaufgänge – all das sind Bilder, die man ohne Zögern mit dem romantischen Dichter Freiherr Joseph von Eichendorff in Verbindung bringt, ohne jedoch sagen zu können, aus welchem seiner Werke sie wohl stammen mögen. Eichendorff wurde daher zeitlebens und bis heute oft kritisiert, dass er in seiner bilderreichen und einfachen Sprache, bestehend aus immer wiederkehrenden Motive, sehr einförmig erzählt. Jahn geht soweit, die These aufzustellen, dass Eichendorffs Stereotypität in diesem Ausmaß in der gesamten neueren deutschen Prosaliteratur noch ihresgleichen suche und spricht sogar despektierlich von einer „angeborenen Formulierungsarmut“. Und tatsächlich stößt man auch in der Erzählung „Aus dem Leben eines Taugenichts“ auf zahlreiche Lieblingsformulierungen und Motive Eichendorffs. Doch nicht nur mit dem Autor wird hart ins Gericht gegangen, von Wilpert macht auch den Literaturwissenschaftlern einen Vorwurf, denn „Diese ganze Zeit einer höchst vordergründigen, unreflektierten Eichendorff- und „Taugenichts“-Verehrung, der es eben nicht auf eine werkgerechte Interpretation, sondern nur auf einen Appell ans Emotionale ankam, weil sie wußte, dass die deutsche Volksseele für Wälder, Auen und Nachtigallen anfällig ist, hat im Grund dem echten Verständnis des „Taugenichts“ viel stärker geschadet als genützt, ja, sie hat ihn geradezu abgenutzt und für Jahrzehnte den echten Zugang mit Phrasen und Vorurteilen verbarrikadiert.“ Trotz dieser Gefahr möchte ich mich in den Kanon der Interpretationen einreihen und versuchen einen „echten Zugang“ zu finden, der über die gängigen Eichendorff-Vorurteile hinausgeht. Zwei Motive werden dabei im Fokus der Arbeit liegen: Zum einen die auffällig hohe Frequenz an Vogelnennungen und Vogelvergleichen. Es gilt also zu klären, warum die Vögel omnipräsent sind und sich als ideale Vergleichsobjekte für den Charakter des Protagonisten anbieten. In einem zweiten Schritt wird dann gezeigt, dass die sehr nahe liegende Lesart der Vögel als Repräsentanten und Projektionsflächen für die seelischen Zustände des Taugenichts ihre Deutungsmöglichkeiten bei weitem nicht ausschöpft, sondern dass sie viel mehr eine tiefere Bedeutung haben, die in engem Zusammenhang mit Eichendorffs Religionsverständnis und seiner Mythenaffinität stehen. [...]
INHALTSVERZEICHNIS
1 Einleitung
2 Die Natur als Spiegel der Seele
2.1 Eichendorffs Gartenbeschreibungen
2.1.1 Gärten und Landschaften
2.1.2 Die Blume als Sonderform des Gartens
2.2 Die Vögel im Werk
2.2.1 Vögel als Stimmungsrepräsentanten
2.2.2 Vögel als religiöse Symbole
3 Schlussbetrachtung
4 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Mondschein, Morgenkühle und Nachtmusik. Gärten, Gräser und Gesträuch. Grüne Wiesen, klare Luft und schimmernde Landschaften. Schönste Blumen, lustig singende Vögel und prächtige Sonnenaufgänge – all das sind Bilder, die man ohne Zögern mit dem romantischen Dichter Freiherr Joseph von Eichendorff in Verbindung bringt, ohne jedoch sagen zu können, aus welchem seiner Werke sie wohl stammen mögen.[1] Eichendorff wurde daher zeitlebens und bis heute oft kritisiert, dass er in seiner bilderreichen und einfachen Sprache, bestehend aus immer wiederkehrenden Motiven[2], sehr einförmig erzählt. Jahn geht soweit, die These aufzustellen, dass Eichendorffs Stereotypität in diesem Ausmaß in der gesamten neueren deutschen Prosaliteratur noch ihresgleichen suche[3] und spricht sogar despektierlich von einer „angeborenen Formulierungsarmut“.[4] Und tatsächlich stößt man auch in der Erzählung „Aus dem Leben eines Taugenichts“ auf zahlreiche Lieblingsformulierungen und Motive Eichendorffs.
Doch nicht nur mit dem Autor wird hart ins Gericht gegangen, von Wilpert macht auch den Literaturwissenschaftlern einen Vorwurf, denn
„Diese ganze Zeit einer höchst vordergründigen, unreflektierten Eichendorff- und „Taugenichts“-Verehrung, der es eben nicht auf eine werkgerechte Interpretation, sondern nur auf einen Appell ans Emotionale ankam, weil sie wußte, dass die deutsche Volksseele für Wälder, Auen und Nachtigallen anfällig ist, hat im Grund dem echten Verständnis des „Taugenichts“ viel stärker geschadet als genützt, ja, sie hat ihn geradezu abgenutzt und für Jahrzehnte den echten Zugang mit Phrasen und Vorurteilen verbarrikadiert.“[5]
Trotz dieser Gefahr möchte ich mich in den Kanon der Interpretationen einreihen und versuchen einen „echten Zugang“[6] zu finden, der über die gängigen Eichendorff-Vorurteile hinausgeht. Zwei Motive werden dabei im Fokus der Arbeit liegen: Zum einen die auffällig hohe Frequenz an Vogelnennungen und Vogelvergleichen.[7] Es gilt also zu klären, warum die Vögel omnipräsent sind und sich als ideale Vergleichsobjekte für den Charakter des Protagonisten anbieten. In einem zweiten Schritt wird dann gezeigt, dass die sehr nahe liegende Lesart der Vögel als Repräsentanten und Projektionsflächen für die seelischen Zustände des Taugenichts ihre Deutungsmöglichkeiten bei weitem nicht ausschöpft, sondern dass sie viel mehr eine tiefere Bedeutung haben, die in engem Zusammenhang mit Eichendorffs Religionsverständnis und seiner Mythenaffinität stehen.
Gerade in der Novelle des Taugenichts, die vom Protagonisten selber aus Ich-Erzählersicht und damit höchst subjektiv erzählt wird, tritt die Funktion der Naturbeschreibung als Spiegel der Seele besonders zu Tage. Die Arbeit wird zunächst zeigen, an welchen Stellen der Taugenichts seine Seelenregungen direkt und indirekt in die Natur projiziert. Dabei wird man sehen können, dass Eichendorffs orts- und zeitlose Naturbeschreibungen mehr sind als nur Phrasen aus dem Baukasten des romantischen Sprachinventars, die scheinbar beliebig zusammengesetzt werden können und dabei völlig austauschbar sind.[8] Im Mittelpunkt der Betrachtung wird dabei die Blumenmotivik stehen und bewiesen werden, dass Blumen für den Taugenichts eine besondere Bedeutung haben, die über ihre inhaltliche Funktion als Repräsentanten von Stimmungen hinausgeht.
Die Quellenlage ist aufgrund der Popularität der Novelle[9] und ihrer Zugehörigkeit zum Kanon der Deutschen Literatur sehr üppig und es gibt unzählige Interpretationsansätze und sehr viel Sekundärliteratur. Die Seitenangaben in eckigen Klammern beziehen sich auf die im Literaturverzeichnis näher erläuterte Werkausgabe.[10]
2 Die Natur als Spiegel der Seele
Die stereotype Naturbeschreibung Eichendorffs wird in der Sekundärliteratur ebenso oft erwähnt wie kritisiert. Sie gilt als charakteristisch für seinen Stil, aber auch für die allgemeine Natursehnsucht der romantischen Dichter. Gerade im spätromantischen Werk „Aus dem Leben eines Taugenichts“ wird seine idyllische Naturbeschreibung oft als Höhepunkt der Romantik und des Schwärmens abgetan, ohne eine tiefere Bedeutung in ihr zu sehen. Allerdings muss man Eichendorff bei all der stilistischen Kritik, die ihm zuteil wird, in Schutz nehmen, denn die Romantiker hatten nicht den Anspruch einer mimetischen Naturnachahmung, sondern arbeiten vielmehr an der „Erzeugung einer eigenen Wirklichkeit“[11], was Eichendorff, wie man sehen wird, auch gelingt.
Als Romantiker gestaltet Eichendorff die Landschaften natürlich an vielen Stellen nach dem antiken Vorbild des locus amoenus. Nur allzu oft findet man paradiesähnliche Zustände mit plätschernden Bächen, satten Wiesen, grünen Wäldern und zwitschernden Vögeln. Darüber hinaus benutzt er die Natur jedoch auch zur Verbildlichung von Seelenzuständen. Gleich zu Beginn der Novelle, als den Taugenichts die Wanderlust packt, findet man im Landschaftsbild auch seine Stimmung wieder. Die Adjektive, die gleich einer Filmmusik die Atmosphäre der Szene prägen, sind durchweg positiv konnotiert: Das Rad der nicht näher beschrieben Mühle des Vaters rauscht „recht lustig“ [S.85] und der Schnee tröpfelt „emsig“ [S.85]. Beides Attribute, die der Taugenichts aus seiner Stimmung heraus diesen unbelebten Dingen zuschreibt, denn genauso hätte er das Mühlrad ,monoton’ oder ,beständig’ rauschen und den Schnee ,trostlos’ tröpfeln lassen können - Adjektive, die sofort eine ganz andere Stimmung erzeugt hätten. Auch die Goldammer, die im Winter[12] noch „betrübt“ [S.85] sang, singt nun „ganz stolz und lustig“[S.85]. Als er aufbricht und ihm „wie ein ewiger Sonntag im Gemüte“ [S.86] ist, zieht er in das „freie Feld“ [S.86] hinaus - auch hier findet man das selbe Phänomen, denn aus seiner momentanen Gemütslage der Unbeschwertheit heraus, in der er das Fortwandern von allen Alltagspflichten als Befreiung empfindet, tituliert er das Feld als ,frei’. Hätte er gerade einen Anflug von Melancholie, in dem er die Welt dann als „entsetzlich weit“ [S.116] erlebt, sich klein und unbedeutend und „so ganz allein darin“ [S.116] vorkommt, hätte er das Feld sicherlich mit einem Adjektiv wie ,einsam’ und ,leer’ oder eben ,entsetzlich weit’ beschrieben. Beispiele dieser Art findet man zuhauf, besonders durch die Eigenart Eichendorffs unbelebten Dingen Adjektive wie zum Beispiel ,fröhlich’ und ,lustig’ zuzusprechen, die eigentlich auf Menschen zutreffen. Eichendorff lässt also den Taugenichts seine Umwelt personifizieren und ermöglicht damit seinem eher unreflektierten Protagonisten, seine Gefühle einfacher zu verbalisieren.
[...]
[1] Alle diese Bilder kommen allein im „Taugenichts“ mehrfach vor. Als Zeichen ihrer Austauschbarkeit sind sie jedoch nicht als direkte Zitate gekennzeichnet, denn man findet sie (zum Teil in leichten Variationen) auch in nahezu jedem anderen Werk Eichendorffs.
[2] Eichendorff war sich dieser Anschuldigungen durchaus bewusst. Er stimmte sogar dem Vorwurf Graf von Loebens als „sehr wahr“ zu, als dieser anlässlich des Romans „Ahnung und Gegenwart“ eines von Eichendorffs Lieblingsmotiven, „das ständige Auf-die-Bäume-Klettern der Eichendorffschen Helden“ (Vgl. Jahn, Eichendorffs Prosastil, S. 93) in einem Brief an Eichendorff bemängelte. Nichtsdestotrotz hat Eichendorff dieses Motiv auch in seinen späteren Dichtungen weiterhin häufig verwendet.
[3] Vgl. Jahn, Eichendorffs Prosastil, S. 93. Allerdings ist ihre Untersuchung von 1937 und ihre These daher möglicherweise mittlerweile veraltet.
[4] Jahn, Eichendorffs Prosastil, S. 97.
[5] von Wilpert, Der ornithologische Taugenichts, S. 279.
[6] Ebd. S.279.
[7] Nach meiner Zählung ist auf fast jeder zweiten Seite (auf 43 von 98 Seiten) eine Form des Wortes „Vogel“ oder eine (artenspezifische) Variation zu finden.
[8] Auf das dichtungstheoretische Konzept der Welt als eine Chiffrenschrift und der Natur als eine Hieroglyphe Gottes wird aus Platzgründen nicht näher eingegangen. Eine ausführliche Abhandlung des Themas, auch bezogen auf den Autor Eichendorff findet man z.B. bei Goodbody, Natursprache.
[9] Eichendorff bezeichnet seine Erzählung als eine Solche. Auf die viel diskutierte Gattungsfrage soll in dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden (vgl. u.a: Schau, Märchenformen bei Eichendorff, S.94-118.).
[10] Schultz, Hartwig (Hrsg.): Joseph von Eichendorff. Sämtliche Erzählungen. Stuttgart 1990. Philipp Reclam jun. GmbH & Co.
[11] Blumenberg, zit.nach: Kremer, Prosa der Romantik, S. 46.
[12] Auf die Bedeutung der Jahreszeiten für die Stimmung des Taugenichts, kann im Rahmen dieser Arbeit leider nicht näher eingegangen werden. Es bleibt verkürzt zu sagen, dass seine Wanderlust und seine innere Unruhe eng mit den Anzeichen des Frühlings korrelieren.
- Citation du texte
- Tina Voigt (Auteur), 2008, Von begossenen Flügeln und botanisierten Gefühlen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134337