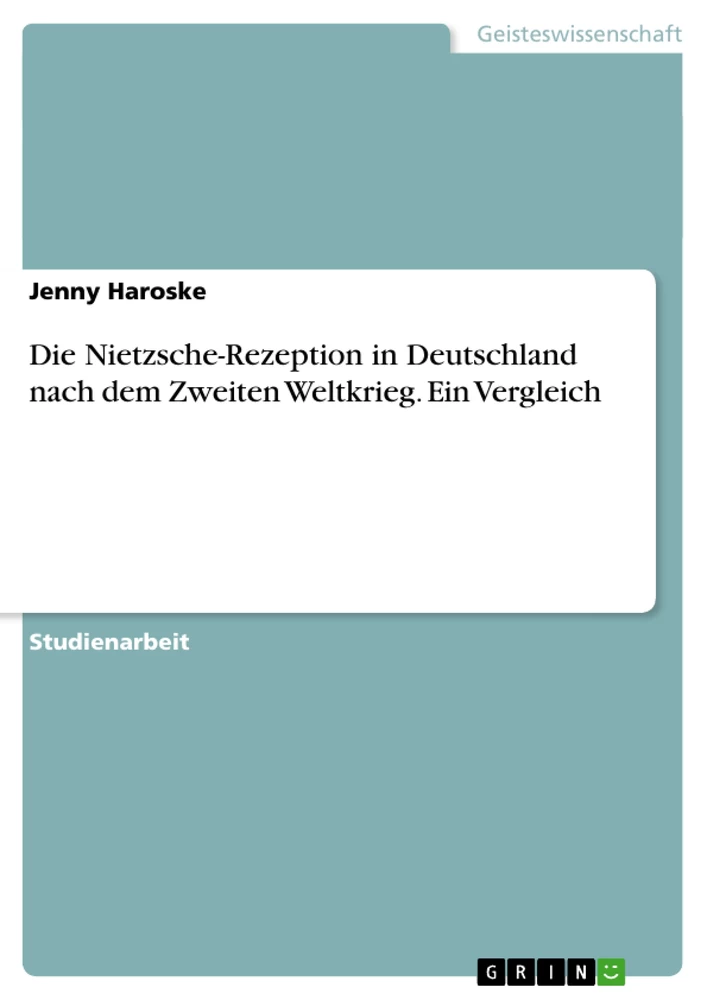„Philologie nämlich ... lehrt gut lesen, das heißt langsam, tief-, rück- und vorsichtig,
mit Hintergedanken, mit offen gelassenen Türen, mit zarten Fingern und Augen lesen...
Meine geduldigen Freunde, dies Buch wünscht sich nur vollkommne Leser und
Philologen: lernt mich gut lesen!“ (Vorrede zur „Morgenröthe“, aus: K. Löwith, Nietzsches
Philosophie der ewigen Wiederkehr des Gleichen, S. 23)
„Ihr sagt, ihr glaubt an Zarathustra? Aber was liegt an Zarathustra! Ihr seid meine
Gläubigen: aber was liegt an allen Gläubigen! Ihr hattet euch noch nicht gesucht: da
fandet ihr mich. So tun alle Gläubigen; darum ist es so wenig mit allem Glauben.
Nun heiße ich euch, mich verlieren und euch finden; und erst, wenn ihr mich Alle
verleugnet habt, will ich euch wiederkehren.“ (F. Nietzsche, „Also sprach Zarathustra“,
S. 114f.)
Durch Nietzsches gesamtes Werk zieht sich dieser eine rote Faden: die Ermahnung
zum Mißtrauen, zum kritischen Lesen, zum Selber - denken, die beharrliche Abwehr
jeglicher Interpretations- und damit Vereinnahmungsversuche. Nietzsche stellte sich
mit erhobenem Zeigefinger vor jedes seiner Bücher und wurde nicht müde, vor sich
selbst zu warnen: Glaubt mir nicht! Hat es etwas genützt? Die meisten seiner Leser
waren doch „menschlich - Allzumenschlich“ und brachten es zuwege, Nietzsche für
so unterschiedliche Bewegungen wie Anarchismus und Konservatismus, Nazismus
und Marxismus, Vegetarismus und Freikörperkultur zu vereinnahmen und als Mythos
auf ihren Altar zu stellen (S. Aschheim, Nietzsche und die Deutschen, S. 7).
Das Schwergewicht in der Nietzsche - Beurteilung hat sich dabei im Laufe der Jahre
immer wieder verlagert - lag es anfangs bei der Anerkennung bzw. Verdammung
des (Im)- Moralisten, wurde es im ersten Weltkrieg zur mythisierten Zarathustra -
Verehrung der jungen Leser, verzerrte sich zu einer grotesken Nietzsche-Karikatur
im Dritten Reich und mündet nach 1945 in der BRD in einer „Anerkennung“ Nietzsches
als Vollender der Metaphysik des Abendlandes (K. Löwith, Nietzsche - Zeitgemäßes
und Unzeitgemäßes, Vorwort).
Unbestritten hat Nietzsches Denken und literarische Produktion einen nicht wegzudenkenden
Einfluß auf die gesamteuropäische Literatur und Denkweise ausgeübt
und das Gesicht des 20. Jahrhunderts entscheidend mit geprägt. Eher selten ist es
dagegen zu verzeichnen, daß sich jemand ohne Wertmaßstäbe und Vorurteile gedanklich
mit Nietzsches Werk auseinandergesetzt hätte. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I) Karl Löwith
- 1) Zur Person
- 2) Zu Nietzsche
- 3) Zum Werk
- 4) Zur Kritik
- 5) Zur Schuldfrage
- 6) Fazit
- II) Georg Lukács
- 1) Zur Person
- 2) Zu Nietzsche
- 3) Zu Werk und Kritik
- 4) Zur Schuldfrage
- 5) Fazit
- III) Thomas Mann
- 1) Zur Person
- 2) Zu Nietzsche
- 3) Zu Werk und Kritik
- 4) Zur Schuldfrage
- 5) Fazit
- IV) Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Rezeption von Friedrich Nietzsches Werk in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg anhand von drei prominenten Autoren: Karl Löwith, Georg Lukács und Thomas Mann. Die Analyse untersucht, wie diese Autoren Nietzsches Philosophie interpretierten und welche Bedeutung sie ihm in Bezug auf die deutsche Geschichte und die Schuldfrage zuschrieben.
- Die unterschiedlichen Interpretationen Nietzsches durch die drei Autoren
- Die Frage nach der Verantwortung Nietzsches für die Missinterpretationen seiner Philosophie im Nationalsozialismus
- Die Rolle Nietzsches in der deutschen Geschichte und seine Relevanz für die deutsche Identität
- Die Herausforderungen der Interpretation von Nietzsches Werk und die Gefahr der Vereinnahmung
- Die Bedeutung von kritischem Lesen und Selbstdenken in Bezug auf Nietzsches Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Nietzsche-Rezeption nach dem Zweiten Weltkrieg ein und stellt die drei Autoren Karl Löwith, Georg Lukács und Thomas Mann als Fallbeispiele vor. Sie beleuchtet den Einfluss von Nietzsches Werk auf das 20. Jahrhundert und die Schwierigkeiten, seine Philosophie unvoreingenommen zu interpretieren.
Das erste Kapitel konzentriert sich auf Karl Löwith und analysiert seine Interpretation von Nietzsches Philosophie. Es untersucht Löwiths Kritik an Nietzsche und seine Auseinandersetzung mit der Schuldfrage.
Das zweite Kapitel widmet sich Georg Lukács und analysiert seine Rezeption von Nietzsche im Kontext der marxistischen Theorie. Es untersucht Lukács' Kritik an Nietzsche und seine Perspektive auf die Schuldfrage.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Thomas Mann und untersucht seine Rezeption von Nietzsche in seinen literarischen Werken. Es analysiert Manns Interpretation von Nietzsches Philosophie und seine Position zur Schuldfrage.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Nietzsche-Rezeption, deutsche Geschichte, Schuldfrage, Verantwortung, Interpretation, Philosophie, Literatur, Karl Löwith, Georg Lukács, Thomas Mann, und den spezifischen Interpretationen und Auseinandersetzungen dieser Autoren mit Nietzsches Werk.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde Nietzsche nach 1945 in Deutschland bewertet?
Nach dem Missbrauch seiner Philosophie im Dritten Reich bemühten sich Autoren wie Löwith, Lukács und Mann um eine kritische Neubewertung seiner Rolle in der Geistesgeschichte.
Trägt Nietzsche Schuld am Nationalsozialismus?
Die Arbeit untersucht die 'Schuldfrage' und zeigt, wie Nietzsche für Zwecke vereinnahmt wurde, vor denen er in seinen eigenen Schriften (z.B. Zarathustra) ausdrücklich warnte.
Wie interpretierte Karl Löwith Nietzsches Philosophie?
Löwith sah in Nietzsche den Vollender der abendländischen Metaphysik und analysierte kritisch die Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleichen.
Was war Georg Lukács' Sicht auf Nietzsche?
Aus marxistischer Perspektive kritisierte Lukács Nietzsche als Wegbereiter einer irrationalistischen Zerstörung der Vernunft.
Welche Rolle spielt Thomas Mann in der Nietzsche-Rezeption?
Thomas Mann setzte sich literarisch und essayistisch mit der Ambivalenz von Nietzsches Denken zwischen Genie und politischer Gefahr auseinander.
- Citar trabajo
- Jenny Haroske (Autor), 1999, Die Nietzsche-Rezeption in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein Vergleich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13433