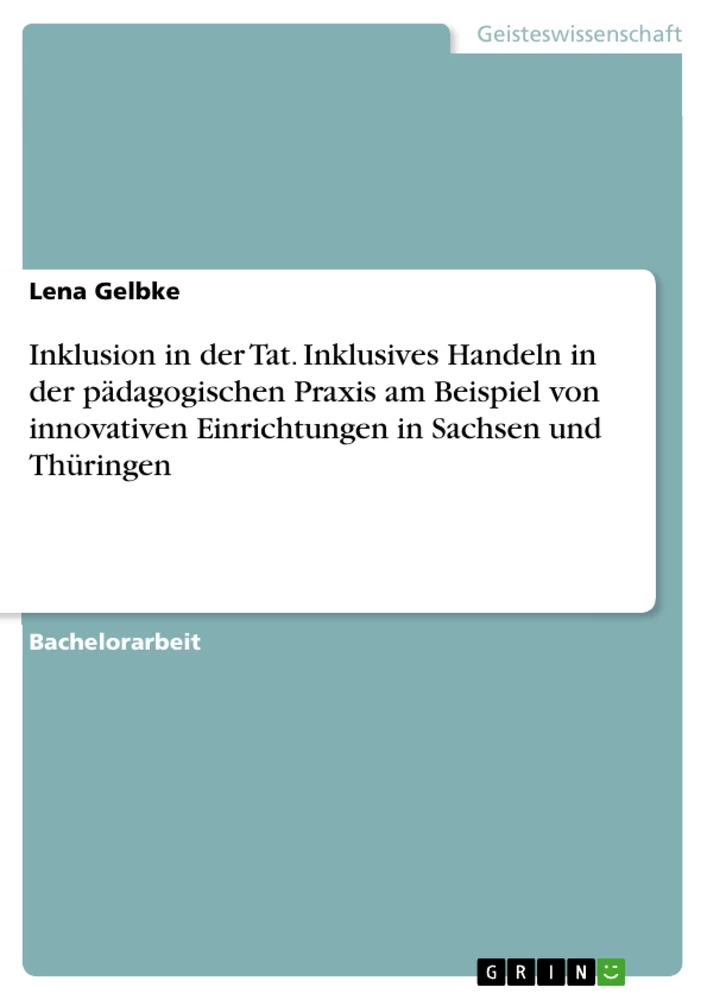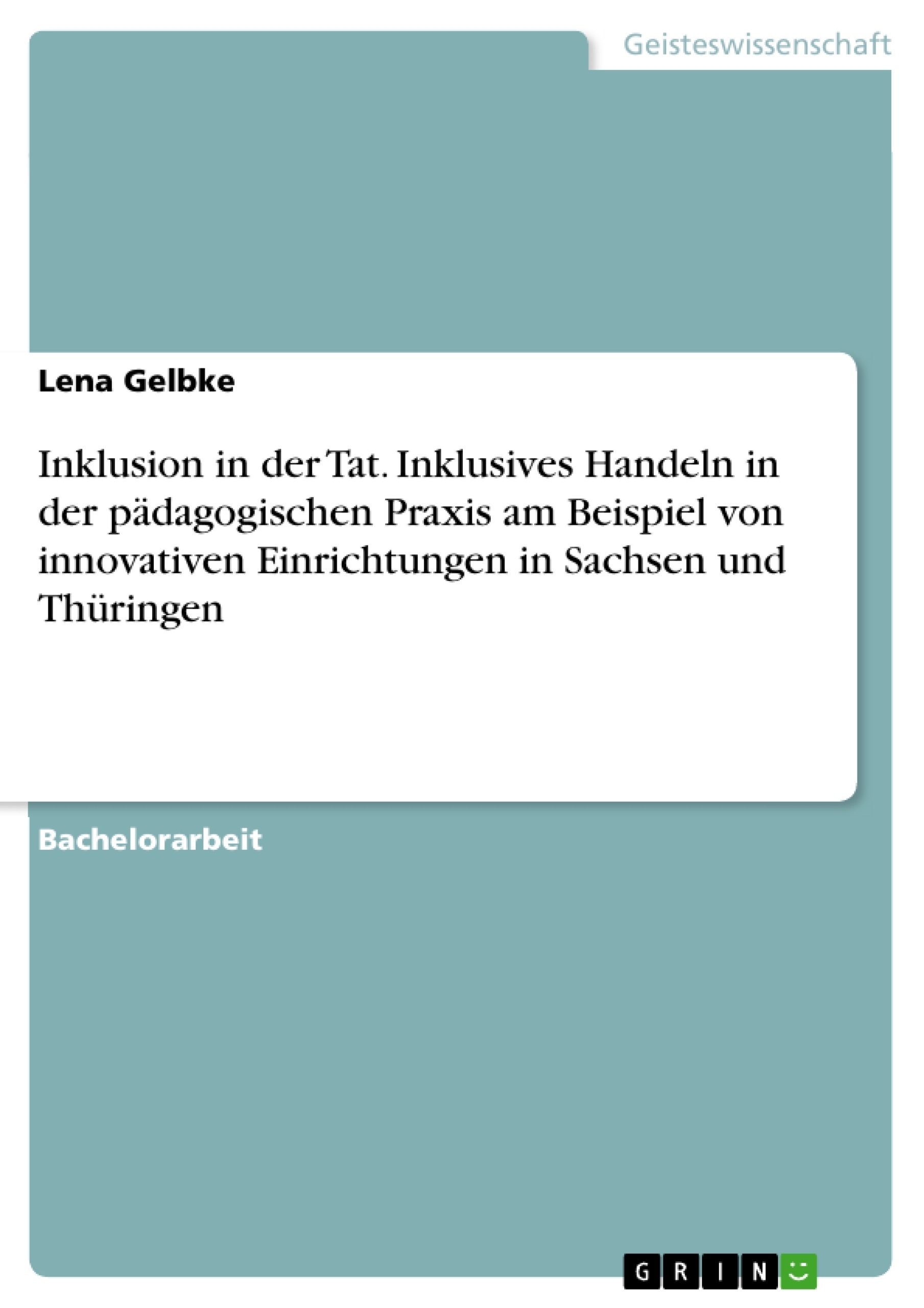Welche Voraussetzungen braucht die pädagogische Praxis, um Inklusion in die Tat umzusetzen? Vertiefend dazu wurden drei Hypothesen aufgestellt, welche anhand der Forschungsergebnisse bearbeitet werden: Das Verständnis vom Inklusionsbegriff differiert in der pädagogischen Praxis. Einrichtungen mit innovativen Konzepten sehen keine Herausforderungen bei der Umsetzung von Inklusion. Und Inklusion wird durch pädagogische Fachkräfte abgelehnt und nicht in die Tat umgesetzt.
Die moderne Pädagogik muss es als ihre Aufgabe verstehen, dass Inklusion weitreichender in die Tat umgesetzt werden kann. Die Grundlagen dafür können geschaffen werden, wenn alle Menschen mit Inklusion wachsen und aufwachsen. Aus diesem Grund wurde sich bei der Erstellung dieser Bachelorarbeit auf die Inklusion in Kindertageseinrichtungen und Schulen beschränkt. Auch, weil die Literaturlage aufgrund der hohen gesellschaftlichen Relevanz des Themas sehr komplex ist, musste eine Einschränkung getroffen werden. Ein inklusives Bildungssystem ist ein Teil des großen Inklusionspuzzles.
Die Arbeit leistet einen Beitrag dazu, die Bedeutung der Inklusion fassen zu können und sie als Notwendigkeit für die pädagogische Praxis anzuerkennen. "Inklusion in der Tat" muss möglich sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Aufarbeitung des Themas
- 2.1 Definitionen relevanter Begriffe
- 2.1.1 Inklusion
- 2.1.2 Integration in Abgrenzung zur Inklusion
- 2.1.3 Separation
- 2.1.4 Exklusion
- 2.1.5 Behinderung
- 2.2 Historische Wurzeln der Inklusion
- 2.2.1 Die Anfänge: Das 18. und 19. Jahrhundert
- 2.2.2 Das 20. Jahrhundert
- 2.2.3 Das 21. Jahrhundert
- 2.3 Rechtliche Grundlagen der Inklusion
- 2.3.1 Internationale Übereinkommen
- 2.3.2 Gesetze auf Bundesebene
- 2.3.3 Gesetze und Bildungspläne in Sachsen und Thüringen
- 2.4 Die Schaffung inklusiver Rahmenbedingungen
- 2.4.1 Die institutionellen Erfordernisse
- 2.4.2 Das pädagogische Personal
- 2.4.3 Die professionelle Haltung
- 2.4.4 Die Gesellschaft und die Politik
- 2.5 Inklusion in der Kritik
- 2.5.1 Inklusion als inhaltsleerer Begriff
- 2.5.2 Die Leistungsgesellschaft und ihr gegliedertes Schulsystem
- 2.5.3 Der Bildungsföderalismus
- 2.6 Inklusion in der Tat
- 2.6.1 Konzepte und Ansätze zur Entwicklung inklusiver pädagogischer Praxis
- 2.6.1.1 Der Index für Inklusion
- 2.6.2 Konzeptionen innovativer Einrichtungen in Sachsen und Thüringen
- 2.6.2.1 Integrativer Kindergarten „Regenbogen“
- 2.6.2.2 Integrative Kindertageseinrichtung „Pinocchio“
- 2.6.2.3 Oberschule „Reinhard Mey“
- 3. Empirische Forschungsmethode: Qualitative Sozialforschung
- 3.1 Das leitfadengestützte Expert*inneninterview
- 3.2 Gütekriterien qualitativer Forschung
- 3.3 Aufbau des Interviewleitfadens
- 3.4 Durchführung der Expert*inneninterviews
- 3.5 Analyse der Daten
- 3.5.1 Die qualitative Inhaltsanalyse
- 3.5.2 Ergebnisse der Inhaltsanalyse
- 3.6 Methodenkritik
- 4. Auswertung der Forschungsergebnisse durch Beantwortung der Forschungsfrage und Bearbeitung der Hypothesen
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Voraussetzungen für die Umsetzung von Inklusion in der pädagogischen Praxis. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tiefergehendes Verständnis für die Thematik zu schaffen und die Bedeutung von Inklusion für die pädagogische Praxis herauszustellen. Die Forschungsfrage lautet: Welche Voraussetzungen braucht die pädagogische Praxis, um Inklusion in die Tat umzusetzen?
- Definition und Abgrenzung von Inklusion, Integration, Separation und Exklusion
- Historische Entwicklung und rechtliche Grundlagen der Inklusion
- Schaffung inklusiver Rahmenbedingungen auf institutioneller, personeller und gesellschaftlicher Ebene
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Inklusionsbegriff und seinen Herausforderungen
- Innovative Konzepte und Ansätze für inklusive pädagogische Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik „Inklusion in der Tat“ ein und verweist auf die gesellschaftliche Relevanz und die aktuelle Debatte um Inklusion. Sie stellt die Forschungsfrage und die dazugehörigen Hypothesen vor, die im Laufe der Arbeit untersucht werden sollen: Welche Voraussetzungen braucht die pädagogische Praxis, um Inklusion in die Tat umzusetzen? Die Arbeit konzentriert sich dabei auf die Inklusion in Kindertageseinrichtungen und Schulen aufgrund der Komplexität des Themas und der Notwendigkeit einer Eingrenzung.
2. Theoretische Aufarbeitung des Themas: Dieses Kapitel bietet eine umfassende theoretische Grundlage für das Verständnis von Inklusion. Es definiert zentrale Begriffe wie Inklusion, Integration, Separation und Exklusion und differenziert diese voneinander ab. Weiterhin werden die historischen Wurzeln der Inklusion beleuchtet, angefangen vom 18. und 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es werden die relevanten rechtlichen Grundlagen auf internationaler, bundesweiter und sächsischer/thüringischer Ebene dargelegt. Das Kapitel analysiert die notwendigen Rahmenbedingungen für inklusive Praxis, unter anderem die institutionellen Anforderungen, die Rolle des pädagogischen Personals und die Bedeutung der gesellschaftlichen und politischen Unterstützung. Abschließend werden kritische Aspekte der Inklusionsdebatte behandelt, wie z.B. die Gefahr der inhaltsleeren Verwendung des Begriffs und die Herausforderungen durch das bestehende Schulsystem und den Bildungsföderalismus. Schließlich werden praxisrelevante Konzepte und Ansätze vorgestellt, unter anderem der Index für Inklusion und die Konzeptionen innovativer Einrichtungen in Sachsen und Thüringen.
3. Empirische Forschungsmethode: Qualitative Sozialforschung: Kapitel 3 beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit. Es erläutert die Wahl des leitfadengestützten Expert*inneninterviews als qualitative Forschungsmethode und beleuchtet die relevanten Gütekriterien qualitativer Forschung. Der Aufbau des Interviewleitfadens wird detailliert dargestellt, ebenso wie die Durchführung der Interviews und die anschließende Datenanalyse mittels qualitativer Inhaltsanalyse. Abschließend erfolgt eine kritische Reflexion der gewählten Methode.
Schlüsselwörter
Inklusion, Integration, Separation, Exklusion, Behinderung, inklusive Pädagogik, rechtliche Grundlagen, Rahmenbedingungen, innovative Einrichtungen, qualitative Sozialforschung, Expert*inneninterview, Sachsen, Thüringen.
Häufig gestellte Fragen zu: Inklusion in der Tat
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Voraussetzungen für die Umsetzung von Inklusion in der pädagogischen Praxis, speziell in Kindertageseinrichtungen und Schulen in Sachsen und Thüringen. Sie beleuchtet die theoretischen Grundlagen, die rechtlichen Rahmenbedingungen und die praktischen Herausforderungen der Inklusion.
Welche Forschungsfrage wird gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Welche Voraussetzungen braucht die pädagogische Praxis, um Inklusion in die Tat umzusetzen?
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Inklusion, Integration, Separation und Exklusion; die historische Entwicklung und die rechtlichen Grundlagen der Inklusion; die Schaffung inklusiver Rahmenbedingungen auf institutioneller, personeller und gesellschaftlicher Ebene; eine kritische Auseinandersetzung mit dem Inklusionsbegriff und seinen Herausforderungen; innovative Konzepte und Ansätze für inklusive pädagogische Praxis in Sachsen und Thüringen.
Welche Methode wurde zur Datenerhebung verwendet?
Es wurde die qualitative Sozialforschung mit leitfadengestützten Expert*inneninterviews eingesetzt.
Wie wurde die Datenanalyse durchgeführt?
Die Datenanalyse erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Theoretische Aufarbeitung des Themas (inkl. Definitionen relevanter Begriffe, historischer Wurzeln, rechtlicher Grundlagen, Rahmenbedingungen, Kritik und Praxisbeispiele), Empirische Forschungsmethode: Qualitative Sozialforschung (inkl. Interviewleitfaden, Durchführung und Analyse), Auswertung der Forschungsergebnisse, Fazit und Ausblick.
Welche konkreten Beispiele für inklusive Einrichtungen werden genannt?
Die Arbeit nennt als Beispiele den integrativen Kindergarten „Regenbogen“, die integrative Kindertageseinrichtung „Pinocchio“ und die Oberschule „Reinhard Mey“.
Welche Schlüsselbegriffe werden in der Arbeit verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Inklusion, Integration, Separation, Exklusion, Behinderung, inklusive Pädagogik, rechtliche Grundlagen, Rahmenbedingungen, innovative Einrichtungen, qualitative Sozialforschung, Expert*inneninterview, Sachsen, Thüringen.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit berücksichtigt internationale Übereinkommen, bundesweite Gesetze sowie Gesetze und Bildungspläne in Sachsen und Thüringen.
Gibt es eine kritische Auseinandersetzung mit dem Inklusionsbegriff?
Ja, die Arbeit analysiert kritische Aspekte der Inklusionsdebatte, z.B. die Gefahr der inhaltsleeren Verwendung des Begriffs und die Herausforderungen durch das bestehende Schulsystem und den Bildungsföderalismus.
- Quote paper
- Lena Gelbke (Author), 2019, Inklusion in der Tat. Inklusives Handeln in der pädagogischen Praxis am Beispiel von innovativen Einrichtungen in Sachsen und Thüringen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1344351