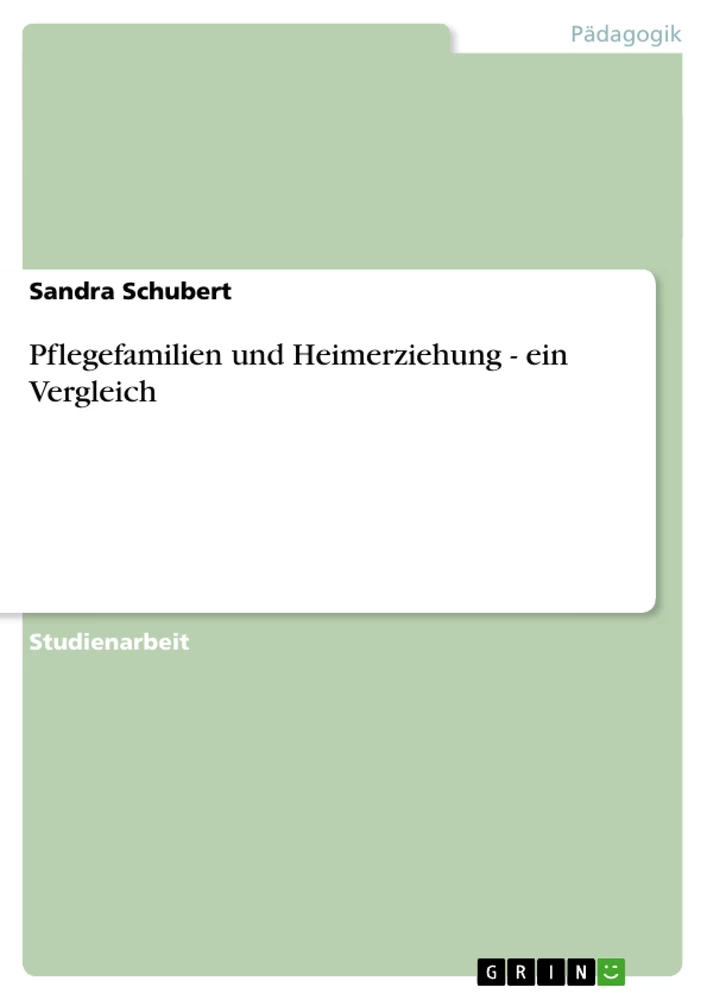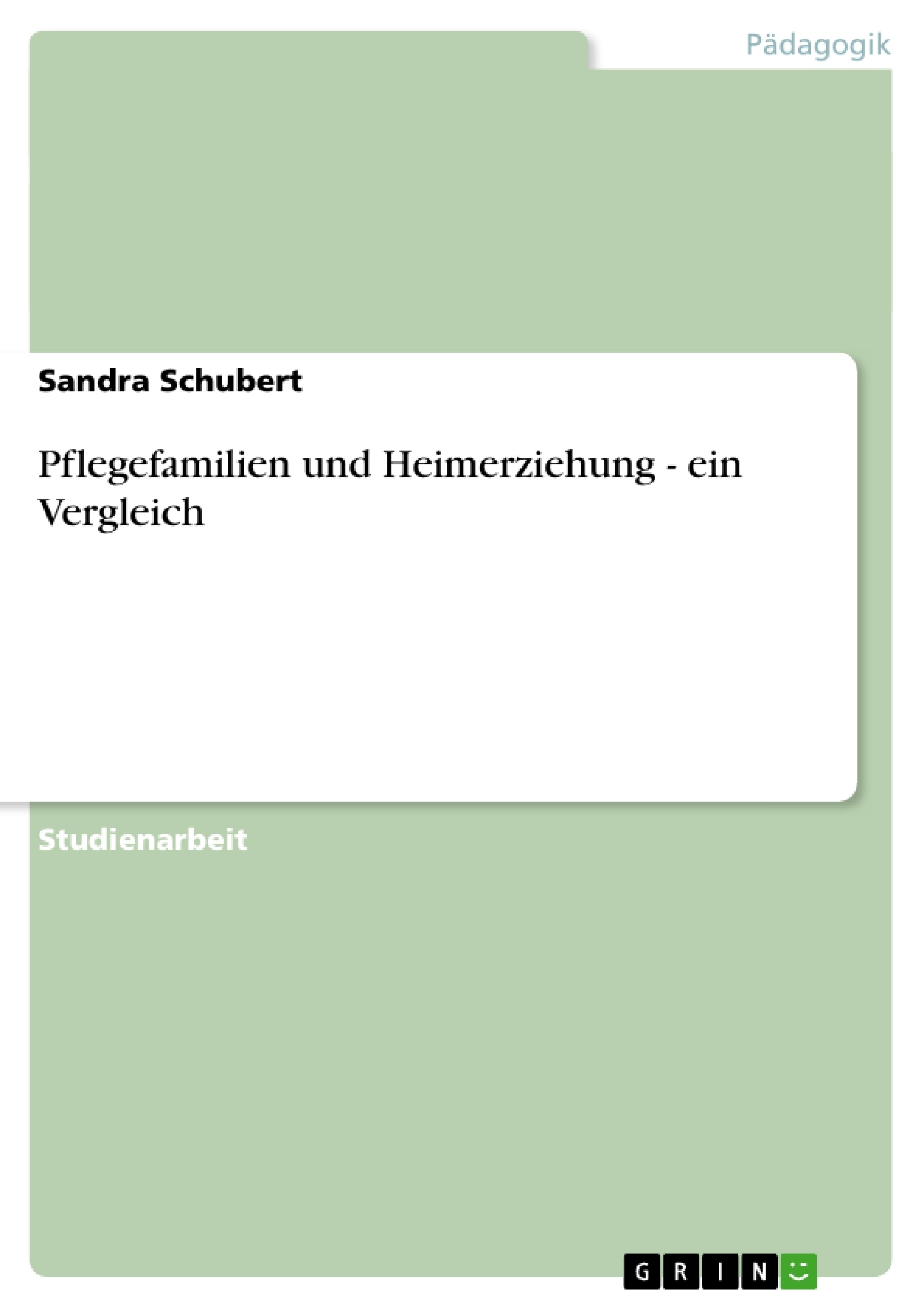Ich werde mich in meiner Hausarbeit mit Kindern in Heimen und Kindern in Pflegefamilien beschäftigen und ihre Erziehung miteinander vergleichen. Auch werde ich versuchen, auf die Frage, welches der beiden Möglichkeiten die bessere ist, zu antworten.
Ich denke, das allgemeine Ziel der Erziehung im Heim und der Erziehung in einer Pflegefamilie ist die Erziehung selbst. Deshalb muss zuerst geklärt werden, was Erziehung eigentlich bedeutet. Erziehung kann wie folgt definiert werden: „Erziehung ist ein soziales Handeln, welches bestimmte Lernprozesse bewusst und absichtlich herbeiführen und unterstützen will, um relativ dauerhafte Veränderungen des Verhaltens und Erlebens, die bestimmten Erziehungszielen entsprechen, zu erreichen.“ […] „Erziehungsziele sind bewusst gesetzte Wert- und Normvorstellungen über das Ergebnis der Erziehung, die Auskunft darüber geben, wie sich der Erziehende gegenwärtig und zukünftig verhalten soll und die Eltern und anderer Erzieher in der Erziehung handeln sollen.“ (Hobmair, S.83, 195).
Jedoch können nicht immer die leiblichen Eltern diese Aufgabe übernehmen. Dann greift das Hilfesystem des Staates und das Jugendamt übernimmt die Verantwortung für das Kind. Gründe für die Inpflegegabe sind meist eine schwierige, konflikthaltige und problematische Familiensituationen. Die Ursachen hierfür sind sehr vielfältig. Es treten psychische Krankheiten bei der erziehenden Person auf, es gibt Alkohol- oder Drogenprobleme, es entstehen konflikthafte Trennungssituationen oder junge Mütter sind überfordert. Seltener bilden der Tod der Eltern oder auch die Inhaftierung der Hauptbezugsperson die Grundlage. Ein weiterer Anlass ist die Vernachlässigung des Kindes (physisch wie emotional) oder auch die Ablehnung der Bezugsperson durch das Kind wegen Misshandlungen oder Missbrauch. (vgl. Blandow, 2004)
Inhalt
0. Einleitung
1. Heimerziehung
1.1. Heimformen
1.2. Soziale Integration von Heimkindern
1.3. Sozialisationsbedingungen im Heim
2. Pflegefamilien
2.1. Aufgabe und Funktion der (Pflege-) Familienerziehung
2.2. Pflegeformen
2.2.1. Vollzeit-/ Dauerpflege
2.2.2. Kurzzeitpflege
2.2.3. Milieunahe Pflege
2.2.4. Teilzeitpflege
2.3. Integration des Pflegekindes in die Pflegefamilie
2.4. Sozialisationsbedingungen von Pflegekindern
2.5. Beendigung des Pflegeverhältnisses
3. Vergleich der Integrations- und Sozialisationsbedingungen von Heim- und Pflegekindern
4. Resümee
Literaturverzeichnis
0. Einleitung
Ich werde mich in meiner Hausarbeit mit Kindern in Heimen und Kindern in Pflegefamilien beschäftigen und ihre Erziehung miteinander vergleichen. Auch werde ich versuchen, auf die Frage, welches der beiden Möglichkeiten die bessere ist, zu antworten.
Ich denke, das allgemeine Ziel der Erziehung im Heim und der Erziehung in einer Pflegefamilie ist die Erziehung selbst. Deshalb muss zuerst geklärt werden, was Erziehung eigentlich bedeutet. Erziehung kann wie folgt definiert werden: „Erziehung ist ein soziales Handeln, welches bestimmte Lernprozesse bewusst und absichtlich herbeiführen und unterstützen will, um relativ dauerhafte Veränderungen des Verhaltens und Erlebens, die bestimmten Erziehungszielen entsprechen, zu erreichen.“ [...] „Erziehungsziele sind bewusst gesetzte Wert- und Normvorstellungen über das Ergebnis der Erziehung, die Auskunft darüber geben, wie sich der Erziehende gegenwärtig und zukünftig verhalten soll und die Eltern und anderer Erzieher in der Erziehung handeln sollen.“ (Hobmair, S.83, 195).
Jedoch können nicht immer die leiblichen Eltern diese Aufgabe übernehmen. Dann greift das Hilfesystem des Staates und das Jugendamt übernimmt die Verantwortung für das Kind. Gründe für die Inpflegegabe sind meist eine schwierige, konflikthaltige und problematische Familiensituationen. Die Ursachen hierfür sind sehr vielfältig. Es treten psychische Krankheiten bei der erziehenden Person auf, es gibt Alkohol- oder Drogenprobleme, es entstehen konflikthafte Trennungssituationen oder junge Mütter sind überfordert. Seltener bilden der Tod der Eltern oder auch die Inhaftierung der Hauptbezugsperson die Grundlage. Ein weiterer Anlass ist die Vernachlässigung des Kindes (physisch wie emotional) oder auch die Ablehnung der Bezugsperson durch das Kind wegen Misshandlungen oder Missbrauch. (vgl. Blandow, 2004)
1. Heimerziehung
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz wird Heimerziehung oder sonstige betreute Wohnformen definiert als „Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht“. Durch ihren Aufenthalt im Heim sollen Kinder und Jugendliche mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung gefördert werden. Im Gesetz werden folgende Ziele genannt: die Rückkehr in die Familie, die Vorbereitung auf die Erziehung in einer anderen Familie oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform, die auf ein selbstständiges Leben vorbereitet. (vgl. Nowacki)
Die Aufgaben der Heimerziehung sind: Wiedereingliederung in die Gesellschaft, Förderung des sozialen Verhaltens, Förderung von individuellen Interessen und Fähigkeiten, Schul- und Berufsausbildung, Behandlung von psychosozialen Schwierigkeiten, Nachholung von Erziehungsversäumnissen und die Heil- bzw. sonderpädagogische Förderung von Behinderten. In der Regel arbeitet jedes Heim nach einem Erziehungsplan: das Vorgehen bei jedem einzelnen Kind bzw. Jugendlichen wird individuell abgestimmt, um ihn in seiner Entwicklung optimal zu fördern bzw. sein Fehlverhalten beheben und Schädigungen bewältigen zu können. (vgl. Hobmair)
Die Aufgabe der Erzieher besteht darin, die Kinder und Jugendlichen bei der Verwirklichung der eigenen Lebenspläne und Lebensziele zu unterstützen.
Seit vielen Jahren geht der Trend dahin, geschlossene Anstalten aufzulösen und die Betreuungsangebote auszuweiten. Dadurch sind die verschiedensten Formen von Heimen entstanden. Viele Jugendliche wollen auch selbst entscheiden, wo sie untergebracht werden. In der Regel arbeiten heute die Heime nach dem Familienprinzip: es werden familienähnlich aufgebaute Gruppen gebildet, die von ihrer Anzahl her überschaubar sind und mit ihrem Erzieher zusammenwohnen. (vgl. Kuppfer)
1.1 Heimformen
Heute kann man nicht mehr vom klassischen Heim sprechen. Es gibt die verschiedensten Formen der Betreuung in der Heimerziehung. Viele Heime bieten verschiedene Betreuungsformen an, um auf die unterschiedlichsten Problemlagen der Kinder und Jugendlichen zu reagieren. Ich werde im Folgenden eine Auswahl von Formen vorstellen.
Jugendwohngruppen
Meist wohnen die ca. 8 Kinder und Jugendlichen in einem großen Haus zusammen. Ihnen stehen Erzieher und Sozialpädagogen zur Seite, die die Versorgung und Betreuung rund um die Uhr gewährleisten. Der Trend geht dahin, die Gruppengröße familienähnlicher zu gestalten und auch die Erzieher leben immer häufiger fest in der Gruppe. Andere Heime konzentrieren sich auf bestimmte Altersgruppen oder auf Probleme und richten ihr fachliches Profil darauf aus.
Betreutes Wohnen
Hier wird ebenfalls die Betreuung durch Erzieher und Sozialpädagogen rund um die Uhr gewährleistet. Die Zielgruppe sind aber ältere Jugendliche, die verselbstständigt werden sollen. Die Jugendlichen haben in einem Haus jeweils ihren eigenen Bereich und werden nur noch stundenweise von Erziehern oder Sozialpädagogen aufgesucht. Eine besondere Form des betreuten Wohnens ist die Mutter-Kind-Betreuung. Hier leben die minderjährigen Mütter mit ihren Kindern in der Einrichtung und bekommen Unterstützung bei der Versorgung und Erziehung ihres Kindes. Sie können auch ihre Schul- und Berufsausbildung weiterführen, da die Mitarbeiter sich während ihrer Abwesenheit um die Kinder kümmern.
Kurzzeitunterbringung
Hier werden die Kinder lediglich für kurze Zeit von dem Erziehungsberechtigten getrennt, um sie lediglich räumlich zu trennen und eine verfahrene Situation zu entspannen. Ziel ist es, den Hilfebedarf abzuklären und mögliche Lösungen zu finden. Die Dauer dieser Kurzzeitunterbringung beträgt ein paar Tage bis zu mehreren Wochen.
Geschlossene Unterbringung
Der wesentliche Unterschied zu den anderen Formen der Heimerziehung ist, dass die Kinder und Jugendlichen mit richterlicher Genehmigung in einem geschlossenen Heim untergebracht werden. In diesen Einrichtungen sind Fenster, Türen, etc. gegen die Flucht gesichert. Die Jugendlichen werden in diesen Einrichtungen untergebracht, wenn sie eine Gefahr für sich oder andere darstellen oder oft strafrechtlich in Erscheinung getreten sind. Der Aufenthalt beträgt ein halbes bis zu einem ganzen Jahr.
Aufgrund der starken Kritik dieses Systems, ist die Anzahl dieser Einrichtungen stark rückläufig. In Deutschland sind aktuell nur noch ca. 150 Jugendliche in einer solchen Einrichtung untergebracht.
1.2 Soziale Integration
Ein Ziel der Heimerziehung ist, dass die Jugendlichen nach ihrer Entlassung aus dem Heim in einen Region integriert werden. Das setzt aber voraus, dass sie während ihres Aufenthaltes schon regelmäßige Kontakte zu den Menschen der Umgebung haben. Wenn die Jugendlichen wenige positive Erfahrungen mit ihrer Umgebung machen, steigt die Angst vor dem Verlassen des Heimes. Das bedeutet, dass der Standort des Heimes ausschlaggebend für die erfolgreiche Integration der Jugendlichen ist. Es können/ sollten Häuser in Wohngegenden gemietet oder gekauft werden, die ein durchschnittliches Lebensniveau repräsentieren.
„Wenn eine realitätsnahe und an den Bedürfnissen der Insassen orientierte Pädagogik davon ausgeht, dass eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Bedingungen der Realität Voraussetzung für das Gelingen einer sekundären Sozialisation bildet, da Verhaltensauffälligkeiten immer auch als ein sozialer Konflikt zwischen Kind und sozialem Umfeld zu verstehen und infolgedessen auch dort zu therapieren sind, dann muss Heimerziehung konfliktnah sein - kein therapeutisches Milieu im Abseits - und Chancen für neue Erfahrungen im sozialen Umfeld ermöglichen.“ (Dalferth, S. 71)
Die Nachbarn sind sehr wichtig für die erfolgreiche Integration der Jugendlichen. Jedoch gibt es in der Bevölkerung noch sehr viele Vorurteile gegenüber Heimkindern. Sie erfahren die Ablehnung von Nachbarn, stoßen auf Misstrauen und Skepsis bei Schulkameraden und Lehrern und werden höchst argwöhnisch in Vereinen aufgenommen oder in Kneipen geduldet (selbst, wenn sie keinerlei Anlass für diese Mutmaßungen bieten). Diese Vorurteile geraten in Gefahr sich zu verfestigen, wenn sich auch nur wenige Heimkinder entsprechend den Erwartungen der Nachbarn verhalten. Damit nehmen sich die Jugendlichen selbst die Chance auf eine potentielle Reintegration.
Meist bilden jedoch fehlende oder lückenhafte Informationen über Jugendliche sowie Nachbarn den Ausgangspunkt dieser Vorurteile. Damit hat die Öffentlichkeitsarbeit eines Heimes eine große Bedeutung. Ziel muss es sein, geeignete Informationen über die Probleme und Sorgen des Heimes und der darin wohnenden Jugendlichen, aber auch über die Fähigkeiten und Kenntnisse dieses Personenkreises der benachbarten Bevölkerung zugänglich zu machen. Aber auch die Jugendlichen sollten Gelegenheit bekommen, über die Alltagsfreuden und -sorgen der Nachbarn etwas zu erfahren. Damit können beide Gruppen mehr Verständnis füreinander entwickeln.
Des Weiteren müssen Heimjugendliche lernen, soziale Kontakte aufzubauen und zu unterhalten, um später selbstständig leben zu können. Gelingt dies während des Aufenthaltes nicht, ist es sehr schwer, es später noch zu erlernen.
Es gibt verschiedene methodische Möglichkeiten in Form von Aktionen oder Projekten, die die Kommunikation und das Verständnis zwischen Nachbarn und Jugendlichen verbessern. Dazu zählen zum Beispiel das Veranstalten eines Tages der offenen Tür, von Filmabenden, Sportveranstaltungen, gemeinsame Urlaubsfahrten mit Jugendgruppen des Stadtteils oder Integration der Jugendlichen in ansässige Vereine.
Auch der Standort des Heimes ist entscheidend für die mögliche Integration der Jugendlichen. Früher wurden Heime räumlich abgeschlossen von der Nachbarschaft. Dieser pädagogische Schonraum sollte eine Nachreifung der Jugendlichen fernab vom schädigenden Milieu garantieren. Dies führt jedoch dazu, dass den Jugendlichen die Rückkehr in die „Außenwelt“ sehr schwer fällt. Diese Abgeschiedenheit fördert Unselbstständigkeit, Passivität, Angst oder irrationale Vorstellungen von dem, was sie „draußen“ erwartet. Durch ständige Auseinandersetzung und Konfrontation mit den Arbeits- und Lebensbedingungen können Jugendliche lernen, in dieser Realität zu leben.
Als günstig bietet sich eine Wohngegend an, die nicht durchgängig von Mittelschichtangehörigen bewohnt wird. Hier besteht am ehesten die Möglichkeit, zu gleichaltrigen Mädchen und Jungen in der Nachbarschaft Kontakt zu bekommen. Diese verfügen über einen Wohnkomfort, die den in Heimen lebenden Jugendlichen nicht als minderwertig erscheinen lassen. Des Weiteren gibt es in einer solchen Wohngegend Treffpunkte, Einkaufsmöglichkeiten und Vereine. Auch eine günstige Verkehrsanbindung ist notwendig, damit die Jugendlichen das Arbeitsplatzangebot und die weiteren Vorteile einer Stadt unabhängig von Erziehern und Heimfahrzeugen nutzen können.
Jedoch sollten die Heime nicht mehr als 20 Mädchen und Jungen beherbergen. Dann könnte die Notwendigkeit, soziale Kontakte in der Nachbarschaft zu pflegen, nicht mehr vorhanden sein. Dabei kommt es mit Sicherheit zu einer stärkeren Belastung der Beziehungen zwischen Heim und Umgebung, welche aber nicht ausschließlich negativ einzuschätzen ist.
Auch die Gestaltung des Wohnraumes im Heim ist wichtig für die soziale und individuelle Förderung der Jugendlichen. Der Wohnraum muss sich daher den Bedürfnissen der Bewohner 7 anpassen und sich daran orientieren. Die Wohnbedingungen dürfen die Jugendlichen nicht diskriminieren, wie es früher in vielen Anstalten der Fall war. Das Wohnen im Heim muss Voraussetzungen dafür schaffen, dass man sich wohl fühlen kann. Eine wichtige Grundvoraussetzung dafür ist das die Einrichtungsgegenstände nicht genormt sind. Jedes Zimmer sollte einzigartig sein und auch nur von einer Person bewohnt werden, damit sie sich zurückziehen kann und sich auch bewegen kann, ohne den anderen zu stören. Wenn die Heimbewohner in die Ausgestaltung ihrer Wohnräume einbezogen werden, zeigt man ihnen, dass sie respektiert werden und ihre Meinung gefragt ist. Auch sollten ausreichend Räume der ganzen Gruppe zur Verfügung stehen (z.B.: Wohnküche, Hobbyräume, etc.).
(vgl. Dalferth)
1.3 Sozialisationsbedingungen
Um die Sozialisationsbedingungen darzustellen, muss man vorher klären, was Sozialisation bedeutet. „Sozialisation bezeichnet das Erlernen des sozialen Verhaltens, den Prozess, in welchem der Mensch in der Gesellschaft bzw. in einer ihrer Gruppen handlungsfähig wird. Um sich sozial verhalten zu können, muss der Mensch die Werte und Normen der betreffenden Gesellschaft erlernen. Werte sind in einer Gesellschaft oder in einer ihrer Gruppen vorherrschende Vorstellungen über das Wünschens- und Erstrebenswerte und bilden allgemeine Orientierungsmaßstäbe für das Verhalten von Menschen. Normen sind mehr oder weniger verbindliche Verhaltensvorschriften, die bestimmen, wie die Werte einer Gesellschaft oder Gruppe zu erfüllen und zu befolgen sind, und so das Tun und Lassen der Mitglieder dieser Gesellschaft oder Gruppe regulieren. Durch die mit der Zeit verinnerlichten Vorschriften bilden die Kinder das Gewissen aus. Das Gewissen ist diejenige Instanz, die das menschliche Verhalten hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit den Wert- und Normvorstellungen sowie mit den Erwartungen einer Gesellschaft bzw. einer ihrer Gruppen gleichsam als „innere Stimme“ reguliert.“ (Hobmair, S. 87f.)
Das Ziel einer Sozialisation im Heim besteht darin, Jugendliche über soziale Kontakte, die Berufstätigkeit, die Wohngegend und die Freizeitmöglichkeiten in die soziale Schicht zu integrieren, die ihnen eine realistische Lebensperspektive öffnet. Das ist in den meisten Fällen die Arbeiterschicht. Eine Reintegration ist besonders dann erfolgreich, wenn sich die Jugendlichen über die sozialen Strukturen bewusst werden. Dazu ist eine aktive Beteiligung des Jugendlichen am Sozialisationsprozess notwendig. Nun stellt sich die Frage, wo die Jugendlichen im Heim die Möglichkeit haben, sich die Realität, die sozialen, ökonomischen und politischen Bindungen ihres Umfeldes anzueignen. Sie müssen sich auch mit gängigen Wert- und Normvorstellungen auseinandersetzen können.
Allgemeine Aussagen über die Sozialisationsbedingungen im Heim sind schwer zu finden. Jedes Kind oder jeder Jugendlicher hat andere Sozialisationserfahrungen aus seiner Familie mitgebracht oder hat mehrfach das Heim gewechselt. Dennoch kann man einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten feststellen. Die Kinder litten unter den verschiedensten familiären Problemen und konnten diese Problemsituationen nicht richtig verarbeiten. Sie wurden auffällig beispielsweise durch Schwierigkeiten in der Schule, häufigem Schulschwänzen, bei Diebstählen und Rauschmittelgenuss „erwischt“. Daraufhin leiteten staatliche Kontrollinstanzen Maßnahmen ein, die unter anderem eine Fremdunterbringung zur Folge hatten.
Nun besteht der wesentliche Unterschied zu einer geglückten Familiensozialisation darin, dass die Kinder und Jugendlichen Unsicherheit und Inkonsistenz der Beziehungen zu den Bezugspersonen erfahren haben. Dadurch können Norm- und Wertvorstellungen nur unzureichend verinnerlicht werden und auch die Herstellung eines positiven Selbstbildes ist nur bedingt möglich. Man spricht von einem „labilen“ Jugendlichen. Die Entwicklung eines positiven Selbstbildes ist jedoch Voraussetzung dafür, dass sich der Jugendliche mit anderen Personen identifizieren kann. Die Möglichkeit einer gegenseitigen Identifikation zwischen Jugendlichen und Erziehern oder der jungen Leute untereinander im Heim wird allerdings durch die ständige und hohe Fluktuation von Kindern und Erziehern stark beeinträchtigt. Das steigert wiederum die emotionale Verunsicherung und führt letztendlich dazu, dass der Heimaufenthalt das Kind zusätzlich schädigt. Weiterhin werden die Kontaktaufnahme und das Aufrechterhalten von Beziehungen zu anderen Menschen gehemmt. Des Weiteren unterscheiden sich die Sozialisationsbedingungen in den Lebens- und Wohnverhältnissen von denen einer Arbeiterfamilie. Eine Verwurzelung im Lebensumfeld findet in Heimen nicht statt, wenn diese außerhalb von Orten „im Grünen“ stehen. Auch ständiger Orts- und Personenwechsel verhindert, dass der Jugendliche oder das Kind eine Beziehung zu einer anderen Person herstellen kann.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Heimerziehung und Pflegefamilie?
Heimerziehung findet in einer stationären Einrichtung mit pädagogischem Fachpersonal statt, während eine Pflegefamilie ein Kind in einen privaten Familienhaushalt aufnimmt.
Wann kommt ein Kind in eine Pflegefamilie?
Gründe sind oft schwierige Familiensituationen, Überforderung der leiblichen Eltern, Suchtprobleme, Vernachlässigung oder Misshandlung.
Welche Formen der Heimerziehung gibt es heute?
Neben klassischen Wohngruppen gibt es betreutes Wohnen für ältere Jugendliche, Kurzzeitunterbringung und in Ausnahmefällen geschlossene Unterbringung.
Was sind die Ziele der Heimerziehung?
Ziele sind die Förderung der Entwicklung, die Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder – falls möglich – die Rückkehr in die Herkunftsfamilie.
Wie wichtig ist die soziale Integration für Heimkinder?
Sie ist entscheidend für den späteren Lebenserfolg. Kontakte zur Nachbarschaft und zum sozialen Umfeld helfen, Vorurteile abzubauen und die Reintegration zu fördern.
- Quote paper
- Sandra Schubert (Author), 2009, Pflegefamilien und Heimerziehung - ein Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134446