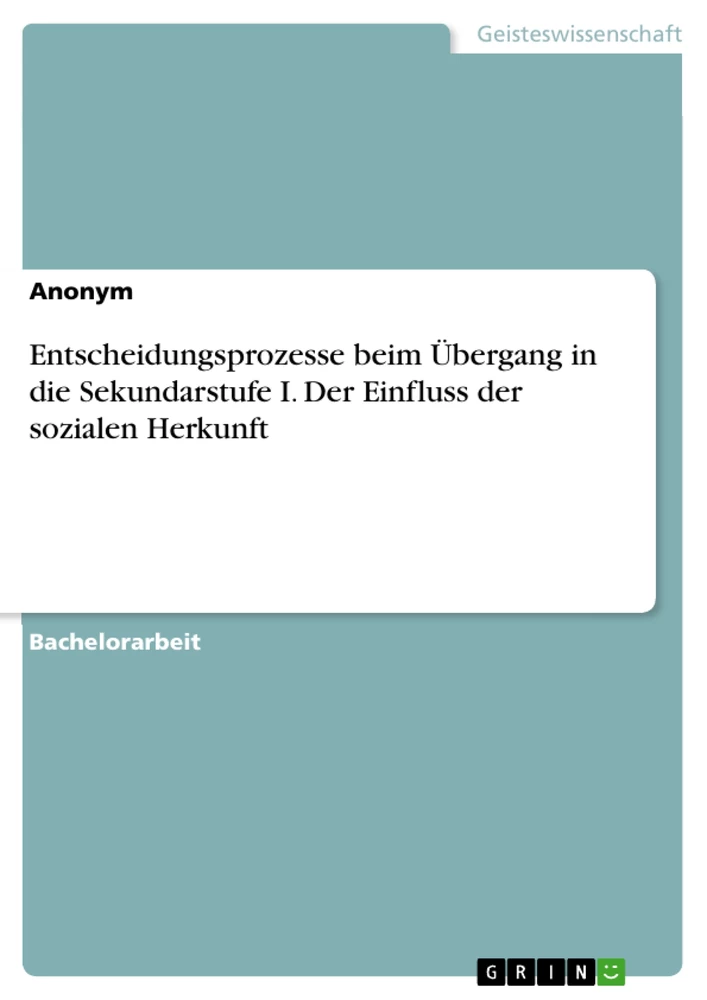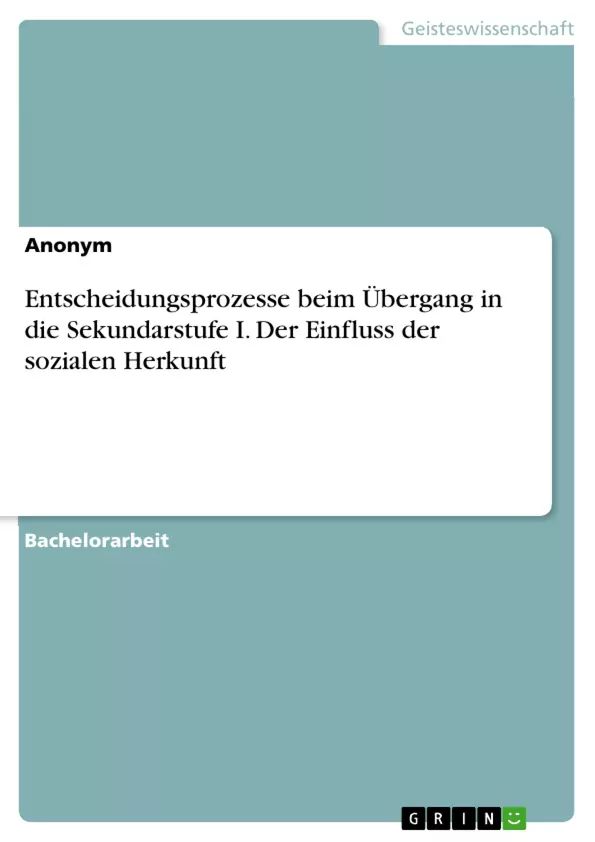Die Forschungsfrage lautet: Welchen Einfluss hat die soziale Herkunft von Kindern auf den Übergang in die Sekundarstufe I? Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung des individuellen Entscheidungsverhaltens sowie weitere Einflüsse auf dieses zu erklären. Außerdem sollen vorhandene Theorien erweitert werden, um mit einer Verknüpfung der empirischen Ergebnisse zu einem klaren Resultat zu gelangen. Diesbezüglich bilden bildungssoziologische Ansätze und Forschungen die Rahmung dieser Arbeit. Im Fokus steht hier der Übergang in die erste Sekundarstufe, wobei sich die Schüler*innen auf verschiedene Schulformen verteilen und entweder einen Haupt- oder Realschulabschluss erwerben oder mit der Fachoberschulreife die Sekundarstufe II weiterführend besuchen können. Diesbezüglich kann die Sekundarstufe I auch als mittlere Schulbildung oder Mittelstufe verstanden werden.
Kinder mit einem hohen Sozialstatus besitzen beim Übergang in die Sekundarstufe I eine fast dreifach so hohe Chance für eine Gymnasialempfehlung als Schüler*innen der unteren Schicht.
Diese Erkenntnis belegt die Aktualität der Thematik der Reproduktion von sozialen Ungleichheiten beim Schulwechsel von der Primarstufe in die nächste Bildungsform. Meist wird diesbezüglich davon ausgegangen, dass soziale Disparitäten durch die Bildungsexpansion verschwunden sind. Jedoch erweist sich bei näherer Betrachtung, dass Differenzen im Bildungssystem, die den zukünftigen Bildungsverlauf der Kinder bestimmen, allgegenwärtig sind. Deshalb setzt sich die folgende Bachelorarbeit mit dem Zusammenhang der sozialen Herkunft von Schüler*innen und den individuellen Entscheidungen beim Bildungsübergang in die Sekundarstufe I auseinander. Da die Reproduktion von Ungleichheiten ein national verbreitetes und umfassendes Phänomen darstellt, stehen hier ausschließlich die Rahmenbedingungen des deutschen Schul- und Bildungssystems in Beachtung. Konzentrieren wird sich diese Arbeit auf die Sozialschichtzugehörigkeit der Haushalte und den elterlichen Bildungsstatus, da die Übergangsprozesse an sich ein großes Feld abdecken. Darunter bleiben weitere Aspekte neben dem sozialen Hintergrund unberücksichtigt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffe und Definitionen
- 2.1. Die Grundlage der sozialen Ungleichheit ….
- 2.2. Chancengleichheit und -ungleichheit
- 2.3. Bildungsferne und -nähe
- 2.4. Die Schichtung der Gesellschaft.
- 2.5. Das Phänomen der Bildungsexpansion.
- 3. Theoretische Ansätze: Bourdieu vs. Boudon
- 4. Forschungsstand.
- 5. Institutioneller Kontext
- 5.1. Ausgangslage Grundschule
- 5.2. Verbindliche oder unverbindliche Entscheidungen?
- 6. Einfluss der sozialen Herkunft auf die Übergangs-entscheidungen.
- 6.1. Bildungsaspiration der Eltern
- 6.2. Tatsächlicher Übergang
- 6.3. Erfolgswahrscheinlichkeit..
- 7. Schulische Leistungsungleichheiten
- 7.1. Übergangsempfehlungen ........
- 7.2. Individuelles Entscheidungsverhalten
- 7.3. Einfluss der Lehrer*innen...
- 7.4. Herkunftseffekte
- 7.5. Welcher Grad an Verbindlichkeit dämmt soziale Ungleichheit wirksamer ein?36
- 8. Fazit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der sozialen Herkunft von Schüler*innen und den individuellen Entscheidungen beim Bildungsübergang in die Sekundarstufe I. Im Fokus steht die Reproduktion sozialer Ungleichheiten im deutschen Schulsystem, insbesondere die Auswirkungen der Sozialschichtzugehörigkeit der Haushalte und des elterlichen Bildungsstatus auf den Übergangsprozess. Die Arbeit zielt darauf ab, das individuelle Entscheidungsverhalten sowie weitere Einflüsse auf dieses zu erklären und bestehende Theorien durch die Verknüpfung mit empirischen Ergebnissen zu erweitern.
- Reproduktion sozialer Ungleichheiten beim Schulwechsel von der Primarstufe in die Sekundarstufe I
- Einfluss der sozialen Herkunft auf Bildungsaspirationen, Übergangsempfehlungen und individuelles Entscheidungsverhalten
- Wirkung von verbindlichen und unverbindlichen Übergangsempfehlungen auf soziale Diskrepanzen
- Untersuchung des Einflusses von Lehrkräften auf die Bildungsentscheidungen von Schüler*innen
- Analyse der Rolle von Herkunftseffekten und sozialer Disparität im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit der Definition zentraler Begriffe wie soziale Ungleichheit, Chancengleichheit, Bildungsferne und -nähe sowie der Schichtung der Gesellschaft und Bildungsexpansion. Anschließend werden die theoretischen Ansätze von Bourdieu und Boudon vorgestellt, die sich mit dem Thema der Reproduktion sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem befassen. Der Forschungsstand zum Einfluss der sozialen Herkunft auf den Übergang in die Sekundarstufe I wird dargestellt. Im weiteren Verlauf werden der institutionelle Kontext, insbesondere die Ausgangslage an Grundschulen und die verschiedenen Formen verbindlicher und unverbindlicher Entscheidungen, erläutert.
Die Analyse des Einflusses der sozialen Herkunft auf Übergangsentscheidungen beleuchtet die Bildungsaspirationen der Eltern und den tatsächlichen Übergang. Dabei werden die Erfolgswahrscheinlichkeit und die Rolle von Übergangsempfehlungen sowie das individuelle Entscheidungsverhalten und der Einfluss der Lehrer*innen untersucht. Schließlich werden die Auswirkungen von Herkunftseffekten und die Wirksamkeit von verbindlichen und unverbindlichen Übergangsempfehlungen auf die Minimierung sozialer Ungleichheiten beleuchtet.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildungsungleichheit, Bildungsexpansion, Schulübergang, Sekundarstufe I, soziale Herkunft, Bildungsaspiration, Übergangsempfehlungen, individuelles Entscheidungsverhalten, Lehrer*innen, Herkunftseffekte, verbindliche und unverbindliche Entscheidungen, Reproduktion von Ungleichheiten.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst die soziale Herkunft den Übergang in die Sekundarstufe I?
Kinder aus höheren Sozialschichten haben eine fast dreifach höhere Chance auf eine Gymnasialempfehlung als Kinder aus unteren Schichten, selbst bei ähnlichen Leistungen.
Welche Theorien erklären die Reproduktion sozialer Ungleichheit im Bildungssystem?
Die Arbeit vergleicht vor allem die Ansätze von Pierre Bourdieu (kulturelles Kapital/Habitus) und Raymond Boudon (primäre und sekundäre Herkunftseffekte).
Welche Rolle spielen die Bildungsaspirationen der Eltern?
Eltern mit höherem Bildungsstatus streben für ihre Kinder häufiger das Gymnasium an, um den sozialen Status zu sichern, während bildungsferne Eltern oft vorsichtiger entscheiden.
Wie wirken sich verbindliche vs. unverbindliche Grundschulempfehlungen aus?
Die Analyse untersucht, welcher Grad an Verbindlichkeit soziale Ungleichheiten wirksamer eindämmt oder ob die Wahlfreiheit der Eltern die Disparitäten eher verstärkt.
Welchen Einfluss haben Lehrer auf die Übergangsentscheidung?
Lehrkräfte geben Empfehlungen ab, die oft unbewusst durch die soziale Herkunft der Schüler beeinflusst werden, was zu ungleichen Bildungschancen führt.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2021, Entscheidungsprozesse beim Übergang in die Sekundarstufe I. Der Einfluss der sozialen Herkunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1344568