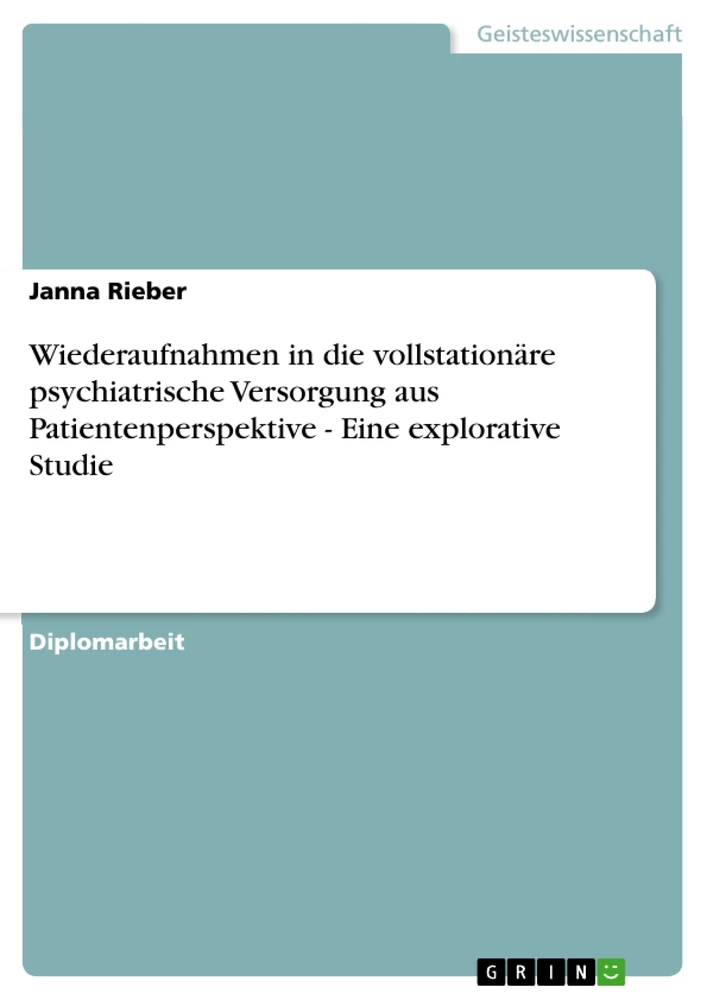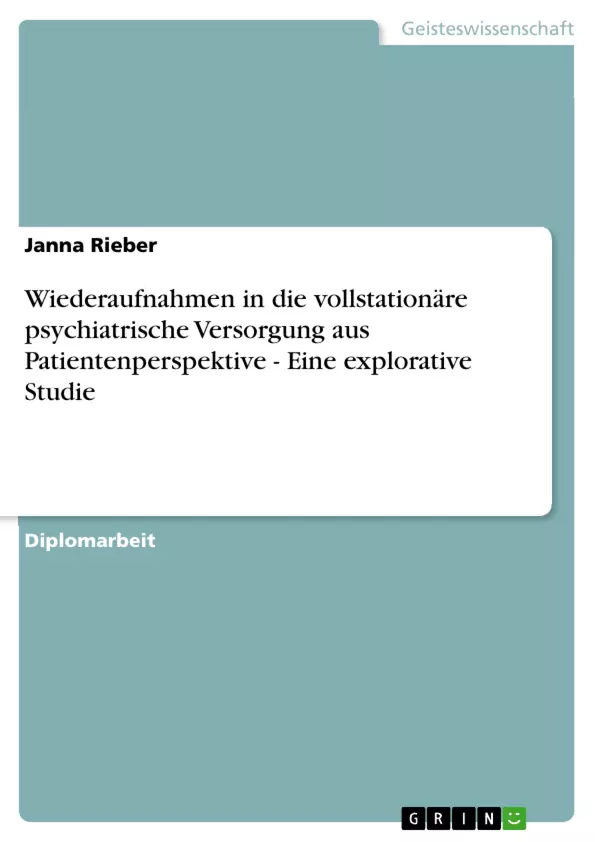„Ambulantisierung der Psychiatrie“, „Ambulant vor stationär“: So und ähnlich lauten die derzeit vorherrschenden Postulate in der Versorgung psychisch kranker Menschen. Die teilweise hohen Raten der Wiederaufnahmen gerade schizophrener PatientInnen in psychiatrische Kliniken, die zur Bezeichnung „Drehtür-Psychiatrie“ führen, geben Anlass, an der Richtigkeit, Gültigkeit und Umsetzbarkeit dieser Prinzipien zu zweifeln.
Ich bin der Frage nachgegangen, wie sich diese raschen Wiederaufnahmen in die psychiatrische Klinik aus Sicht der rehospitalisierten PatientInnen darstellt. Im Zentrum des Interesses meiner Untersuchung stehen daher die Ermittlung und Analyse der Beurteilungen und Meinungen der betroffenen PatientInnen zu ihrer erneuten Aufnahme.
Die bewusst relativ offen und allgemein gehaltene Frage nach der PatientInnenperspektive zur eigenen Rehospitalisierung erlaubte, den Fokus der Untersuchung auf die subjektiven Sichtweisen und Relevanzstrukturen der besagten PatientInnen zu richten. Zu diesem Zweck wurden mit sechs PatientInnen, die sich in einer Wiederaufnahmesituation befanden, problemzentrierte Interviews geführt.
Die Entstehungs- und Rahmenbedingungen der Untersuchung sowie der theoretische und fachliche Bezugsrahmen werden erläutert. Wie werden stationäre Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken aus fachlicher Perspektive gewertet, was verbirgt sich hinter dem Begriff der „Drehtür-Psychiatrie“ und was gibt es für Möglichkeiten und Konzepte, Rehospitalisierungen zu vermeiden? Im empirischen Teil der Arbeit werden die verwendeten Untersuchungsmethoden, aber auch deren Grenzen beschrieben. Im Anschluss werden die Ergebnisse der Untersuchung dargestellt. Abschließend wird die fachliche Betrachtungsweise der PatientInnenperspektive gegenübergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG.
- A. RAHMENBEDINGUNGEN DIESER ARBEIT UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN ………………………………
- 1. BMG-Studie.........
- 2. Krankheitsbegriff.
- 2.1 Symptomatik der Schizophrenie
- 2.2 Chronischer Verlauf der Schizophrenie......
- B. THEORETISCHER UND FACHLICHER BEZUGSRAHMEN Bedeutung und Wertung vollstationärer Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken...\n
- 3.1 Historische und sozialpolitische Hintergründe .\n
- 3.2 Gesundheitspolitische Hintergründe .\n
- 3.3 Gegenüberstellung ambulanter und stationärer Versorgung.\n
- 3.4 Stationäre Behandlungsbedürftigkeit ........\n
- 4. „Drehtür-Psychiatrie“.
- 4.1 Relevanz und Konsequenzen der „Drehtür-Psychiatrie“.
- 4.2 Einflussfaktoren für Rehospitalisierungen.
- 4.2.1 Strukturelle Einflussfaktoren
- 4.2.1.1 Kostendruck
- 4.2.1.2 Ambulante Versorgung.\n
- 4.2.1.3 Entlassplanung
- 4.2.2 Krankheitsbezogene Einflussfaktoren......
- 4.2.2.1 Compliance und Krankheitseinsicht
- 4.2.2.2 Soziale Netze\n
- 4.3 Positive Aspekte von Rehospitalisierungen.....\n
- 5. Möglichkeiten und Konzepte zur Verhinderung von Wiederaufnahmen
- 5.1 Psychoedukation
- 5.2 Längere stationäre Aufenthalte
- 5.3 Strukturelle Veränderungen
- 5.4 Case-Management .......
- 5.5 Ambulante Soziotherapie...\n
- 5.6 Ambulante Krisenintervention.\n
- C. EMPIRISCHER TEIL
- 6. Zum methodischen Vorgehen
- 6.1 Das Untersuchungsdesign und dessen Umsetzung.
- 6.1.1 Falldefinition und Fragestellung
- 6.1.2 Auswahl der InterviewpartnerInnen...\n
- 6.1.3 Kontaktaufnahme mit dem Bezirkskrankenhaus Haar..\n
- 6.1.4 Kontaktaufnahme mit den InterviewpartnerInnen
- 6.1.4.1 Nicht zustande gekommene Interviews
- 6.1.4.2 Zustande gekommene Interviews..\n
- 6.1.5 InterviewpartnerInnen, Interviewsituation,\nOrt und Dauer der Interviews.........\n
- 6.2 Das Untersuchungsverfahren und dessen Umsetzung
- 6.2.1 Das Erhebungsverfahren:\nDas problemzentrierte Interview..\n
- 6.2.1.1 Allgemeines zum Interviewleitfaden
- 6.2.1.2 Vorüberlegungen zum Interviewleitfaden und\ndessen Entstehung.\n
- 6.2.1.3 Tonaufzeichnung.\n
- 6.2.1.4 Postskriptum.…………………..\n
- 6.2.2 Das Aufbereitungsverfahren: Transkription\n
- 6.2.3 Das Auswertungsverfahren..\n
- 6.2.3.1 Grounded Theory\n
- 6.2.3.2 Zirkuläres Dekonstruieren...\n
- 7. Ergebnisse der PatientInnenbefragung
- 7.1 Zur Wohn- und beruflichen Situation.\n
- 7.2 Soziale Netze und Thematisierung von Allein-Sein\n
- 7.3 Kompetenz im Umgang mit der eigenen Erkrankung………....\n
- 7.3.1 Krankheitsbewusstsein und Handlungskompetenzen .\n
- 7.3.2 Verlust der Kontrollfähigkeit\n
- 7.4 Bedeutung von Kohärenz..\n
- 7.4.1 Verlust von Kohärenz\n
- 7.4.2 Bedürfnis nach Kohärenz und Herstellen von Kohärenz ... 94\n
- 7.5 Zur Wiederaufnahme in die Klinik.\n
- 7.5.1 Zur Situation der Wiederaufnahme….......\n
- 7.5.2 Einschätzung des zeitlichen Abstandes zwischen letzter\nEntlassung und Wiederaufnahme....\n
- 7.5.3 Zu den Gründen für den geringen zeitlichen Abstand zwischen\nletzter Entlassung und Wiederaufnahme...\n
- 7.6 Zu den Möglichkeiten der Verhinderung der Wiederaufnahme.\n
- 7.7 Wertung des Klinikaufenthaltes ........\n
- 7.8 Informationsstand und Informationsdefizite..\n
- 7.9 Meinungen über BehandlerInnen und\nGefühl der Stigmatisierung.\n
- 8. Schwierigkeiten bei den Interviews und Grenzen der Methode... 107\n
- D. DISKUSSION.\n
- 9. Zusammenfassung der Ergebnisse der PatientInnenbefragung.………………………….. 1104\n
- 10. Gegenüberstellung von fachlicher und PatientInnenperspektive ......... 112\n
- 10.1 Krankheitseinsicht, Compliance und Medikation.\n
- 10.2 Soziale Netze....\n
- 10.3 Wertung stationärer Aufenthalte .....\n
- 10.4 Informationsdefizite und Entlassplanung..\n
- 11. Abschließende Bemerkungen.\n
- Erfahrungen und Perspektiven von Patientinnen und Patienten mit Wiederaufnahmen in die psychiatrische Vollversorgung.
- Faktoren, die zu Wiederaufnahmen führen, aus Patientensicht.
- Möglichkeiten zur Verhinderung von Wiederaufnahmen und Verbesserung der Entlassplanung.
- Analyse der Rolle von Krankheitseinsicht, Compliance und sozialen Netzwerken bei Wiederaufnahmen.
- Bewertung des Informationsstandes und der Kommunikation zwischen Patientinnen und Patienten und BehandlerInnen.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Thematik von Wiederaufnahmen in die vollstationäre psychiatrische Versorgung aus Patientensicht. Die Arbeit zielt darauf ab, die Erfahrungen und Perspektiven von Patientinnen und Patienten mit Wiederaufnahmen zu erforschen und ein tieferes Verständnis für die zugrundeliegenden Faktoren zu entwickeln. Die Forschungsarbeit möchte dabei einen Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs über die Verbesserung der Behandlungsqualität und -kontinuität in der Psychiatrie leisten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Wiederaufnahmen in die vollstationäre psychiatrische Versorgung ein. Sie skizziert die Rahmenbedingungen der Arbeit und definiert wichtige Begriffe wie den Krankheitsbegriff und die „Drehtür-Psychiatrie".
Kapitel B betrachtet den theoretischen und fachlichen Bezugsrahmen, indem es die Bedeutung und Wertung vollstationärer Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken beleuchtet. Es geht auf die historischen und sozialpolitischen Hintergründe sowie die gesundheitspolitischen Hintergründe der stationären Versorgung ein und setzt sie in Relation zur ambulanten Versorgung. Abschließend widmet sich das Kapitel der Thematik der „Drehtür-Psychiatrie" und untersucht die Relevanz, Konsequenzen und Einflussfaktoren von Rehospitalisierungen.
Der empirische Teil der Arbeit stellt das methodische Vorgehen vor und beschreibt das Untersuchungsdesign, die Auswahl der InterviewpartnerInnen, die Durchführung der Interviews und die Analyse der erhobenen Daten. Anschließend präsentiert er die Ergebnisse der PatientInnenbefragung, die sich mit der Wohn- und beruflichen Situation, den sozialen Netzwerken, der Kompetenz im Umgang mit der eigenen Erkrankung, der Bedeutung von Kohärenz, der Wiederaufnahme in die Klinik, den Möglichkeiten der Verhinderung von Wiederaufnahmen, der Wertung des Klinikaufenthaltes, dem Informationsstand und der Stigmatisierung auseinandersetzt.
Die Diskussion fasst die Ergebnisse der PatientInnenbefragung zusammen und stellt diese der fachlichen Perspektive gegenüber. Sie beleuchtet Themen wie Krankheitseinsicht, Compliance, soziale Netze, Wertung stationärer Aufenthalte und Informationsdefizite in der Entlassplanung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themenbereichen Wiederaufnahmen, vollstationäre psychiatrische Versorgung, Patientenerfahrungen, „Drehtür-Psychiatrie", Rehospitalisierung, Krankheitseinsicht, Compliance, soziale Netze, Entlassplanung, Informationsdefizite, Stigmatisierung und der Verbesserung der Behandlungsqualität und -kontinuität in der Psychiatrie. Die Arbeit analysiert die Erfahrungen und Perspektiven von Patientinnen und Patienten mit Wiederaufnahmen in der Vollversorgung und identifiziert wichtige Einflussfaktoren, die zu Rehospitalisierungen führen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der „Drehtür-Psychiatrie“?
Der Begriff beschreibt das Phänomen häufiger und rascher Wiederaufnahmen von Patienten in die stationäre Behandlung, kurz nachdem sie entlassen wurden.
Warum wurden problemzentrierte Interviews mit Patienten geführt?
Um die subjektive Sichtweise der Betroffenen zu erfassen. Die Studie fragt nach den individuellen Gründen für die Rehospitalisierung aus der Patientenperspektive.
Welche Faktoren führen laut Patienten zur Wiederaufnahme?
Genannt werden oft Einsamkeit (fehlende soziale Netze), Überforderung im Alltag, mangelnde ambulante Krisenintervention und Informationsdefizite bei der Entlassplanung.
Können Rehospitalisierungen auch positive Aspekte haben?
In manchen Fällen bietet die Klinik einen notwendigen Schutzraum und stellt die „Kohärenz“ (Zusammenhang des Lebens) wieder her, wenn die ambulante Versorgung versagt.
Was ist „Ambulante Soziotherapie“?
Es ist ein Konzept zur Vermeidung von Wiederaufnahmen, bei dem Patienten im Alltag unterstützt werden, um ihre Handlungskompetenz und Compliance zu stärken.
- Citar trabajo
- Janna Rieber (Autor), 2003, Wiederaufnahmen in die vollstationäre psychiatrische Versorgung aus Patientenperspektive - Eine explorative Studie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/13448