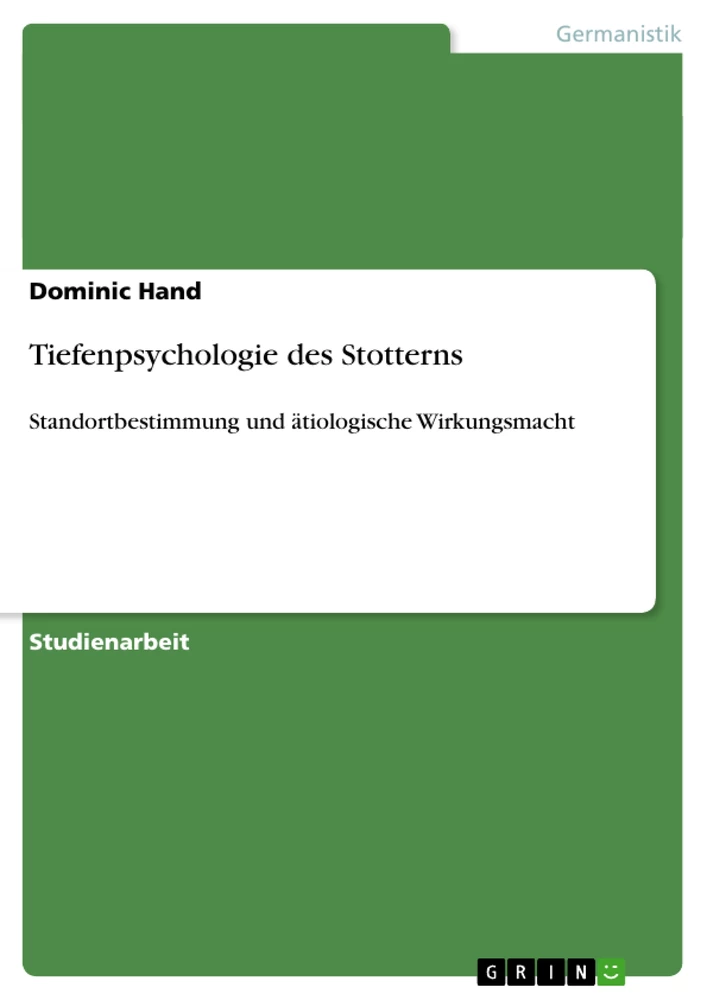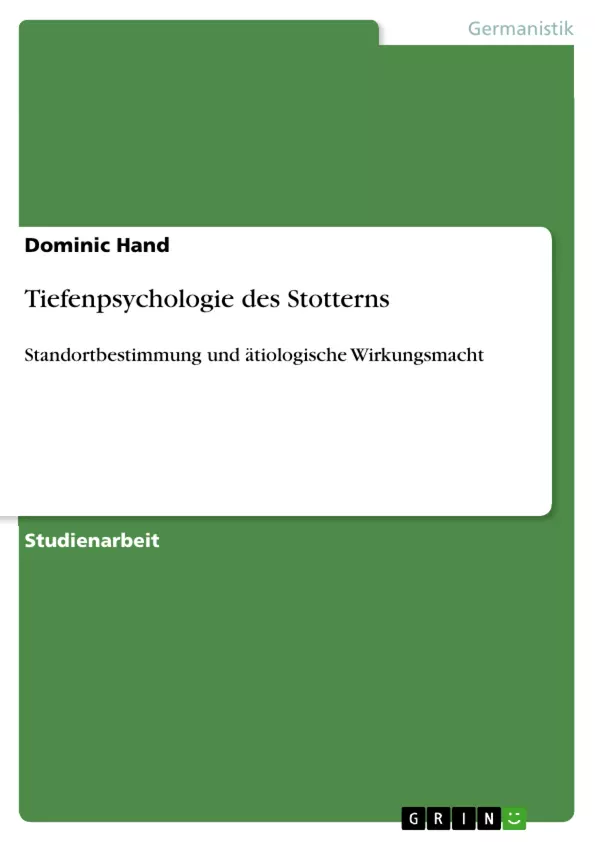„Ich sehe normal aus. Habe normale Freunde und ein normales Abitur. Ich wirke selbstbewusst. Nur eines ist anders: Ich habe Angst zu sprechen.“ (Leynie 23, Studentin) Es gibt Männer, die können auf öffentlichen Toiletten nicht urinieren. Es gibt Männer, die können auf öffentlichen WCs nur urinieren, wenn sie alleine sind, oder keiner neben ihnen steht. Und es gibt Männer, bei denen spielen diese Faktoren keinerlei Rolle. Allen gemeinsam ist, dass sie zu Hause ohne Probleme, wann sie wollen, Wasser lassen können. Dieses Problem wird in der Fachsprache Paruresis genannt. Von ihm sind ca. 7% der Weltbevölkerung (m:w = 9:1) betroffen.
Was glauben Sie, ist die Paruresis eher organisch-physiologischen oder psychologischen Verursachungsfaktoren zuzuschreiben?
Es gibt Menschen, die bereits rot werden wie eine Tomate, wenn sie beim Bäcker nach dem Kassenbon fragen. Andere hingegen scheinen auch in den peinlichsten Situationen entweder gar nicht rot zu werden, oder allenfalls sehr leicht. Manche werden schon allein vom Gedanken rot, dass sie erröten könnten. Das krankhafte Erröten wird in der Medizin Erythrophobie genannt – ca. 1,5 % der Bevölkerung ist davon betroffen. Könnten Sie sich vorstellen, dass psychologische Verursachungsfaktoren bei dieser Krankheit ein Rolle spielen, oder glauben Sie, dass die Erythrophobie rein physiologische Ursachen hat? Manche Menschen brauchen um einen Satz einem anderen mitzuteilen mehr als eine Minute, voller Silbenwiederholungen, Dehnungen, Blockierungen und muskulären Verkrampfungen, sofern sie ihn überhaupt zu Ende führen und nicht schon vorher entmutigt aufgeben. Die gleichen Menschen können diesen Satz, wenn sie flüstern, ihn zu einem Tier sagen, im Chorsprechen oder für sich alleine sind, nahezu ohne Probleme, zum Teil sogar völlig Beschwerde frei aussprechen. Diese Menschen sind Stotterer. Ihr Anteil an der Weltbevölkerung beträgt ca. 1 %.
Halten Sie es für möglich, dass psychologische Faktoren Stottern verursachen können, oder glauben sie, dass die Störung rein organische Gründe hat? Während sich die Wissenschaft darüber einig ist, dass bei der Paruresis soziale Phobien und keine organischen Gründe krankheitsauslösend sind und auch bei der Verursachung der Erythrophobie eine psychische Störung maßgeblich beteiligt ist, werden tiefenpsychologische Überlegungen in der ätiologischen Stotterforschung nahezu überhaupt nicht beachtet, oder sogar ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
- Zur Vorgehensweise in dieser Arbeit
- Enigma Stottern und die Auswirkungen
- wissenschaftliches Rätselraten
- therapeutisches Dilemma
- Das ungeliebte Stiefkind – mögliche Gründe für das Ausblenden psychosozial-tiefenpsychologischer Ansätze innerhalb der Stotterforschung
- Psychologische Dynamik – mehr als lediglich ein aufrechterhaltender Faktor?
- Erste Indizien
- Kulturanthropologie des Stotterns
- Stottern und situative Abhängigkeit
- Ein psychodynamisches Ursachentheorie des Stotterns
- Die Großeltern
- Die Eltern
- Die Mutter
- Der Vater
- Die Familiensituation
- Die Beziehung zwischen den Eltern
- Die Familienatmosphäre
- Die Eltern-Kind-Beziehung
- Die Kommunikation zwischen Eltern und Kind
- Das Kind
- Narzissmus, Selbst und Angst
- Die Auswirkungen
- Erste Indizien
- Was kann eine tiefenpsychologische Theorie wirklich leisten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht kritisch die Rolle der Tiefenpsychologie in der ätiologischen Stotterforschung. Sie beleuchtet den aktuellen Stand der Ursachenforschung und Therapie, analysiert Gründe für die Verdrängung tiefenpsychologischer Ansätze und entwickelt eine psychodynamische Ursachentheorie des Stotterns. Das Potential dieser Theorie wird abschließend bewertet.
- Der aktuelle Stand der wissenschaftlichen Stotterforschung und Therapie.
- Gründe für die Vernachlässigung tiefenpsychologischer Perspektiven in der Stotterforschung.
- Entwicklung einer psychodynamischen Ursachentheorie des Stotterns.
- Bewertung des ätiologischen Potentials der entwickelten Theorie.
- Auswirkungen der tiefenpsychologischen Perspektive auf Therapie und Prävention.
Zusammenfassung der Kapitel
Zur Vorgehensweise in dieser Arbeit: Diese Einleitung skizziert die Leitfragen der Arbeit: den aktuellen Stand der Stotterforschung, die Gründe für das Ausblenden tiefenpsychologischer Ansätze und das Potential einer aktualisierten tiefenpsychologischen Theorie. Sie definiert den Fokus auf Fälle ohne offensichtliche organische Ursachen und kündigt methodische Einschränkungen aufgrund des begrenzten Umfangs an.
Enigma Stottern und die Auswirkungen: Dieses Kapitel beleuchtet die lange Geschichte der Stotterforschung und die Vielzahl widersprüchlicher Theorien (Breakdown-, psycholinguistische und psychologische Hypothesen). Es kritisiert den multifaktoriellen Ansatz als deskriptiv, nicht integrativ und verweist auf die „idiografische Betrachtungsweise“, die die Individualität des Stotterns betont, aber die Suche nach gemeinsamen Faktoren vernachlässigt. Der aktuelle Trend zur Neuro- und Genforschung wird diskutiert.
Das ungeliebte Stiefkind – mögliche Ursachen für das Ausblenden psychosozial-tiefenpsychologischer Ansätze innerhalb der aktuellen Stotterforschung: Dieses Kapitel hinterfragt die Verdrängung psychosozialer und tiefenpsychologischer Ansätze. Es kritisiert methodische Mängel und perspektivische Einseitigkeit in Studien, die einen psychologischen Einfluss leugnen, und verweist auf die Bevorzugung genetischer und neurologischer Forschungsansätze aufgrund ihrer Popularität und Medienwirksamkeit. Der Unterschied zwischen nomothetischer und idiografischer Erkenntnistheorie wird erläutert.
Psychologische Dynamik – mehr als lediglich ein aufrechterhaltender Faktor?: Dieses Kapitel entwickelt eine psychodynamische Ursachentheorie des Stotterns, basierend auf einer Metaanalyse von 59 Studien. Es beschreibt die Rolle der Großeltern als „Impulsträger“, die narzisstische Persönlichkeitsstruktur der Eltern (Mutter und Vater), die daraus resultierende Familienatmosphäre und die gestörte Eltern-Kind-Beziehung. Es erläutert die Bedeutung von Übertragung, Doppelbindungen, Konnotationen und Denotationen in der Kommunikation und die Entwicklung narzisstischer Störungen beim Kind. Das Stottern wird als psychosomatische Reaktion auf einen psychischen Konflikt und als Abwehrmechanismus interpretiert.
Was kann eine tiefenpsychologische Ursachentheorie wirklich leisten?: Dieses Kapitel fasst die Leistungen und Grenzen der entwickelten tiefenpsychologischen Theorie zusammen. Es betont das Potential, den aktuellen Forschungsstand zu erweitern und die hohe Rückfallquote zu erklären. Es verweist aber auch auf die Notwendigkeit weiterer empirischer Forschung und die notwendige Kombination mit sprechspezifischen Therapien.
Schlüsselwörter
Stottern, Tiefenpsychologie, Narzissmus, Familienforschung, Psychodynamik, Eltern-Kind-Beziehung, Kommunikation, Neurose, Psychosomatik, Prävention, Therapie, idiografische Erkenntnistheorie, nomothetische Erkenntnistheorie, Übertragung, Doppelbindung, Konnotation, Denotation, Selbstobjekt, Affektregulation, Sprachentwicklung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Enigma Stottern und die Auswirkungen – Eine psychodynamische Ursachentheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht kritisch die Rolle der Tiefenpsychologie in der Erforschung der Ursachen von Stottern. Sie analysiert den aktuellen Forschungsstand, die Gründe für die Vernachlässigung tiefenpsychologischer Ansätze und entwickelt eine eigene psychodynamische Ursachentheorie. Der Fokus liegt auf Fällen ohne organische Ursachen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Stotterforschung und -therapie; die Gründe für die Vernachlässigung tiefenpsychologischer Perspektiven; die Entwicklung einer psychodynamischen Ursachentheorie des Stotterns; die Bewertung des ätiologischen Potentials der entwickelten Theorie; und die Auswirkungen der tiefenpsychologischen Perspektive auf Therapie und Prävention.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit besteht aus folgenden Kapiteln: „Zur Vorgehensweise in dieser Arbeit“, „Enigma Stottern und die Auswirkungen“, „Das ungeliebte Stiefkind – mögliche Ursachen für das Ausblenden psychosozial-tiefenpsychologischer Ansätze innerhalb der aktuellen Stotterforschung“, „Psychologische Dynamik – mehr als lediglich ein aufrechterhaltender Faktor?“, und „Was kann eine tiefenpsychologische Ursachentheorie wirklich leisten?“. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Welche Kritikpunkte an der bestehenden Stotterforschung werden geäußert?
Die Arbeit kritisiert den multifaktoriellen Ansatz in der Stotterforschung als deskriptiv und nicht integrativ. Sie bemängelt die Vernachlässigung tiefenpsychologischer Ansätze, methodische Mängel in Studien, die einen psychologischen Einfluss leugnen, und die Bevorzugung genetischer und neurologischer Forschungsansätze aufgrund ihrer Popularität und Medienwirksamkeit. Der Unterschied zwischen nomothetischer und idiografischer Erkenntnistheorie wird kritisch beleuchtet.
Welche psychodynamische Ursachentheorie wird entwickelt?
Die Arbeit entwickelt eine psychodynamische Ursachentheorie, die die Rolle der Großeltern, die narzisstische Persönlichkeitsstruktur der Eltern (Mutter und Vater), die daraus resultierende Familienatmosphäre und die gestörte Eltern-Kind-Beziehung betont. Sie erläutert die Bedeutung von Übertragung, Doppelbindungen, Konnotationen und Denotationen in der Kommunikation und die Entwicklung narzisstischer Störungen beim Kind. Stottern wird als psychosomatische Reaktion auf einen psychischen Konflikt und als Abwehrmechanismus interpretiert.
Was sind die Stärken und Schwächen der entwickelten Theorie?
Die entwickelte Theorie erweitert den aktuellen Forschungsstand und bietet Erklärungen für die hohe Rückfallquote bei Stottern. Allerdings benötigt sie weitere empirische Forschung und muss mit sprechspezifischen Therapien kombiniert werden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Stottern, Tiefenpsychologie, Narzissmus, Familienforschung, Psychodynamik, Eltern-Kind-Beziehung, Kommunikation, Neurose, Psychosomatik, Prävention, Therapie, idiografische Erkenntnistheorie, nomothetische Erkenntnistheorie, Übertragung, Doppelbindung, Konnotation, Denotation, Selbstobjekt, Affektregulation, Sprachentwicklung.
- Citar trabajo
- Dominic Hand (Autor), 2007, Tiefenpsychologie des Stotterns , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134674