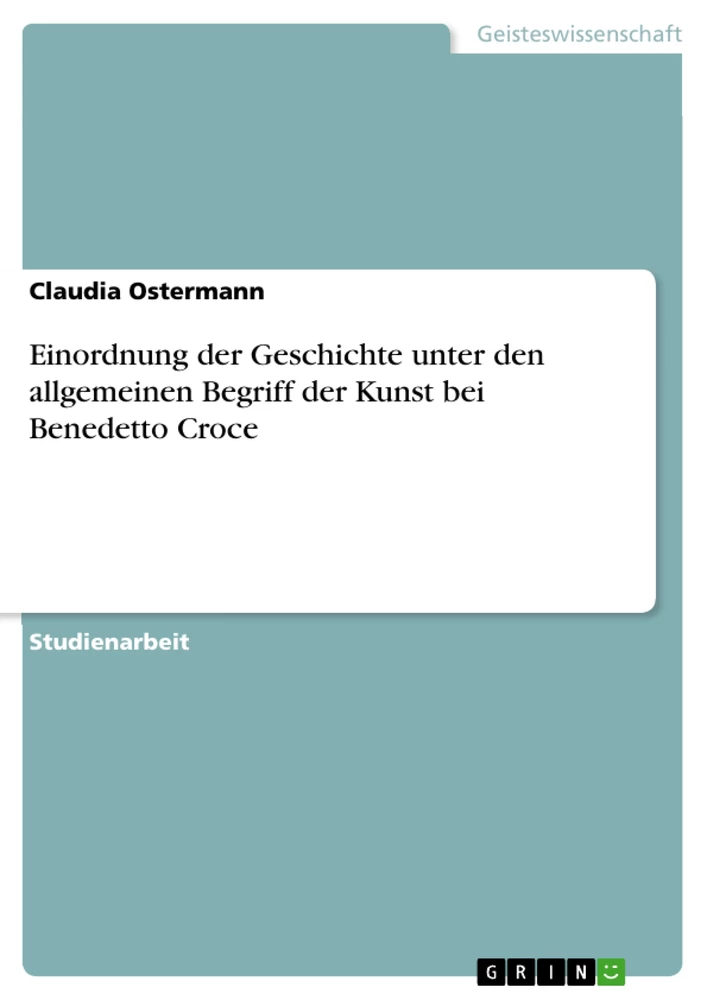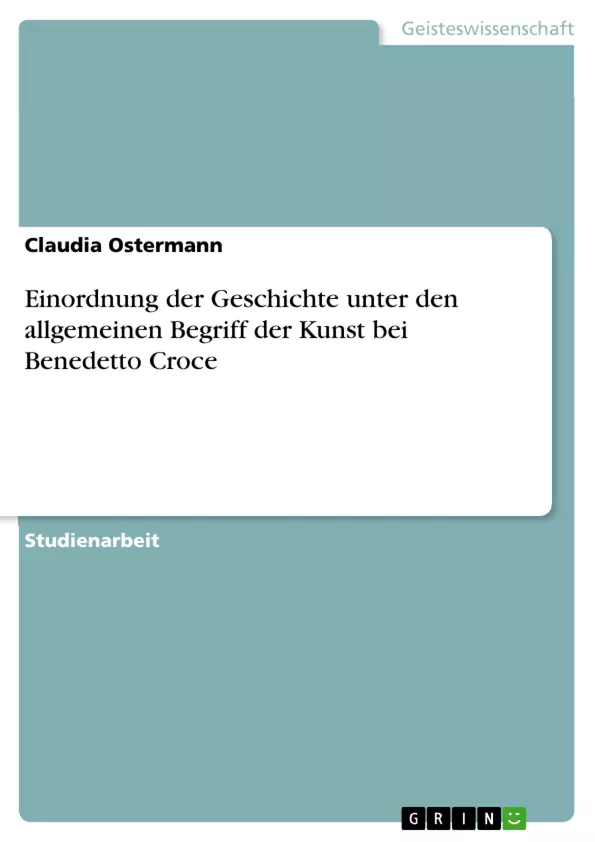Diese Hausarbeit folgt der Argumentation Benedetto Croces, dass Geschichte der Kategorie der Kunst zuzuordnen ist, und vollzieht seine Einordnung nach. Croce arbeitet zunächst die Begriffe der Kunst, der Geschichte und der Wissenschaft aus.
Kunst ist demnach weder bestimmt durch das Hervorrufen sinnlichen Vergnügens, noch durch formale Beziehungen, sondern einzig durch das sinnliche Scheinen einer Idee, den Ausdruck eines Inhalts. Kunst, wie Geschichte, stellt die individuelle Wirklichkeit dar.
Wahre Geschichte entsteht laut Croce erst, wenn es möglich ist, aus dem vorgefundenen Stoff eine Erzählung herzustellen, und eine Erzählung ist, so Croce, Kunst. Daher sind auch die mit der Geschichtsschreibung verbundenen wissenschaftlichen Vorarbeiten nicht wahre Geschichte. Geschichtlicher Stoff, der nicht erzählt werden kann, sei keine Geschichte, in der Erzählbarkeit sieht Croce das Wesen der Geschichte.
Im letzten Abschnitt geht die Autorin auf die Kritiken an Croces These ein. Seine Schrift wurde von außen vielfach kritisiert, er selbst korrigierte in seinen späteren Schriften aber auch selbst seine Einordnung, vor allem im Hinblick auf den Bezug zwischen Geschichte und Philosophie. Während er in seiner Rektoratsrede beide strikt voneinander trennt, versucht er nun, beide einander bis zur Einheit anzunähern.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst gebracht
2.1 DerBegriffder Kunst
2.2 Der Begriff der Wissenschaft und die Geschichte
2.3 Der Begriff der Kunst und die Geschichte
2.4 Die Kunst im engen Sinn und die Geschichte
2.5 Der Begriff der Geschichte und der Geschichtsforschung
3 Einwände gegen Croces Einordnung der Geschichte und der Kunst
3.1 Einwändevon außen
3.1.1 Der Einwand eines zu weiten Kunstbegriffs
3.1.2 Der Einwand der wahren Geschichte
3.1.3 Die Unvollständigkeit der Geschichte
3.1.4 Die Ganzheit der historischen Elemente im Geschichtswerk
3.2 Einwände, die Croce später selbst vorbringt
3.2.1 Einwand der Einheit der Philosophie und der Geschichtsschreibung .
3.2.2 Einwand derTrägheit der Geschichte
3.2.3 Der Einwand des Primats der Wahrheit
3.3 Bedeutung der Einwände für die Sicht auf Croces Frühschrift
4 Fazit
1 Einleitung
Benedetto Croce gilt als der Vater der narrativen Geschichtsschreibung.1 In seiner Rektoratsrede, Die Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst gebracht2, die Grundlage dieser Arbeit ist, widmet er sich der Frage, ob Geschichte Wissenschaft oder Kunst sei. Zu dieser Zeit stand die Wissenschaftlichkeit der Geschichte beinahe außer Frage, und Croces Argumentation stand nicht allein für sich, vertrat aber einen ungewöhnlichen Standpunkt. So wie wir auch heute erst an Wissenschaft denken und dann an Kunst, wenn wir an Geschichte denken. Im ausgehenden 19. Jahrhundert schien die Debatte, ob Geschichte Wissenschaft oder Kunst sei, bereits zugunsten der Wissenschaftlichkeit entschieden zu sein schien. Croce dagegen betont die Narrativität der Geschichte und ordnet sie der Kunst zu. Ich werde in meiner Hausarbeit der Argumentation Croces folgen und seine Einordnung nachvollziehen. Croce arbeitet zunächst die Begriffe der Kunst, der Geschichte und der Wissenschaft aus.
Kunst ist demnach weder bestimmt durch das Hervorrufen sinnlichen Vergnügens, noch durch formale Beziehungen, sondern einzig durch das sinnliche Scheinen einer Idee, den Ausdruck eines Inhalts. Kunst wie Geschichte stellen die individuelle Wirklichkeit dar.
Wissenschaft dagegen erforscht das Allgemeine und arbeitet Begriffe aus. Die Geschichte beschäftigt sich mit konkreten individuellen Tatsachen, und eine Wissenschaft von Individuen kann es, so argumentiert Croce, nicht geben. Geschichte erzählt, es ist ihr aber unmöglich, Gesetze zu bilden. Wenn Geschichte Tatsachen darstellt, ist das genau das, was auch der Künstler macht. Und Croce vergleicht nicht nur die Geschichte mit der Kunst, sondern er setzt sie gleich, identifiziert sie miteinander: Geschichte ist Kunst. Allerdings schließt er die Geschichte aus der Kunst im engeren Sinn aus, da die Kunst mögliche Wirklichkeiten abbilden kann, Geschichte aber wirkliches Geschehen darstellen muss. Gemeinsam ist beiden aber, so Croce, das Interesse und die Zielsetzung: die Darstellung der Wirklichkeit. Die Geschichte definiert Croce also als eine Art der künstlerischen Tätigkeit, die die Darstellung des wirklich Vorgefallenen zum Gegenstand hat.
Wahre Geschichte entsteht laut Croce jedoch erst, wenn es möglich ist, aus dem vorgefundenen Stoff eine Erzählung herzustellen, und eine Erzählung ist, so Croce, Kunst. Daher sind auch die mit der Geschichtsschreibung verbundenen wissenschaftlichen Vorarbeiten nicht wahre Geschichte. Geschichtlicher Stoff, der nicht erzählt werden kann, sei keine Geschichte, in der Erzählbarkeit sieht Croce das Wesen der Geschichte.
Im letzten Abschnitt gehe ich dann auf die Kritiken an Croces These ein. Seine Schrift wurde von außen vielfach kritisiert, er selbst korrigierte in seinen späteren Schriften aber auch selbst seine Einordnung, vor allem im Hinblick auf den Bezug zwischen Geschichte und Philosophie. Während er in seiner Rektoratsrede beide strikt voneinander trennt, versucht er nun, beide einander bis zur Einheit anzunähern.
2 Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst gebracht
1893, als Benedetto Croce seine Rektoratsrede hält, scheint die Frage, ob Geschichte Wissenschaft oder Kunst ist, vor allem unter deutschen Historikern klar beantwortet zu sein. Entweder ist Geschichte Wissenschaft, oder sie ist etwas sui generis, Wissenschaft und Kunst zugleich, aber sie sei auf keinen Fall Kunst. Bei der Einordnung der Kunst herrschen jedoch, so Croce, eine unklare Fragestellung und unklare Begriffsbestimmungen vor. Croce tritt in seiner Rede klar der verbreiteten allgemeinen Ansicht entgegen, jedes künstlerische Anliegen schade der Geschichte und wirft überhaupt die Frage auf, warum die Geschichte im Gegensatz zu anderen Wissenschaften dennoch immer wieder mit der Kunst in Verbindung gebracht wird. „Der schlecht gestellten Frage muss eine Schwierigkeit zugrunde liegen, die ihre wahre, wenn auch unbewusste Ursache ist.“3
2.1 Der Begriff der Kunst
Über den Begriff der Kunst im Besonderen und die ästhetische Betrachtung der Dinge im Allgemeinen scheint zunächst Einigkeit zu bestehen: „Die Welt der Ästhetik ist die Welt des Schönen, und die Kunst ist eine Tätigkeit, die darauf ausgerichtet ist, das Schöne hervorzubringen.“4Croce geht zunächst auf die vier verbreitetsten Auffassungen vom Schönen und von der Kunst ein: Das Schöne — als zur Klasse des Angenehmen gehörig (Sensualismus), das Schöne als das Wahre und das Gute (Rationalismus), das Schöne als in gefälligen formalen Verhältnissen bestehend (Formalismus) sowie das Schöne als Ausdruck einer Idee (konkreter Idealismus). Während Croce die ersten drei Theorien widerlegt, stimmt er der Auffassung vom Schönen als Ausdruck einer Idee zu. Er behauptet, dass „der Ausdruck eines Inhalts bei den verschiedenen Erscheinungen des Schönen offenbar bestimmend ist“5, auch wenn er sagt, dass er nicht darlegen kann, „in welcher Weise sich der Vorgang des Ausdrucks vollzieht“6. Der, auch unbewusste oder symbolische, Ausdruck eines Inhalts verleiht demnach den angenehmen Eindrücken der Sinne ästhetischen Charakter.
Was soll ist mit diesem Ausdruck eines Inhalts gemeint? Inhalt des Ausdruckes ist die konkrete Wirklichkeit. Sie kann zunächst jeder Sinneseindruck sein, auch der sogenannte niedere Sinn, nichts ist im ästhetischen Sinne gleichgültig. Es ist jedoch nicht dieser Sinneseindruck, der physiologische Reiz, der das Gefallen, die ästhetische Wahrnehmung eines Kunstwerks, auslöst, sondern seine Bedeutung, seine Idee. Nicht die Musik als solche, die Aufeinanderfolge der Töne allein löst ein Schönheitsempfinden aus, sondern erst ihr Zusammenspiel, die Idee des Künstlers vom gesamten Stück und die Interpretation des Musikers. Auch abstrakte Gedanken in Form mathematischer Sätze oder philosophischer Begriffe können in diesem Sinne schön sein. Sie werden durch ihren Ausdruck Gegenstand ästhetischer Betrachtung und sie sind „schön, wie ihr Ausdruck in jeder Beziehung angemessen und wirkungsvoll ist.“7 Aus diesem Kunstbegriff erklären sich, so Croce, die zustimmenden und ablehnenden Urteile über Natur- und Kunstgegenstände genauso wie die Relativität des Urteils je nach eingenommenem Standpunkt.
Croces Kunstverständnis erschließt sich aus einer Kombination der idealistischen Kunstmetaphysik Hegelscher Prägung und dem Einfluss der realistischen Strömungen des ausgehenden Jahrhunderts. Croce bestimmt die Kunst als Darstellung der Wirklichkeit in ihrer Konkretheit, und bricht damit mit dem normativen Schönheitsideal der idealistischen Ästhetik, die das Reich der schönen Kunst mit dem Reich des absoluten Geistes gleichgesetzt hatte. Er —subjektiviert die Kunst, erklärt sie so zu einer reinen Wahrnehmungskategorie, wodurch der Bereich künstlerischer Darstellung stark erweitert wird. Alles Wirkliche wird darin kunstfähig, nichts ist niemals Kunst, und nichts ist für sich Kunst. Gleichzeitig bleibt Croce doch der idealistischen Ästhetik verbunden, indem er am Ausdruck festhält. Durch den Ausdruck ist die künstlerische Darstellung mehr als bloße Reproduktion der konkreten Wirklichkeit, die Wirklichkeit sucht ihren Ausdruck.
Die Form der Darstellung folgt dem Inhalt, also dem Gegenstand in seiner Konkretheit. Kunst als Wahrnehmungskategorie betrachtet den Gegenstand und nimmt dessen individuelle Schönheit wahr. Die Kunst stellt also nicht per se schöne Gegenstände, Personen, Handlungen dar, sondern diese werden durch die Betrachtung unter der Wahrnehmungskategorie der Kunst erst schön. So unterscheidet Croce das Kunstschöne vom Naturschönen. In der Kunst ist der Inhalt des Dargestellten die Wirklichkeit im Allgemeinen, „während in der Natur Einzelfälle der Wirklichkeit die Ideale sind.“ 8
Auf den Begriff der Wahrnehmungskategorie geht Croce nicht näher ein. Nach Kant sind Kategorien Gedankenformen, Verstandesbegriffe, an die das Denken gebunden ist. Demnach können wir die Gegenstände der Umgebung nur durch die Kategorien erfassen und denkend bearbeiten. Diesem Kategorienbegriff entsprechend geht es Croce möglicherweise dabei um die Einordnung der umgebenden Gegenstände. Dafür spricht, dass er die Kunst als eine Wahrnehmungskategorie nennt, bei der die Kunst als schöpferischer, verstandesmäßiger Filter bei der Betrachtung der Umwelt wirkt, mit der konkreten Wirklichkeit als Bezugspunkt.
Demnach ist Aufgabe und Inhalt der Kunst im oben dargestellten Sinne die Abbildung der konkreten Wirklichkeit. Die Darstellung der Wirklichkeit ist aber ebenso die Aufgabe und Inhalt der geschichtlichen Darstellung.
2.2 Der Begriff der Wissenschaft und die Geschichte
Wissenschaft, so Croce, erforscht immer das Allgemeine und arbeitet mit Begriffen. „Wo es keine Begriffsbildung gibt, gibt es auch keine Wissenschaft.“9 Wissenschaftlichkeit der Geschichte würde das Bilden von Begriffen voraussetzen, Geschichte bildet aber keine Begriffe. Weitere Wesensmerkmale — von Wissenschaft sind der Blick auf das Allgemeine und auf das allgemeine Gesetz, das sich in jedem einzelnen Fakt ausdrückt, und die logische Abstraktion.
Geschichte handelt von Individuen sowie von individuellen und konkreten Tatsachen. Eine Wissenschaft von Individuen wäre ein Widerspruch in sich. Selbst da, wo Geschichte Einzelnes mit dem Ganzen in Beziehung setzt, geht es im Kern immer noch um das Individuelle. Geschichte erzählt Tatsachen. Diese Tatsachen müssen sorgfältig vorbereitet werden, sie müssen gesammelt, in der richtigen Abfolge dargelegt und auf ihre Ursachen zurückgeführt werden. Geschichte bedient sich der Wissenschaft in Bezug auf ihre Grundlagen, doch ihre Aufgabe besteht vorrangig und hauptsächlich im Erzählen und Darstellen.
Kann man aus der Geschichte eine Wissenschaft machen, indem man versucht, aus Tatsachen Gesetze herzuleiten, nach denen diese Tatsachen eintreten? Mit dieser Frage beschäftigte sich u.a. auch Georg Simmel. Wissenschaftliche Erkenntnis, so Simmel, stellt zunächst „ganz allgemeine Normen, höchst umfassende Principien“ auf, und „verengert sich in dem Maße, indem es exakter wird.“10 Die metaphysische Reflexion hingegen „greift eine Erscheinung heraus, die sie mehrfach wiederholt sieht. Und sie legt dieses Maß nun unmittelbar an die komplexen Verhältnisse des Empirischen an; ihr Material sind die kompliziertesten Erscheinungen.“11 Jedes historische Gesetz, das gefunden zu sein scheint, findet seine Grenze an anderen historischen Gesetzen, und es ergibt sich ein „relatives Maß seiner Berechtigung. Gesetze freilich sind dies nicht, denn ein Gesetz hat keine Grenze seiner Gültigkeit.“12
Simmel kommt so zu dem Ergebnis, dass es unmöglich sei, Gesetze für komplexe Zustände aufzustellen, was auch und gerade für die Geschichte, die es mit den „kompliziertesten Erscheinungen“ in Form von Gesamtzuständen und verzweigten Einzelheiten zu tun hat, gilt. Zudem widerspräche die Festlegung von Gesetzen in der Geschichte des Menschen der menschlichen Freiheit. Wenn aber die Geschichte keine Gesetze bilden kann, nach denen ihre Tatsachen eintreten, dann ist sie auch keine Wissenschaft.
An dieser Stelle teilt Croce die Geschichte auf: in die wissenschaftlichen Vorarbeiten und die nichtwissenschaftliche Geschichtsschreibung, die das — erzählt, was geschehen ist, und die der eigentliche Kern der Geschichte ist. „Die Geschichte ist eine Sache, eine andere sind die historische Untersuchung und die Beweisführung.“13
2.3 Der Begriff der Kunst und die Geschichte
Die Frage, der Croce in diesem Kapitel zunächst nachgeht, ist die Frage ob Geschichte nicht auch Wissenschaft und Kunst zugleich sein kann. Croce argumentiert, dass der menschliche Geist bezogen auf einen Gegenstand nur zwei erkenntnismäßige Tätigkeiten ausüben kann: Er kann ihn wissenschaftlich oder künstlerisch bearbeiten, aber er kann niemals beides gleichzeitig tun. „Man betreibt also entweder Wissenschaft oder man macht Kunst.“14 Betrachtet man den Gegenstand unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten, so subsumiert man das Besondere unter das Allgemeine, macht man Kunst, stellt man das Besondere als solches dar.
Geschichte gibt das Besondere wieder und stellt es in seiner Konkretheit dar, ohne es unter Allgemeines zu subsumieren, sie ist die „Darstellung der konkreten und menschlichen Angelegenheiten in ihrem zeitlichen Ablauf.“15 Indem sie das Besondere darstellt, kann sie der Kunst zugeordnet werden. Ist auch ihre Darstellungsweise eine künstlerische?
Croce verweist hier auf die zwei Hauptverfahren nach Lazarus, die in der Geschichte Anwendung finden: Verdichtung und Vertretung, die auch typisch sind für jede künstlerische Darstellung. Hinzu kommt die Tatsache, dass geschichtliche Darstellung nicht auf Sprache angewiesen ist, sondern sich jeder künstlerischen Darstellungsform bedienen kann. Croce benennt als Beispiele die Malerei und die Bildhauerei, man kann sich aber auch andere und kombinierte Darstellungsformen vorstellen wie z.B. eine Graphic Novel, die Sprache und bildliche Darstellungen verbindet.
Croce beschäftigt sich anschließend mit einem Einwand Schopenhauers, der „die Geschichte, nachdem er sie schon aus dem Bereich der Wissenschaft ausgeschlossen hat, auch aus dem der Kunst ausschließt“.16 Indem sich Kunst mit der Idee, Wissenschaft mit dem Begriff beschäftigt, trifft keines davon auf die Geschichte zu: Sowohl Idee als auch Begriff sind immer und in gleicher Weise da als Gegenstände wirklichen Wissens, im Gegensatz zur Geschichte, die „das Einzelne in seiner Einzelheit und Zufälligkeit“ zum Thema hat, „das was einmal ist und dann auf nimmer nicht mehr ist.“17Doch was ist hier mit Idee gemeint? Schopenhauer geht von einem allgemeinen Begriff der Idee aus, der Idee als das wahrhaft Seiende, das Wesen aller Dinge. Nach der von Croce vertretenen Kunstauffassung ist Inhalt der Kunst der Ausdruck einer Idee. Die Kunst gibt nicht die allgemeine Idee der Dinge wieder, sondern die Idee, die in der konkreten Darstellung sichtbar wird.
Weiterhin beschäftigt sich Croce mit den Einwänden der Unvollendetheit und des unbegrenzten Inhalts der Geschichte. Kunst stelle nur in allen Teilen vollendete Gegenstände dar, Geschichte dagegen bleibe fragmentarisch. Dem stellt Croce die Überlegung entgegen, dass auch der Historiker stets um Vollendung seiner Darstellung bemüht sein soll, und die Lücken immer nur zufällig sind und nicht aus einer Unmöglichkeit der Aufgabe herrührten. Das Fragmentarische der Geschichte ist, so Croce, in die Definition der Geschichte nicht mit hineinzunehmen.
2.4 Die Kunst im engen Sinn und die Geschichte
Croce beschäftigt sich nun mit der Frage, welche Stellung die Geschichte unter den anderen Werken der Kunst einnimmt. Unter mehreren Klassifikationskriterien gibt es, so Croce, nur eines, das zuverlässig ist: die verwendeten Mittel, die besondere Darstellungsform jeder Kunst. Unter diesem Kriterium ordnet er die Geschichte der Klasse der sprachlichen Künste zu. Geschichte nutzt aber auch andere Mittel und steht dabei der Malerei, der Bildhauerei oder anderen Künsten genauso nahe wie der Sprache. Dieser Weg ist also ungeeignet, um Geschichtsschreibung von anderen Hervorbringungen der Kunst zu unterscheiden. Vom ästhetischen Standpunkt aus bildet Geschichte keine Gattung, sondern stellt in verschiedenen Gattungen einen Inhalt dar, den sie mit ebenso verschiedenen Mitteln ausdrückt. Es geht also bei der Einordnung der Geschichte innerhalb der Künste weniger um die Form, als um den dargestellten Inhalt.
Croce verweist auf die Unterscheidung in freie und unfreie Künste bei Hartmann. Unfreie Künste sind auf die Wirklichkeit gerichtet, und verfolgen, indem sie auf ein reales Ziel ausgerichtet sind, einen nützlichen und außerästhetischen Zweck. Das trifft auf die historische Erzählung genauso zu wie auf den oratorischen Diskurs oder die Architektur. Freie Künste dagegen sind entsprechend frei in ihrer Zielsetzung. Croce kritisiert diese Einteilung als zu oberflächlich, da auch die unfreien Künste den Schein des Zweckes anstreben, indem sie Kunst betreiben. Sie stellen einen Bezug zu realen Dingen dar, und dem rein ästhetischen Betrachter genüge dieser Schein. Auch ein nichtreligiöser Mensch ist in der Lage, die Schönheit sakraler Bauten wahrzunehmen, und nur der religiöse Betrachter nimmt diese zusätzlich als Kultgegenstände wahr. Croce verweist darauf, dass auch diese unterschiedlichen psychologischen Wahrnehmungsformen berücksichtigt werden müssen. Ein Liebesgedicht kann unter einer rein ästhetischen Betrachtung schöne Prosa sein, oder es kann Ausdruck wahrer Gefühle sein - oder beides. „Die Geschichte hat kein Ausdrucksmittel, das ihr eigen ist und ihr einen Gegenstand zuweist.“18 Es braucht ein außerästhetisches Kriterium, das sich auf den Inhalt, den Stoff, das Thema der Geschichte bezieht.
Was ist Inhalt der Kunst? Hat sie einen ebenso umfassenden thematischen Bereich wie die Wissenschaft, in der alles zum Thema werden kann? Inhalt der Kunst ist die Wirklichkeit, und eine Sache, die vollständig dargestellt wird, ist ein Kunstwerk. Schopenhauer hat die allgemeine Idee zum Gegenstand der Kunst gemacht, Schiller das Allgemeine. Bei Koestlin ist der Inhalt der Kunst das Interessante, das, was den Menschen als Menschen interessiert. Und den Wert des ästhetischen Inhalts stuft Koestlin dabei als umso höher ein, „je allgemeiner das Interesse daran ist.“19 Er beginnt mit Inhalten, die den Menschen als Menschen angehen, und endet bei Inhalten, die den Menschen lediglich als Individuum interessieren. Croce übernimmt diese Gedanken, ohne der Abstufung Koestlins im Einzelnen zu folgen: „Inhalt der Kunst ist die Wirklichkeit im Allgemeinen, sofern sie unter den verschiedenen Aspekten Interesse hervorruft.“20 Dabei unterscheidet er zwischen dem wissenschaftlichen und dem künstlerischen Interesse, wobei das wissenschaftliche Interesse das — konstantere sei. Denn das Interesse an wissenschaftlicher Betrachtung betrifft den Geist als Intellekt, während das ästhetische Interesse von der komplexen menschlichen Entwicklung abhängig ist und veränderlich ist. Wissenschaftliches Interesse strebt das Erkennen der Wirklichkeit in ihrer Gesamtheit an, künstlerisches Interesse spricht den Menschen als Menschen an, und interessiert nicht nur jetzt gerade, sondern zu allen Zeiten und unter allen Bedingungen.
Geschichte beschäftigt sich inhaltlich mit dem historisch Interessanten, das sich wirklich ereignet hat. Künstler wie Historiker legen jeweils die empirischen Daten zugrunde, sie unterscheiden sich aber nach ihrem Ziel: Der Künstler folgt dem Prinzip der ästhetischen Verknüpfung, der Historiker ist an reale Ursachen gebunden. Geschichte verhält sich zur Gesamtheit der künstlerischen Produktion wie ein Teil zum Ganzen, wie die Darstellung des wirklich Vorgefallenen zur Darstellung des Möglichen. Auch „die Darstellung des wirklich Vorgefallenen - die Geschichte - (ist) ein im Wesen künstlerischer Vorgang“, und „ruft ein ähnliches Interesse hervor wie die Kunst.“21 Geschichte ist also Kunst, beide haben ein gemeinsames Interesse, aber in ihrer jeweiligen Zielsetzung unterscheiden sie sich voneinander. Hierin unterscheidet Croce die Geschichte von der Kunst im engen Sinn.
Gibt es einen Konflikt zwischen dem Inhalt der Kunst und dem Inhalt der Geschichte? Sind sie also zwei Aktivitäten von gleicher Bedeutung, die sich nicht gegenseitig unterordnen lassen? Einerseits besteht ein starkes allgemeines Interesse an Geschichte wie an Kunst, und der Stoffumfang der Geschichte gleicht dem der Kunst. Andererseits ist das historisch Interessante nicht immer von großem menschlichem Interesse. Einen Konflikt zwischen Kunst und Geschichte gibt es, so Croce, nur scheinbar, es gibt lediglich eine Unterscheidung zwischen Geschichte und der Kunst im engen Sinne.
2.5 Der Begriff der Geschichte und der Geschichtsforschung
Die Geschichte beschäftigt sich mit der Darstellung des wirklich Vorgefallenen. Was ist mit dem wirklich Vorgefallenen gemeint? In einer Erweiterung der Definition Bernheims ist es das wirklich Vorgefallene der menschlichen Entwicklung. Diese Definition schaltet das subjektive Element der Geschichte aus und objektiviert sie. Croce legt hier aber besonderen Wert, indem er vom Menschen ausgeht und ihn in den Mittelpunkt stellt.
„Ebenso, wie der Künstler nicht dem Falschen verfallen darf, darf der Historiker nicht dem Imaginären verfallen.“22Daher ist Genauigkeit absolute Pflicht der Historikerin, das Imaginäre bleibt in allem der Kunst im engen Sinne vorbehalten. Die Künstlerin darf sich zwar vom Tatsächlichen zum Möglichen begeben, jedoch nicht bis zur Verfälschung, und ebenso darf die Historikerin zwar ihre eigenen Mittel und Worte für die Darstellung finden und interpretieren, damit darf sie aber die Grenze zum Auffüllen durch Mögliches nicht überschreiten. Die Künstlerin führt vorbereitende Arbeiten durch, indem sie beobachtet, das Vorhandene studiert, ebenso wie die Historikerin den darzustellenden Stoff vorbereitet. Was ihr vorliegt, sind einzelne Quellen unterschiedlichster Art, die aufbereitet werden müssen. Hierzu verwendet die Historikerin die Methoden der Forschung, Kritik, Interpretation und des historischen Verständnisses. Die Arbeit an der eigentlichen Erzählung ist vom Umfang her deutlich unbedeutender als diese vorbereitenden Tätigkeiten, aber das trifft für die Künstlerin wie für die Historikerin gleichsam zu. Für die Historikerin jedoch noch mehr, da sie vielmehr als die Künstlerin der Genauigkeit unterliegt.
Auch die künstlerischen vorbereitenden Tätigkeiten sind von erheblichem Umfang, die besonderen Schwierigkeiten der Historikerin ergeben sich jedoch aus der Verschiedenheit und der Dunkelheit des vorliegenden Gegenstandes. Die Künstlerin bestimmt die Bedingungen ihrer Darstellung selbst, die Historikerin muss sie erst suchen, indem sie z.B. Individuum und Tatsache in einen Motivationszusammenhang stellt. Die Künstlerin wählt sich eine subjektiv wahre Erklärung, die Historikerin muss die objektiv einzige Erklärung finden, die wahr ist.
Doch erst, wenn es möglich ist, aus den Forschungen eine Erzählung zu erstellen, ist die erste Bedingung für wahre Geschichte erfüllt. Was ist mit dem Begriff der Erzählung gemeint? Erzählung kann als Form der Sinnstiftung betrachtet werden.23 Jeder Erzähler muss sich zuvor einen Begriff gebildet haben, unter dem er den Inhalt darstellen will, nur dann kann er die Einzelheiten richtig auswählen und zusammenstellen. Croce ergänzt diese Sicht der Erzählung durch das Moment der Anschaulichkeit. Croces Verständnis von Erzählung kann als sinnstiftendes und veranschaulichendes Genus verstanden werden. Ohne, dass die ganze Wirklichkeit abgebildet wird, entsteht der Eindruck eines vollständigen Geschehnisablaufs.
Meist bleiben die historischen Arbeiten jedoch in vorbereitenden Arbeiten stecken und es bleibt bei fragmentarischen Darstellungen, die nicht das künstlerische Stadium der vollendeten Erzählung erreichen. Die vorbereitenden Arbeiten der Historikerin erweisen sich als ungleich schwerer, weil die Künstlerin ihren Gegenstand vorliegen hat, während die Historikerin ihren Gegenstand erst suchen und offenlegen muss. Ihren Gegenstand vollständig zu recherchieren bleibt eine kaum lösbare Aufgabe für die Historikerin.
Dass sich Ideal (Erzählung einer vollendeten Geschichte) und Wirklichkeit (das Verbleiben in fragmentarischen Darstellungen) nicht decken, ist der menschlichen Unvollkommenheit geschuldet wie der zufälligen Grenzen der historischen Entdeckungen. Das Ideal bleibt dennoch das Ideal, dem jede Geschichtsforschung verpflichtet sein muss. „Die wahre Geschichte müsse Gott schreiben“, zitiert Croce aus dem Dom Carlos, und genau genommen muss man ergänzen, die wahre Geschichte kann nur Gott schreiben. Die Historikerinnen können niemals das ganze Buch lesen, und müssen es dennoch immer wieder versuchen und am Ideal der Geschichtsschreibung festhalten. In der Kunst gibt es ebenso ein Ideal künstlerischer Darstellung, dieses ist aber leichter zu erreichen, weniger unmöglich und gelingt daher öfter.
3 Einwände gegen Croces Einordnung der Geschichte und der Kunst
3.1 Einwände von außen
Croce war nach seiner Rektoratsrede mit verschiedensten kritischen Einwänden konfrontiert. Diese Einwände setzen sich in der Hauptsache mit Argumenten auseinander, die Croce bereits selbst gesehen hatte. In den Polemischen Anmerkungen (1894) zu seiner Rektoratsrede setzt er sich mit den aus seiner Sicht wichtigsten auseinander.
3.1.1 Der Einwand eines zu weiten Kunstbegriffs
Von Bernheim stammt der Einwand, dass Croce den wissenschaftlichen Charakter der Geschichte nur bestreiten konnte, weil er einen zu engen Begriff der Wissenschaft und gleichzeitig einen zu weiten der Kunst zugrunde lege.24 Geschichte stelle ein in sich zusammenhängendes, einheitliches und gesichertes Wissen von einem Gebiet der Erscheinungswelt dar, und ihre Erkenntnis ist für uns wertvoll. Legt man diese Kriterien zugrunde, stellt sich die Frage, so Croce, was dann keine Wissenschaft sei. Nicht jedes Wissen ist wissenschaftliches Wissen, und wenn das Wesen der Wissenschaft ist, die Natur der Dinge zu erfassen und Begriffe zu bilden, dann ist Geschichte keine Wissenschaft. Im Grunde verdreht Bernheim den Vorwurf und legt selbst einen zu weiten Begriff der Wissenschaft an, so Croce.
3.1.2 Der Einwand der wahren Geschichte
Von Mariano stammt der Einwand, dass das, was man gewöhnlich Geschichte nennt, nämlich die historische Erzählung, nicht die wahre Geschichte sei, denn wahre Geschichte habe wissenschaftlichen Charakter.25 Geschichte ist demnach rationale, begrifflich durchdachte Betrachtung, keine Wissenschaft, aber eine Stufe der Wissenschaft, mit der sie das Ziel gemeinsam hat (eine ähnliche Argumentation, wie Croce sie für die Kunst vorbringt). Die Erzählung betrachtet Mariano lediglich als Rohmaterial für das Denken des Historikers, denn das künstlerische Ziel sei nicht das Wesen der Geschichte. Croce argumentiert, dass die Frage nach der Bedeutung der Geschichte nicht mehr zur Geschichte gehört, sondern zur Philosophie, und der Bereich des Denkens nicht mehr der des Historikers sei. Hier wird deutlich, dass Croce die Geschichte noch klar von der Philosophie trennt. Für Croce ist, anders als für Mariano, das erzählerische Element noch die Geschichte schlechthin.
3.1.3 Die Unvollständigkeit der Geschichte
Nitti26 bringt gleich mehrere Einwände vor. Die Unvollständigkeit sei ein Charakteristikum der Geschichte, nicht aber der Kunst. Hierzu verweist Croce wiederum auf die aus seiner Sicht immer zufällige und nicht charakteristische Unvollständigkeit der Geschichte. —
3.1.4 Die Ganzheit der historischen Elemente im Geschichtswerk
Der Künstler verwandelt bei seiner Tätigkeit alle Elemente und verschmilzt sie so zu einem vollendeten Kunstwerk, dass jedes einzelne seine ursprüngliche Bedeutung verliert, gleiches lässt sich über die Geschichte nicht sagen. Die Elemente der historischen Darstellung behalten ihre Ganzheit, sie dürfen gerade nicht umgeformt werden. Croce führt an, dass die einzelnen Elemente des Künstlers im Kunstwerk ihr Interesse verlieren, wir in der Kunst nicht wissen wollen, was wahr ist, sondern was dem Künstler wahr schien.
Das historische Interesse bleibt dagegen auch an den Bestandteilen bestehen. Die Geschichte erhalte ihre eigene Existenz, sie sei weder auf den rein künstlerischen noch auf den wissenschaftlichen Prozess reduzierbar. Croce argumentiert, das gelte sicher für die einzelnen Geschichten, nicht aber für die Natur der Geschichte.
3.2 Einwände, die Croce später selbst vorbringt
Croce entwickelte seine Geschichtsphilosophie in den Folgejahren immer weiter. In einer Neuauflage seiner Rektoratsrede aus dem Jahr 1919 schreibt er, dass er nicht gesehen hat, dass die Geschichte zwar am Möglichen teilhat, aber mehr ist als die rein künstlerische Darstellung, einen höheren Wert darstellt. Geschichtliche Darstellung sei sowohl Darstellung als auch Urteil, allgemein und individuell in einem. Kunst dagegen ist nicht so sehr auf das Nachdenken angewiesen wie die Geschichte. Geschichte ist Kunst, aber sie ist auch mehr als das. Croce betrachtet Philosophie nicht mehr als etwas Eigenes, sondern sieht sie im Zusammenspiel von Dichtung und Geschichtsschreibung als einen Moment des historischen Denkens selbst27.
3.2.1 Einwand der Einheit der Philosophie und der Geschichtsschreibung
In seiner Rektoratsrede sieht Croce die Philosophie noch als außerhalb der Geschichte stehend. „Neben der Geschichte hat sich eine andere Wissenschaft entwickelt, die den Namen 'Geschichtsphilosophie' angenommen hat.“ Er stellt sie der Geschichte gegenüber als ihre kritische Betrachtung, als Wissenschaft der Geschichte.28 Später ändert Croce seine Sicht auf die Philosophie der Geschichte fundamental: Der Geschichtsschreibung sei es nicht möglich, die
Individualität der Tatsachen zu kennen, ohne sie zu denken und urteilend mit dem Allgemeinen zu verbinden, und der Philosophie sei es nicht möglich, das Allgemeine zu denken, ohne sich auf das Individuelle zu beziehen.29
3.2.2 Einwand der Trägheit der Geschichte
Während Croce der Geschichte 1893 noch einen rein betrachtenden Charakter zuordnet, geht er später davon aus, dass die Geschichte eng verbunden sei mit dem Leben und seinen Bedürfnissen. Geschichte ist kein praktisches Tun, aber auch kein regungsloses Betrachten, sie ist theoretisches Tun, das der Praxis dient. Croce stellt eine Verbindung her, einen direkten Bezug zwischen dem reinen Erkennen und dem Handeln in der Praxis, der in seiner Rektoratsrede noch keine Rolle spielte. Solange Geschichte nur auf der Kritik der Zeugnisse aufbaue, so Croce, bleibe sie eine träge Auffassung. Erst mit dem Herstellen des Bezugs zur Praxis kann man die Einheit von Philosophie und Geschichte denken.30
3.2.3 Der Einwand des Primats der Wahrheit
Croce sieht sich in seiner Frühschrift mit der Notwendigkeit konfrontiert, betonen zu müssen, dass die Geschichte nicht an Wert verliere, wenn sie nicht wissenschaftlich sei, der Vorrang der Naturwissenschaften ist erdrückend. Später ändert sich sein Blickwinkel, und es wird ihm wichtig zu betonen, dass die Geschichte nicht weniger und nicht mehr ist als andere Wissenschaften, sondern ihr eigentlicher Mittelpunkt.31 Um ein Ding zu erkennen, muss man es geschaffen haben, und da die Natur nicht vom Menschen geschaffen wurde, kann er sie nicht erkennen. Das Bilden gesetzmäßiger Zusammenhänge verwandelt die Natur in ein mechanisches Geschehen, kann aber nicht zum Erkennen der ganzen Wahrheit führen. Die Geschichte, da sie menschlich ist, besitzt danach den höchsten Grad der wahren Erkenntnis der Wirklichkeit.
3.3 Bedeutung der Einwände für die Sicht auf Croces Frühschrift
Die Rektoratsrede Croces bildete die Basis für die Entwicklung der Geschichtstheorie Benedetto Croces. Hier hatte er sich intensiv mit den Strömungen seiner Zeit auseinandergesetzt, und der allgemeinen Ansicht, Geschichte müsse Wissenschaft sein, gute Argumente entgegengesetzt. Der Positivismus der Zeit erforderte es förmlich, Geschichte als wissenschaftlich einzustufen, um sie nicht abzuwerten, und Croce unternimmt den Versuch einer Einordnung der Kunst unter anderen Gesichtspunkten, ohne zu einer solchen Abwertung zu gelangen. Er zeigt hier bereits auf, dass Geschichte nicht ein weniger Bedeutendes sein muss, weil und wenn sie nicht wissenschaftlich ist. Und wenn er sich hier noch bemüht, eine Abwertung der Geschichte zu vermeiden, gelangt er in seinen späteren Schriften zu der Erkenntnis, dass sie sogar ein Mehr sein kann: Indem er die Selbständigkeit der Geschichtsschreibung herausstellt, sie in den Mittelpunkt der Wissenschaften stellt, ja überordnet. Die Erkenntnisse der Frühschrift stellen die Grundlage für alle weiteren Entwicklungen in Croces Geschichtstheorie dar.
4 Fazit
Geschichte versteht die Gegenstände nicht so wie die Wissenschaft, sie betrachtet. Diese Tätigkeit ist die gleiche, die auch ein Künstler ausführt. Geschichte und Kunst zusammenzuführen ist ein Gedanke, den bereits Dilthey 1883 und Simmel 1892 ausführten. Für Croce ging der Vergleich aber noch weiter: „It is an identity, each is precisely the same thing.“32 Allerdings gibt es auch Unterschiede: Der Künstler stellt dar, was er sieht, und nicht mehr. Der Historiker muss beides tun, darstellen, was er sieht und darauf achten, dass das, was er darstellt, wahr ist. Kunst stellt das Mögliche dar, Geschichte das wirklich Vorgefallene, aber das wirklich Vorgefallene ist immer auch ein Bereich des Möglichen. Das ist der Grund, warum Geschichte in den Bereich der Kunst fallen kann.
Literaturverzeichnis
Collingwood, R. G.; van der Dussen, W. J. (1994): The idea of history. [Rev. edition.], with lectures 1926-1928. Oxford, New York: Oxford University Press.
Croce, Benedetto (1944): Die Geschichte als Gedanke und Tat. Einführung von Hans Barth.
Marion von Schröder Verlag Hamburg.
Croce, Benedetto; Fellmann, Ferdinand (1984): Die Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst gebracht. Hamburg: Felix Meiner (Philosophische Bibliothek, Bd. 371).
Schopenhauer, Arthur; Löhneysen, Wolfgang Frhr. von (2004): Die Welt als Wille und
Vorstellung Band II, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt.
Simmel, Georg (1892): Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Eine erkenntnistheoretische Studie. Online verfügbar unter https://www.europeana.eu/de/item/9200520/12148_bpt6k92089w?utm_source=api&utm_med ium=api&utm_campaign=YuvuWBeCa, zuletzt geprüft am 01.01.2022
[...]
1 Wo es möglich ist, ohne Textbezüge offensichtlich zu verfälschen, verwende ich in dieser Arbeit das generische Femininum. Andere Formen sind dabei mitgedacht.
2 An der Akademie Pontaniana gehaltene Rede, Neapel, 5. März 1893
3Croce, Die Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst gebracht, S. 5
4Croce, Die Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst gebracht, S. 7
5Croce, aaO, S. 11
6Croce, aaO, S. 11
7Croce, aaO, S. 12
8 Croce, aaO, S. 14
9 Croce, aaO, S. 15
10 Simmel, Probleme der Geschichtsphilosophie, S. 367
11 Simmel, aaO, S. 367
12 Simmel, aaO, S. 375
13 Croce, aaO, S. 26
14 Croce, aaO, S. 22
15 Croce, aaO, S. 23
16 Croce, aaO, S. 25
17 Croce, aaO, S. 25
18 Croce, aaO, S. 28
19 Croce, aaO, S. 31
20 Croce, aaO, S. 32
21 Croce, aaO, S. 33
22 Croce, aaO, S. 35
23 Fellmann, in: Croce, aaO, S. XII
24 Croce, aaO, S. 46f.
25 Croce, aaO, S. 51
26 Croce, aaO, S. 56
27 Croce, Die Geschichte als Gedanke und als Tat, S. 272
28 Croce, Die Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst gebracht, S. 21
29 Croce, Die Geschichte als Gedanke und als Tat, S. 280
30 Croce, aaO, S. 284
31 Barth, in Croce, aaO, S. 11
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptgegenstand von Croces "Die Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst gebracht"?
Die Schrift behandelt die Frage, ob Geschichte eher als Wissenschaft oder als Kunst einzuordnen ist. Croce argumentiert, dass Geschichte aufgrund ihrer narrativen Struktur und der Darstellung individueller Wirklichkeit eher der Kunst zuzuordnen ist.
Wie definiert Croce Kunst in diesem Text?
Croce definiert Kunst nicht durch sinnliches Vergnügen oder formale Beziehungen, sondern als den sinnlichen Ausdruck einer Idee, die Darstellung eines konkreten Inhalts oder einer individuellen Wirklichkeit.
Wie unterscheidet Croce Wissenschaft von Kunst?
Wissenschaft erforscht das Allgemeine und bildet Begriffe, während Kunst die individuelle Wirklichkeit darstellt. Geschichte befasst sich mit konkreten, individuellen Tatsachen und kann daher keine allgemeingültigen Gesetze formulieren.
Warum ordnet Croce die Geschichte der Kunst zu?
Croce argumentiert, dass Geschichte wie die Kunst die individuelle Wirklichkeit darstellt und Erzählungen formt. Er vergleicht die Tätigkeit des Historikers mit der des Künstlers, der ebenfalls Tatsachen darstellt und Geschichten erzählt.
Was versteht Croce unter "wahrer Geschichte"?
"Wahre Geschichte" entsteht, wenn aus dem historischen Stoff eine Erzählung geformt wird. Die wissenschaftlichen Vorarbeiten zur Geschichtsschreibung sind demnach nicht die "wahre Geschichte", sondern die Erzählbarkeit des Stoffes macht die Geschichte aus.
Welche Kritik wurde an Croces These geäußert?
Croce wurde für seinen weiten Kunstbegriff kritisiert, der es ihm ermöglichte, die Geschichte der Kunst zuzuordnen. Einwände betrafen auch die wissenschaftliche Natur der Geschichte und die Bedeutung der Forschung gegenüber der Erzählung. Croce selbst revidierte später seine Position, insbesondere im Hinblick auf die Verbindung von Geschichte und Philosophie.
Wie hat Croce seine eigene These später revidiert?
In späteren Schriften näherte Croce die Philosophie und die Geschichtsschreibung einander an. Er betrachtete die Geschichte nicht mehr nur als reine Darstellung, sondern auch als Urteil. Zudem betonte er die Bedeutung der Geschichte für das Leben und die Praxis.
Was ist der Unterschied zwischen Kunst im engeren Sinne und Geschichte nach Croce?
Kunst im engeren Sinne kann mögliche Wirklichkeiten abbilden, während die Geschichte die Aufgabe hat, wirklich Vorgefallenes darzustellen. Beide haben das Interesse an der Darstellung der Wirklichkeit gemeinsam.
Was ist die Rolle der Erzählung in der Geschichtsschreibung nach Croce?
Die Erzählung ist essentiell für die "wahre Geschichte". Sie stiftet Sinn, indem sie einen Begriff formt, unter dem der Historiker den Inhalt darstellt, und vermittelt einen anschaulichen Eindruck eines vollständigen Geschehnisablaufs.
Wie sieht Croce das Verhältnis von Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung?
Croce unterscheidet zwischen den vorbereitenden Forschungsarbeiten der Historikerin und der eigentlichen Erzählung. Die Forschung dient der Aufbereitung des Materials, die Erzählung ist das künstlerische Element, das die Geschichte ausmacht.
- Quote paper
- Claudia Ostermann (Author), 2023, Einordnung der Geschichte unter den allgemeinen Begriff der Kunst bei Benedetto Croce, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1347206