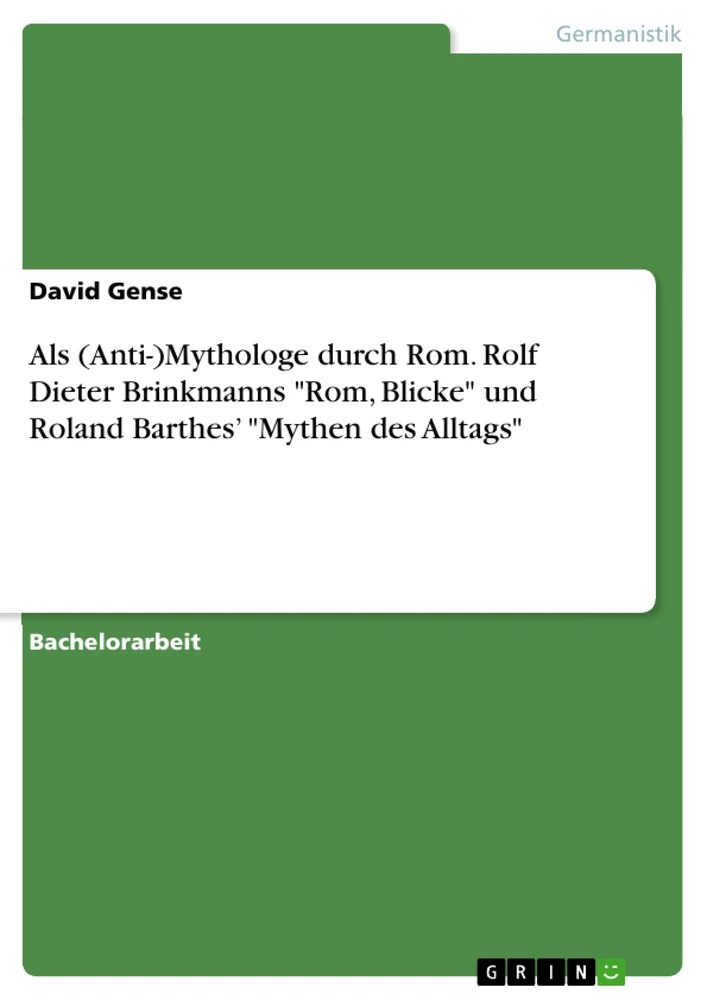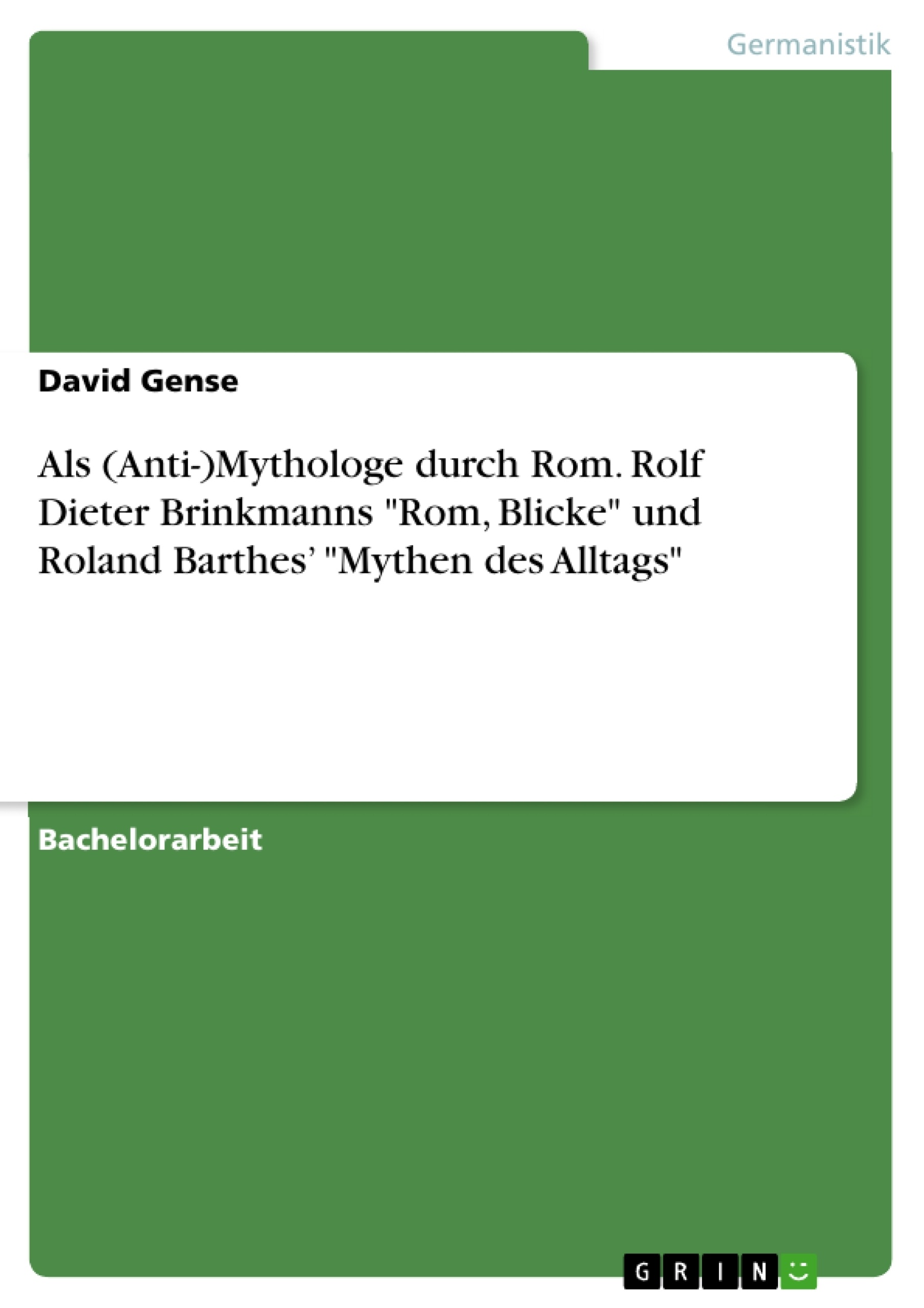Diese Bachelorarbeit geht der Frage nach, ob sich die Werke "Rom, Blicke" von Rolf Dieter Brinkmann und "Mythen des Alltags" von Roland Barthes anhand der Funktion des Mythologen miteinander vergleichen lassen.
Um das zu klären, diskutiert der Autor zuerst die Frage, ob die beiden ähnliche Standpunkte zur kulturellen Sinnproduktion, das heißt im engeren Sinne zur Sprache, vertreten. Dafür behandelt er im nachfolgenden Kapitel kurz ihr gemeinsames Interessensthema der Sprachkritik, das anschließend im Unterkapitel anhand von Barthes’ Lektion erläutert wird. In diesem Zuge entfalten sich einerseits grundlegende Ambitionen, die seinen Hang zur Ideologiekritik erklären, und andererseits seine Utopien der Literatur und lustvollen Semiologie darlegen.
Während Ersteres bereits entscheidende Implikationen zu Barthes’ Gesellschaftsskepsis bereithält, die mit jenen von Brinkmann verglichen werden können, gestalten sich die Utopien, die er auch 1977 als Programm seines Lehrfachs verkündet, schwierig. Auf den ersten Blick weisen sie Reibungspunkte zu seinem 1957 formulierten mythologischen Programm auf. Das zweite Unterkapitel ist daher einer kurzen methodengeschichtlichen Skizze gewidmet, der Erläuterung des Mythosbegriffs sowie einer eingehenderen werkübergreifenden Perspektive. Damit ergeben sich wichtige Vergleichskriterien hinsichtlich der Außenseiterposition und auch dem Entlarvungsgestus, die im nachfolgenden Unterkapitel nochmals zusammengefasst und für die Analyse brauchbar gemacht werden. Im dritten Kapitel folgt die Analyse von "Rom, Blicke", in der der Autor seine Thesen zur Ähnlichkeit überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Brinkmanns Rom, Blicke
- 1.2 Brinkmann als (Anti-)Mythologe?
- 2. Sprachkritik und Sprachutopie
- 2.1 Roland Barthes Lektion
- 2.1.1 Die Kritik (in) der Lektion
- 2.1.2 Die Utopie in der Lektion
- 2.1.3 Die Disziplin der lustvollen Semiologie
- 2.2 Die Mythen des Alltags zwischen Kritik und Utopie
- 2.2.1 Das strukturalistische Faible
- 2.2.2 Der Mythos und seine Gegenmittel
- 2.2.3 Der lustvolle Außenseiter
- 2.2.4 Das (utopische) diverse Leben
- 2.3 Die Vergleichskriterien zum (Anti-)Mythologen
- 3. Rolf Dieter Brinkmann als (Anti-)Mythologe
- 3.1 Inmitten einer falschen Natur – Demontage und Kritik
- 3.1.1 Agonie zwischen Objektsprache und Gegenmythen
- 3.1.2 Brinkmann und Barthes im Kritikvergleich
- 3.2 Inmitten der Gesellschaft – Kritik und Utopie
- 3.2.1 Brinkmann und Barthes als Außenseiter
- 3.2.2 Utopie des Lebens und Kritik des Todes
- 4. Rolf Dieter Brinkmann – Mythologe oder nicht?
- 4.1 Ein Nachwort zur unausgesprochenen Utopie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Werk Rom, Blicke von Rolf Dieter Brinkmann im Lichte der Mythenkritik von Roland Barthes. Sie analysiert die Kritik und Utopie, die Brinkmann in seinem Text an Sprache und Gesellschaft formuliert, und stellt sie in Beziehung zu Barthes' Konzeption des Mythologen. Dabei stehen die sprachkritischen und -utopischen Elemente in Brinkmanns Werk im Vordergrund, insbesondere seine kritische Auseinandersetzung mit der konsumgeprägten Kultur und den Mythen der modernen Gesellschaft.
- Kritik an Sprache und Gesellschaft in Rom, Blicke
- Brinkmanns Gebrauch der Collage als künstlerisches Mittel
- Vergleich der Mythenkritik von Brinkmann und Barthes
- Die Rolle des (Anti-)Mythologen in der modernen Gesellschaft
- Die Ambivalenz von Brinkmanns Werk zwischen Kritik und Utopie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Rolf Dieter Brinkmann als ambivalenten Autor vor, der durch seinen Gedichtband Westwärts 1&2 Bekanntheit erlangte. Der Fokus liegt auf Brinkmanns Werk Rom, Blicke, einer experimentellen Collage aus Briefen, Tagebuchaufzeichnungen und Fotos, die Brinkmanns kritischen Blick auf Sprache und Gesellschaft zeigt. Die Arbeit stellt die Frage, ob Brinkmann als (Anti-)Mythologe im Sinne von Roland Barthes betrachtet werden kann.
Kapitel 2 widmet sich Barthes' Konzept des Mythologen und seiner Analyse der Mythen der modernen Gesellschaft. Es werden die Kritik und Utopie in Barthes' Werk herausgearbeitet, sowie die Rolle des Außenseiters als Mythologe. Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen für den Vergleich mit Brinkmanns Werk.
Kapitel 3 untersucht Brinkmanns Werk Rom, Blicke im Lichte von Barthes' Mythenkritik. Es werden die sprachkritischen und -utopischen Elemente in Brinkmanns Werk beleuchtet, die er durch die Verwendung der Collage-Technik zum Ausdruck bringt. Die Arbeit zeigt, wie Brinkmann die Mythen der modernen Gesellschaft entlarvt und gleichzeitig eine alternative Sichtweise auf die Welt präsentiert.
Kapitel 4 fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und diskutiert die Frage, ob Brinkmann als Mythologe oder (Anti-)Mythologe bezeichnet werden kann. Es wird argumentiert, dass Brinkmanns Werk Elemente beider Kategorien aufweist und eine komplexe Verbindung zwischen Kritik und Utopie darstellt.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Rolf Dieter Brinkmann, Rom, Blicke, Mythenkritik, Roland Barthes, (Anti-)Mythologe, Sprachkritik, Sprachutopie, Collage, Moderne Gesellschaft, Kulturkritik, Konsumgesellschaft, Kunst, Literatur, Kritik, Utopie.
- Citation du texte
- David Gense (Auteur), 2021, Als (Anti-)Mythologe durch Rom. Rolf Dieter Brinkmanns "Rom, Blicke" und Roland Barthes’ "Mythen des Alltags", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1347315