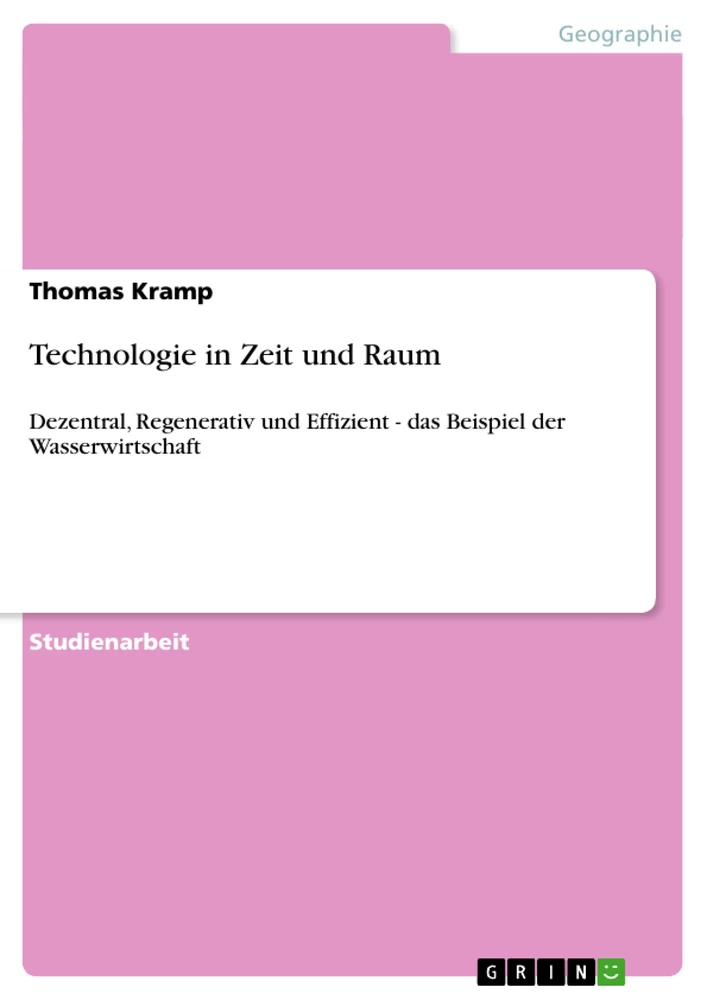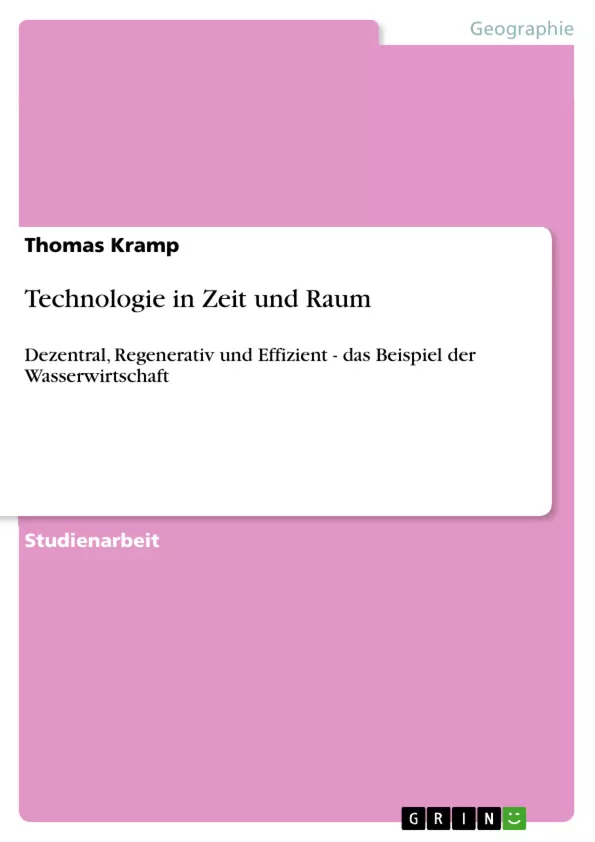In der Arbeit geht es hauptsächlich um die großräumige Wasserwirtschaft des Umlandes, am Beispiel der Bundesrepublik
Deutschland.
Zunächst wird die aktuelle Situation in der Wasserwirtschaft beschrieben. Anschließend wird der Begriff der nachhaltigen Wasserwirtschaft behandelt, um darauf aufbauend ein Fazit darüber zu ziehen, ob die Wasserwirtschaft in Deutschland dezentral, regenerativ, effizient und somit auch nachhaltig ist.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Wasserwirtschaft?
1.2 effizient?
1.3 regenerativ?
2. wasserwirtschaftliche Gegebenheiten
2.1 natürliche Bedingungen
2.2 Wasserdargebot & Wasserbedarf
2.2.1 Wasserdargebot und Klimawandel
2.3 Probleme der Wasserwirtschaft
2.3.1. Gewässermorphologie
2.3.2 Landwirtschaft
3. nachhaltige Wasserwirtschaft
3.1 Prinzipien einer nachhaltigen Wasserwirtschaft
3.2 Wasserwirtschaft & Agenda
3.3. Wasserwirtschaft und EU Wasserrahmenrichtlinie
3.3.1 Ergebnisse der Wasserrahmenrichtlinie
4. Wasserwirtschaft in Deutschland - effizient, dezentral und regenerativ?
4.1 nachhaltige Wasserwirtschaft?
5. Fazit
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Wasserdargebot und Wasserbedarf in Deutschland
Abbildung 2: gewerblicher Wasserverbrauch
Abbildung 3: Trinkwasserherkunft
Abbildung 4: Trinkwasserverbrauch
Abbildung 5: Grundschema zur Quantifizierung der Stoffeinträge in Gewässer
Abbildung 6: Entwicklung des Nährstoffüberschusses in der Landwirtschaft
Abbildung 7: Stickstoff- und Phosphoremissionen in die Gewässer Deutschlands
Abbildung 8: Wassereinsatz in Landwirtschaft
Abbildung 9: Prinzipien einer nachhaltigen Wasserwirtschaft
Abbildung 10: Zeitplan der Wasserrahmenrichtlinie
Abbildung 11: Wasserverbrauch und -entgelt in der EU und international
Abbildung 12: Ergebnisse der Bestandsaufnahme
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Prinzipien einer nachhaltigen Wasserwirtschaft
Tabelle 2: Agenda 21 - Kapitel 18
Tabelle 3: Agenda 21 - Kapitel 18 für die Bundesrepublik Deutschland
Tabelle 4: Größe der Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland
Tabelle 5: Mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit kompatible Trends
Tabelle 6: Mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit inkompatible Trends
1. Einleitung
In der Einleitung soll das Thema genauer bestimmt und erläutert werden. Darauf folgend wird die aktuelle Situation in der Wasserwirtschaft beschrieben. Anschließend wird der Begriff der nachhaltigen Wasserwirtschaft behandelt, um darauf aufbauend, im Hinblick auf die aktuelle Situation, ein Fazit darüber zu ziehen, ob die Wasserwirtschaft in Deutschland dezentral, re-generativ, effizient und somit auch nachhaltig ist.
Das Beispiel der Wasserwirtschaft ist ein sehr umfangreiches Gebiet, aus diesem Grunde wurde es in zwei Bereiche geteilt, welche sich jeweils auf die Wasserwirtschaft des Umlands bzw. der Stadt konzentrieren werden, in der nachfolgender Belegarbeit soll es hauptsächlich um die großräumige Wasserwirtschaft des Umlandes, am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland, gehen.
1.1 Wasserwirtschaft?
Unter Wasserwirtschaft versteht man die Umverteilung des natürlichen Wasserdargebots in Zeit und Raum, gemäß den Bedürfnissen der Gesellschaft nach Wassermenge und Wassergü-te. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen der Wassernutzung (z.B. Trinkwasser, Bewässe-rung, Wasserkraft) oder um Schutz vor dem Wasser (z.B. Hochwasser, Vernässung von Bö-den) (Kahlenborn, Kramer; 1998; S. 1). Damit zählen zur Wasserwirtschaft sowohl Fragen der Wassermengenwirtschaft und der Gewässergüte, wie auch der Gewässermorphologie (ebd.). Wesentliche Aktivitäten der Wasserwirtschaft sind u.a. Wasserversorgung und –ent-sorgung, Be- und Entwässerungsmaßnahmen in der Landwirtschaft, als auch Maßnahmen zum Hochwasserschutz (Steinberg; 2002; S. 1). Wasserwirtschaft kann daher auch, als die zielbewusste Ordnung aller menschlichen Einflüsse, auf das ober- und unterirdische Wasser, verstanden werden (Ludin; S. 33).
In diesem Licht soll Wasserwirtschaft auch in der folgenden Arbeit betrachtet werden, wobei wie schon in der Einleitung dargelegt, auf Aspekte des Umlandes, d.h. der großräumigen Wasserwirtschaft, ein besonderes Augenmerk gerichtet werden soll.
1.2 effizient?
In der Volkswirtschaftslehre wird ein Prozess als effizient bezeichnet, wenn es keine andere Möglichkeit gibt mit der gleichen oder einer geringeren Inputmenge, eine gleiche oder größe-re Outputmenge zu produzieren (Ahlert; S. 37). An dieser Definition soll hier auch die Was-serwirtschaft gemessen werden, allerdings nicht in einer rein betriebswirtschaftlichen Weise, d.h. maximale Gewinne bei minimalen Kosten. Der Begriff der Effizienz soll vielmehr auch auf Bereiche wie die Nutzung des Wasserdargebotes, d.h. Nutzenmaximierung bei minimalen Ressourceneinsatz, Anwendung finden. Maßgebliches Effizienzkriterium ist das Verhältnis zwischen Nutzen/Ertrag und Aufwand (Kluge; Berlin; 2005; S. 13), wobei der Aufwand auch die Beeinträchtigung oder der Verbrauch einer natürlichen Ressource (Kluge; Berlin; 2005; S. 42) sein kann. Es wird somit nicht nur die ökonomische Effizienz, sondern auch die ökologi-sche Effizienz betrachtet.
1.3 regenerativ?
Dem Wesen der Bedeutung des Wortes regenerativ bzw. Regeneration, für wiedergewinnend oder Wiederauffrischung, entsprechend, wird eine effiziente, dezentrale und regenerative Wasserwirtschaft im Weiteren, im Sinne der Nachhaltigkeit betrachtet denn Nachhaltigkeit bedeutet die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne dass nachfolgende Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können (Steinberg; Berlin; 2002; S. 3). Auch die Enquete-Kommission des Bundestages stellte einen Zusammenhang zwischen Regeneration und nachhaltiger Entwicklung her (ebd.; S. 6), denn natürliche Ressourcen können in ihrer Verfügbarkeit nicht geändert werden, sie müssen so genutzt werden, dass sie sich immer wieder regenerieren, d.h. nachbilden können (Umweltbundesamt; Berlin; 2001; S. 6). Effi-zienz und Dezentralität finden ebenfalls als Ressourcenminimierungs- und Regionalitätsprin-zip Eingang in das Leitbild der Nachhaltigkeit (Kahlenborn; Berlin; 1998; S. 4).
2. wasserwirtschaftliche Gegebenheiten
Unter wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten sind grundsätzliche Umstände zu verstehen, welche bspw. durch das Klima und die geographische Lage bestimmt sind oder die momenta-ne Situation der Wasserwirtschaft beschreiben. Einige verdienen, insbesondere im Hinblick auf eine nachhaltige Wasserwirtschaft, Beachtung, da es sich z.T. um Tatsachen handelt, wel-che nicht ohne weiteres revidierbar sind. In erster Linie geht es hier aber um eine Be-standsaufnahme, um die Situation der Wasserwirtschaft bewerten zu können.
2.1 natürliche Bedingungen
Ohne näher darauf einzugehen, soll hier für die deutsche Wasserwirtschaft, eine kurze Be-schreibung der naturgegebenen Ausgangslage erfolgen, da natürlichen Gegebenheiten, wie das Klima, die Grundlage der Wasserwirtschaft bilden und diese maßgeblich beeinflussen. Deutschland hat, aufgrund seiner Lage in der gemäßigten humiden Klimazone (BMU; Berlin; 2006; S. 7), für die häufige Wetterwechsel und Niederschläge, zu allen Jahreszeiten charakte-ristisch sind (ebd.), eine mittlere jährliche Niederschlagshöhe von 789 mm (ebd.), wobei die Niederschlagsmengen regional stark schwanken (ebd.).
Das Landschaftsbild der Bundesrepublik wird wesentlich von oberirdischen Gewässern ge-prägt (ebd.; S.10), obwohl Wasserflächen mit 2,3% (ebd.; S. 7) einen eher geringen Anteil an der Gesamtfläche Deutschlands haben.
Sechs große Stromsysteme durchziehen die Bundesrepublik hin zu verschiedenen Küstenregi-onen (ebd.). Die Flüsse Rhein, Weser, Ems und Elbe münden in die Nordsee (ebd.), die Oder fließt zur Ostsee hin (ebd.) und die Donau zum Schwarzen Meer (ebd.). Die Stromsysteme sind zum Teil durch schiffbare Kanäle miteinander verbunden (ebd.) und bilden teilweise die Grundlage für die Einteilung der Oberflächengewässer in Flussgebietseinheiten nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie.
Seen und zusammenhängende Seengebiete finden sich vorwiegend im Norddeutschen Tief-land (ebd.; S. 10) und im Alpenraum (ebd.). So schließt die Landschaft des süddeutschen Al-penvorlandes große Seen mit ein (ebd.) und geht nach Süden in die Hochalpen mit ihren zahl-reichen Gebirgsseen über (ebd.).
Trotz eines insgesamt ausreichenden Wasserdargebotes (ebd.; S. 60), gibt es auch in Deutschland Wassermangelgebiete mit geringen nutzbaren Grundwasservorkommen (ebd.), dies trifft vor allem auf Ballungsgebieten zu, wo der Wasserbedarf das Angebot übersteigt (ebd.). Der Ausgleich zwischen solchen Wassermangelgebieten und Wasserüberschussgebieten erfolgt durch Fernwasserleitungen (ebd.).
2.2 Wasserdargebot & Wasserbedarf
Mit einem verfügbaren Wasserdargebot von 188 Mrd. m3 (BMU; Berlin; 2006; S. 10) zählt Deutschland zu den wasserreichen Ländern. Diese Zahl gibt die Menge von nutzbarem Grund- und Oberflächenwasser an (ebd.). Es handelt sich hierbei um eine bilanzierte Größe, welche sich u.a. aus der Niederschlags- und Verdunstungsmenge und der Zu- und Abflussbi-lanz ergibt (ebd.).
Der Anteil der Oberflächengewässer an der Wasserversorgung liegt bei weniger als 10% der mittleren Abflussmenge (Umweltbundesamt; Berlin; 2001; S. 10) und könnte noch weiter erhöht werden (ebd.). Das Grundwasser wird dagegen wesentlich stärker genutzt, so wird rund ein Drittel des in Deutschland verfügbaren Grundwassers für die Versorgung verwendet (ebd.). Dieser Anteil lässt sich, ohne spürbare Nachteile, auch nicht weiter erhöhen (ebd.), ein Umstand der besonders unter den Blickpunkt einer nachhaltigen bzw. regenerativen Wasser-wirtschaft Beachtung verdient.
2001 wurden insgesamt 38 Mrd. m3 Wasser (BMU; Berlin; 2006; S. 60) entnommen. Den größten Anteil an der Nutzung des Wasserdargebotes haben, wie aus der untenstehenden Ab-bildung ersichtlich, Wärmekraftwerke, wobei mit 79,8% der weitaus größte Teil des verfüg-baren Wassers ungenutzt bleibt.
Abbildung 1: Wasserdargebot und Wasserbedarf in Deutschland
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
(BMU; Berlin; 2006; S. 11)
Trinkwasser macht mit 2,9% einen vergleichsweise geringen Teil der Wassernutzung aus, sodass durch diese Nutzungsform keine mengenmäßige Verknappung der Ressource zu be-fürchten ist (Kluge; Berlin; 2003; S. 34). Jedoch gibt es, wie bereits unter 2.1 angesprochen, regionale Unterschiede (ebd.), d.h. Wassermangelgebiete oder Regionen mit großer Nachfra-ge bzw. qualitativ schlechten Rohwasservorräten (ebd.). Diese Unterschiede müssen mittels Fernwasserversorgung aus den Wasserüberschussgebieten ausgeglichen werden (ebd.).
Der Bedarf von Wärmekraftwerken, Bergbau und verarbeitendes Gewerbe wird zum größten Teil aus den Oberflächengewässern gedeckt (BMU; Berlin; 2006; S. 60). Beispielsweise stammen 99% (ebd.) des Kühlwassers der Kraftwerke aus Flüssen bzw. Seen, bei einer Nut-zung von 10% der Oberflächengewässer (Umweltbundesamt; Berlin; 2001; S. 10), stellen auch diese Entnahmen keine Gefahr für die Wasserversorgung dar. Allerdings ist anzumer-ken, dass der Bedarf in allen Bereichen seit 1991, z.T. sehr deutlich zurückgegangen ist (ebd.). In erster Linie wird dieses auf eine effektivere und sparsamere Nutzung des gewonne-nen Wassers zurückgeführt (ebd.). Erreicht wird dieses u.a. durch den Einsatz von Kreislauf-systemen, welche eine mehrfache Nutzung ermöglichen. Im industriellen Bereich liegt der durchschnittliche Nutzungsfaktor aus Wassereinsatz und tatsächlich genutzter Menge bei 4,9 (ebd.), bei Kraftwerken beträgt er 2,9 (ebd.).
Abbildung 2: gewerblicher Wasserverbrauch
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Inwieweit dieser Rückgang mit dem Niedergang der ostdeutschen Industrie und dem allge-meinen wirtschaftlichen Wandel, hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft, zusammenhängt, muss offen bleiben. Sicherlich haben aber auch diese Entwicklungen zum schwindenden Ver-brauch beigetragen.
Der Bedarf an Trinkwasser wird zu 74% aus Grund- und Quellwasser gedeckt (ebd.; S. 61), die Grundwasserressourcen sind damit für die Wasserversorgung von Haushalten und Gewer-be am wichtigsten (Kluge; Berlin; 2003; S. 36), dass übrige stammt aus Uferfiltraten und O-berflächengewässern (BMU; Berlin; 2006; S. 61).
Abbildung 3: Trinkwasserherkunft
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
eigener Entwurf nach Statistisches Bundesamt
Wie in der Industrie, ist auch der Trinkverbrauch rückläufig (ebd.). Durchschnittlich verbrau-chen die Deutschen jeden Tag pro Kopf 127 Liter Trinkwasser (ebd.), allerdings ist der Ver-brauch in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich (ebd.).
Abbildung 4: Trinkwasserverbrauch
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
eigener Entwurf nach BMU; Berlin; 2006; S. 61
Abschließend lässt sich somit sagen, dass der Wasserverbrauch in allen Bereichen von einem Rückgang gekennzeichnet ist, Ursachen dafür sind ein verändertes Verbrauchsverhalten und der Einsatz von Wasserspartechniken. Außerdem ist auch die Bedeutung des Grundwasser-körpers für die Trinkwasserversorgung zu beachten.
2.2.1 Wasserdargebot und Klimawandel
Im Hinblick auf den sich abzeichnenden Klimawandel haben Szenarioberechnungen für Deutschland folgendes Bild ergeben.
Die Winterniederschläge könnten bis 2080 um 30% zunehmen (BMU; Berlin; 2006; S. 14), dagegen könnten die Sommerniederschläge um 30 % (ebd.) abnehmen. Es würde somit zu einer Verschiebung der Niederschläge vom Sommer in den Winter kommen (ebd.). Die Starkniederschläge würden vor allem im Winter intensiver und häufiger (ebd.). Durch das veränderte Niederschlagsgeschehen werden die, aus häufigen und intensiven Niederschlägen resultierenden, Hochwasser zunehmen (ebd.; S. 15).
Die deutsche Wasserwirtschaft wird regional stark differenziert von der Klimaänderung be-troffen sein (ebd.; S. 14). In Gebieten mit gut durchlässigen Böden wird die Grundwasserneu-bildung, aufgrund der höheren Winterniederschläge zunehmen (ebd.). Dies führt, trotz gerin-gerer Sommerniederschläger und einer erhöhten potenziellen Verdunstung (ebd.), zu einem höheren Grundwasserdargebot (ebd.). Das Grundwasserdargebot in Regionen mit schlecht durchlässigen Böden und Böden mit geringer Wasserspeicherkapazität wird dagegen zurück-gehen (ebd.). Eine Abnahme der Grundwasservorräte wird vor allem in Nord- und West-deutschland, sowie in Teilen Ostdeutschlands, erwartet (ebd.). Regionale Engpässe, insbeson-dere bei länger anhaltenden Trockenperioden, sind damit nicht auszuschließen (ebd.). Auf-grund der Tatsache, dass die Grundwasserneubildungsrate die Entnahmemenge bisher in der Regel übersteigt (ebd.), wird es aber in der Bundesrepublik, auch unter geänderten Klimabe-dingungen, keine grundsätzlichen Probleme mit der Trinkwasserversorgung geben (ebd.).
2.3 Probleme der Wasserwirtschaft
Die Probleme der Wasserwirtschaft im Umland sind sowohl qualitativer, als auch morpholo-gischer Natur. Nachfolgend soll es hauptsächlich um Fragen der Gewässermorphologie und Verschmutzungen, durch die Landwirtschaft, gehen. Natürlich wird Wasser nicht nur durch Stoffeintrag aus der Landwirtschaft gefährdet, aber Landwirtschaftsflächen haben mit 53% (BMU; Berlin; 2006; S. 7) der Gesamtfläche der Bundesrepublik, die größte räumliche Aus-dehnung und somit starken Einfluss auf die großräumige Wasserwirtschaft. Im Rahmen des Planungsprozesses zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) zeigte sich, wel-chen großen Anteil die Landwirtschaft an den bestehenden Belastungen hat (ebd.; S. 87). So sind für die Belastungen des Grundwassers fast ausschließlich diffuse Quellen aus der Land-wirtschaft verantwortlich (ebd.). Außerdem gewinnt, mit der immer wirkungsvolleren Abwas-seraufbereitungstechnik, welche zu einer Abnahme der Gewässerbelastung aus punktuellen Quellen geführt hat (ebd.; S. 88), die Verschmutzung aus diffusen Quellen, insbesondere landwirtschaftlichen, an Bedeutung (ebd.), da die Einflüsse der viel leichter zu überwachen-den punktförmige Schadstoffquellen (Umweltbundesamt; Berlin; 2001; S. 19), wie z.B. kommunale Kläranlagen oder einzelne Betriebe, teilweise deutlich zurückgegangen sind (ebd.). Die folgende Abbildung soll noch einmal die Bedeutung der diffusen landwirtschaftli-chen Quellen zeigen.
Abbildung 5: Grundschema zur Quantifizierung der Stoffeinträge in Gewässer
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema des Dokuments?
Das Dokument befasst sich mit der Wasserwirtschaft in Deutschland und untersucht, inwiefern sie effizient, dezentral, regenerativ und somit nachhaltig ist. Es werden sowohl natürliche Gegebenheiten, Wasserdargebot und -bedarf, als auch Probleme der Wasserwirtschaft, insbesondere durch die Landwirtschaft, beleuchtet.
Welche natürlichen Bedingungen werden im Dokument erwähnt?
Das Dokument beschreibt die naturgegebenen Bedingungen in Deutschland, wie das Klima (gemäßigte humide Klimazone), die Niederschlagsmenge (durchschnittlich 789 mm jährlich), das Vorhandensein von oberirdischen Gewässern und sechs großen Stromsystemen. Es wird auch auf regionale Unterschiede im Wasserdargebot und das Vorkommen von Wassermangelgebieten hingewiesen.
Wie wird das Wasserdargebot und der Wasserbedarf in Deutschland beschrieben?
Deutschland wird als wasserreiches Land mit einem verfügbaren Wasserdargebot von 188 Mrd. m3 beschrieben. Der größte Anteil an der Wassernutzung entfällt auf Wärmekraftwerke. Der Trinkwasserverbrauch macht einen vergleichsweise geringen Teil aus, sodass keine mengenmäßige Verknappung der Ressource zu befürchten ist. Der Bedarf an Trinkwasser wird zu 74% aus Grund- und Quellwasser gedeckt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Wasserverbrauch in allen Bereichen rückläufig ist.
Welche Auswirkungen des Klimawandels werden für die Wasserwirtschaft erwartet?
Szenarioberechnungen deuten darauf hin, dass die Winterniederschläge bis 2080 zunehmen und die Sommerniederschläge abnehmen könnten. Dies führt zu einer Verschiebung der Niederschläge und häufigeren Hochwassern. Die Auswirkungen werden regional unterschiedlich sein. In Gebieten mit gut durchlässigen Böden wird die Grundwasserneubildung zunehmen, während sie in Regionen mit schlecht durchlässigen Böden abnehmen wird.
Welche Probleme der Wasserwirtschaft werden im Dokument hervorgehoben?
Probleme der Wasserwirtschaft umfassen qualitative und morphologische Aspekte. Es geht hauptsächlich um Fragen der Gewässermorphologie und Verschmutzungen, die durch die Landwirtschaft verursacht werden. Insbesondere werden diffuse Quellen aus der Landwirtschaft als Hauptursache für die Belastung des Grundwassers genannt. Mit zunehmender Effektivität der Abwasseraufbereitungstechnik gewinnt die Verschmutzung aus diffusen Quellen an Bedeutung.
Was versteht man unter effizienter, dezentraler und regenerativer Wasserwirtschaft im Sinne der Nachhaltigkeit?
Eine effiziente, dezentrale und regenerative Wasserwirtschaft wird im Sinne der Nachhaltigkeit betrachtet, wobei Nachhaltigkeit bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne dass nachfolgende Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können. Dies beinhaltet die Nutzung natürlicher Ressourcen in einer Weise, die ihre Regeneration ermöglicht.
Welche Rolle spielt die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL)?
Die EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) wird im Dokument erwähnt. Die Analyse im Rahmen des Planungsprozesses zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) zeigte sich, welchen großen Anteil die Landwirtschaft an den bestehenden Belastungen hat.
- Citation du texte
- Thomas Kramp (Auteur), 2007, Technologie in Zeit und Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134788