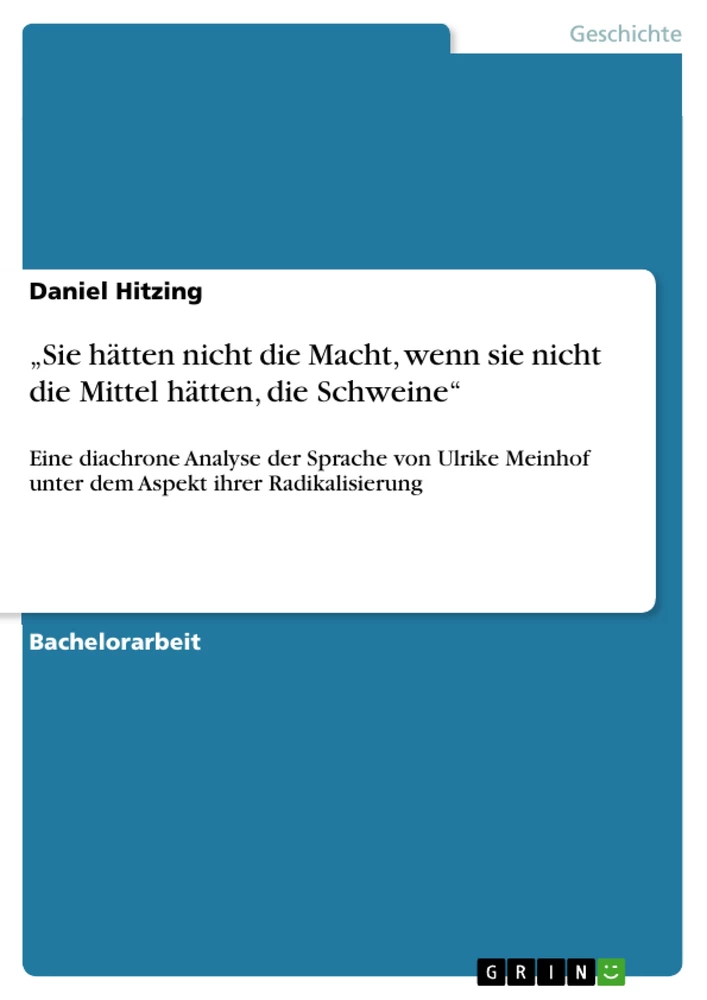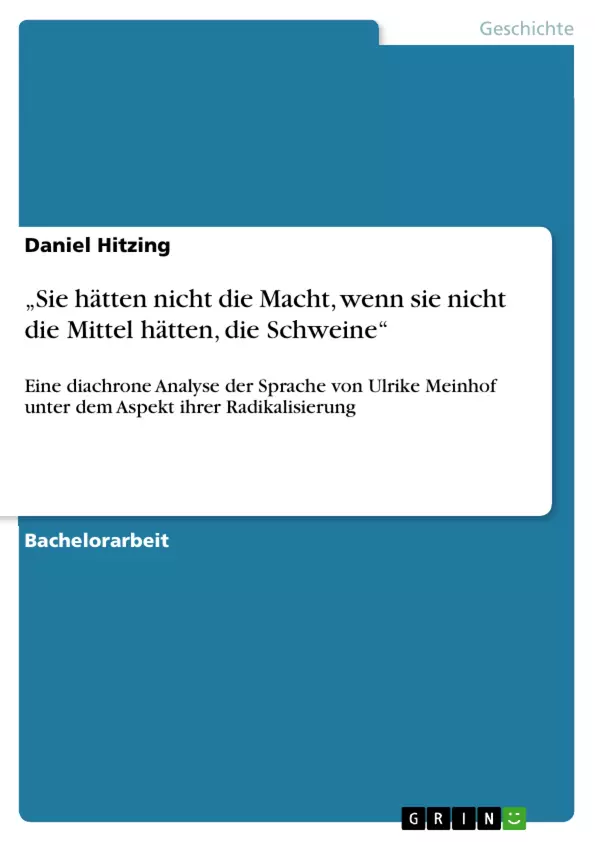Wenn Ulrike Marie Meinhof von Bullen und Schweinen sprach, war klar, dass nicht von Tieren die Rede war. Doch wie ist es zu deuten, wenn sie im „Spiegel“ vom 15. Juni 1970 zitiert wird mit: „und wir sagen, natürlich, die Bullen sind Schweine, wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein, das ist kein Mensch, und so haben wir uns mit ihm auseinander zu setzen. […] Natürlich kann geschossen werden.“ Während im „Konzept Stadtguerilla“ vom April 1971 zu lesen ist: „Wäre unsere Praxis so überstürzt wie einige Formulierungen dort, hätten sie uns schon.“ und „Wir schießen, wenn auf uns geschossen wird. Den Bullen, der uns laufen läßt, lassen wir auch laufen.“
Handelte es sich dabei um eine Entradikalisierung der Sprache, da Meinhof zuvor gemachte Aussagen relativierte?
„Wenn das System tabu ist, ist die Ordnung in Ordnung, weiß der Teufel, wer die Polizei entmenscht hat.“ , heißt es sarkastisch in „konkret“ Nr.4/1968. Hier bezeichnet sie die bundesdeutsche Ordnungsmacht noch als Polizei, bevor sie diese drei Jahre später selbst entmenschlicht. Handelt es sich dabei um einen Einzelfall oder radikalisierte sich die Sprache von Ulrike Meinhof generell in den Jahren 1968-1971? Handelt es sich doch nicht um eine gemäßigtere Sprache?
Diesen Fragen soll im Folgenden auf den Grund gegangen werden.
[...]
Der zentrale Teil der Arbeit ist die Textanalyse. [...] Aus ihrer Zeit bei der linksgerichteten Zeitschrift „konkret“, bei der sie von 1960-1964 Chefredakteurin war und danach weiterhin für die Zeitschrift Kolumnen schrieb, soll ein Text exemplarisch analysiert werden. Hierzu eignet sich meiner Meinung nach besonders gut der Artikel „Wasserwerfer – auch gegen Frauen. Student und Presse Eine Polemik gegen Rudolf Augstein und Konsorten“, weil er zum einen sehr viele Merkmale beinhaltet, die sich auch in ihren anderen Aufsätzen für „konkret“ zeigen und zum anderen, da er strukturelle und thematische Ähnlichkeiten zu dem Vergleichstext aufweist. Bei diesem handelt es sich um das „Konzept Stadtguerilla“, das als theoretische Grundlage der RAF gelten kann und im April 1971 veröffentlicht wurde.
Zwischen den Texten stehen zentrale Ereignisse, die eine Radikalisierung der Sprache bewirkt haben könnten. „Wasserwerfer“ und das „Konzept Stadtguerilla“ umschließen den Gang in den Untergrund und die Konstituierungsphase der RAF.
[...]
Ziel dieser Arbeit ist es primär, zu analysieren, inwiefern sich die Sprache von Ulrike Meinhof im Zeitraum 1968-1971 veränderte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorie und Methode
- 2.1 Quellenlage und Forschungsstand
- 2.2 Definition von „Radikalisierung“
- 2.3 Das Problem der Theorie und der Stellenwert der Methode
- 3. Zeithistorischer Kontext
- 3.1 Studentenbewegung und Journalismus
- 3.2 RAF und Terrorismus
- 4. Analyse der zentralen Texte
- 4.1 Wasserwerfer - auch gegen Frauen
- 4.1.1 Zum Text
- 4.1.2 Semantik
- 4.1.3 Syntax
- 4.1.4 Rhetorik und Stil
- 4.2 Das Konzept Stadtguerilla
- 4.2.1 Zum Text
- 4.2.2 Semantik
- 4.2.3 Syntax
- 4.2.4 Rhetorik und Stil
- 5. Auswertung
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Sprache Ulrike Meinhofs zwischen 1968 und 1971, um die Frage nach einer möglichen Radikalisierung zu beantworten. Es wird analysiert, ob sich die sprachliche Ausdrucksweise Meinhofs im Laufe dieser Zeit veränderte und welche Faktoren diese Veränderung möglicherweise beeinflusst haben.
- Analyse der sprachlichen Entwicklung Ulrike Meinhofs
- Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Kontext und Sprache
- Bewertung des Begriffs „Radikalisierung“ im Kontext der Arbeit
- Anwendung sprachanalytischer Methoden auf ausgewählte Texte
- Vergleich der sprachlichen Mittel in verschiedenen Texten Meinhofs
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Radikalisierung der Sprache Ulrike Meinhofs zwischen 1968 und 1971. Sie vergleicht gemäßigtere Äußerungen mit späteren, aggressiveren Formulierungen und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der eine Analyse ausgewählter Texte im Kontext der damaligen Zeit beinhaltet. Die Einleitung hebt die Bedeutung der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Sprachwandel und den politischen Ereignissen hervor.
2. Theorie und Methode: Dieses Kapitel beleuchtet die Quellenlage, den Forschungsstand und die methodischen Grundlagen der Arbeit. Die gute Quellenlage bezüglich Meinhofs Schriften wird hervorgehoben. Der Forschungsstand zu diesem Thema wird kritisch bewertet. Die Arbeit erläutert das Verständnis von „Radikalisierung“ und die verwendeten sprachanalytischen Methoden (Semantik, Syntax, Rhetorik und Stil), welche im anschließenden Kapitel Anwendung finden. Es wird die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit dem zeithistorischen Kontext betont.
3. Zeithistorischer Kontext: Der dritte Abschnitt der Arbeit befasst sich mit dem zeithistorischen Kontext, der die Entstehung und Entwicklung der analysierten Texte maßgeblich beeinflusst hat. Hier werden die Studentenbewegung und der Journalismus jener Zeit ebenso thematisiert wie die RAF und der Terrorismus. Es wird der wechselseitige Einfluss zwischen dem politischen Umfeld und den Texten Meinhofs herausgestellt.
4. Analyse der zentralen Texte: Dieses Kapitel stellt die Kernanalyse dar und untersucht ausgewählte Texte von Ulrike Meinhof, darunter "Wasserwerfer - auch gegen Frauen" und "Das Konzept Stadtguerilla". Die Analyse konzentriert sich auf semantische, syntaktische, rhetorische und stilistische Aspekte der Texte, um Veränderungen in der Sprache im Zeitverlauf zu identifizieren. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Texten, sowie der Einfluss des jeweiligen Kontextes auf die Sprache beleuchtet.
5. Auswertung: Dieses Kapitel, welches hier nicht weiter zusammengefasst wird, wertet die Ergebnisse der Textanalysen aus.
Schlüsselwörter
Ulrike Meinhof, Radikalisierung, Sprache, RAF, Studentenbewegung, Terrorismus, Textanalyse, Semantik, Syntax, Rhetorik, Zeithistorischer Kontext, Stadtguerilla, Politische Sprache.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der sprachlichen Radikalisierung Ulrike Meinhofs
Welche Themen werden in dieser Arbeit behandelt?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die sprachliche Entwicklung Ulrike Meinhofs zwischen 1968 und 1971. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und wie sich ihre Sprache im Laufe dieser Zeit radikalisierte. Analysiert werden der Zusammenhang zwischen Kontext und Sprache, die Anwendung sprachanalytischer Methoden auf ausgewählte Texte und der Vergleich der sprachlichen Mittel in verschiedenen Texten Meinhofs. Die Arbeit beleuchtet den zeithistorischen Kontext, insbesondere die Studentenbewegung, den Journalismus, die RAF und den Terrorismus.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Texte von Ulrike Meinhof, namentlich „Wasserwerfer - auch gegen Frauen“ und „Das Konzept Stadtguerilla“. Die Analyse konzentriert sich auf semantische, syntaktische, rhetorische und stilistische Aspekte, um Veränderungen in der Sprache im Zeitverlauf zu identifizieren.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet sprachanalytische Methoden, darunter die Analyse von Semantik, Syntax, Rhetorik und Stil der untersuchten Texte. Der methodische Ansatz beinhaltet eine Auseinandersetzung mit der Quellenlage, dem Forschungsstand und dem zeithistorischen Kontext.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Radikalisierte sich die Sprache Ulrike Meinhofs zwischen 1968 und 1971? Die Arbeit untersucht, ob sich gemäßigtere Äußerungen von früheren Texten von späteren, aggressiveren Formulierungen unterscheiden und welche Faktoren diese Veränderung möglicherweise beeinflusst haben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Theorie und Methode (inkl. Quellenlage, Forschungsstand und Definition von „Radikalisierung“), Zeithistorischer Kontext (Studentenbewegung, Journalismus, RAF, Terrorismus), Analyse der zentralen Texte („Wasserwerfer - auch gegen Frauen“, „Das Konzept Stadtguerilla“), Auswertung und Fazit/Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Arbeit detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ulrike Meinhof, Radikalisierung, Sprache, RAF, Studentenbewegung, Terrorismus, Textanalyse, Semantik, Syntax, Rhetorik, Zeithistorischer Kontext, Stadtguerilla, Politische Sprache.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für die akademische Nutzung bestimmt und dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise. Sie richtet sich an Wissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die sprachliche Entwicklung Ulrike Meinhofs und den zeithistorischen Kontext interessieren.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Die Arbeit enthält detaillierte Zusammenfassungen jedes Kapitels, welche die einzelnen Analysen und Ergebnisse beschreiben. Die vollständige Arbeit bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit den Themen.
- Arbeit zitieren
- Daniel Hitzing (Autor:in), 2009, „Sie hätten nicht die Macht, wenn sie nicht die Mittel hätten, die Schweine“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134852