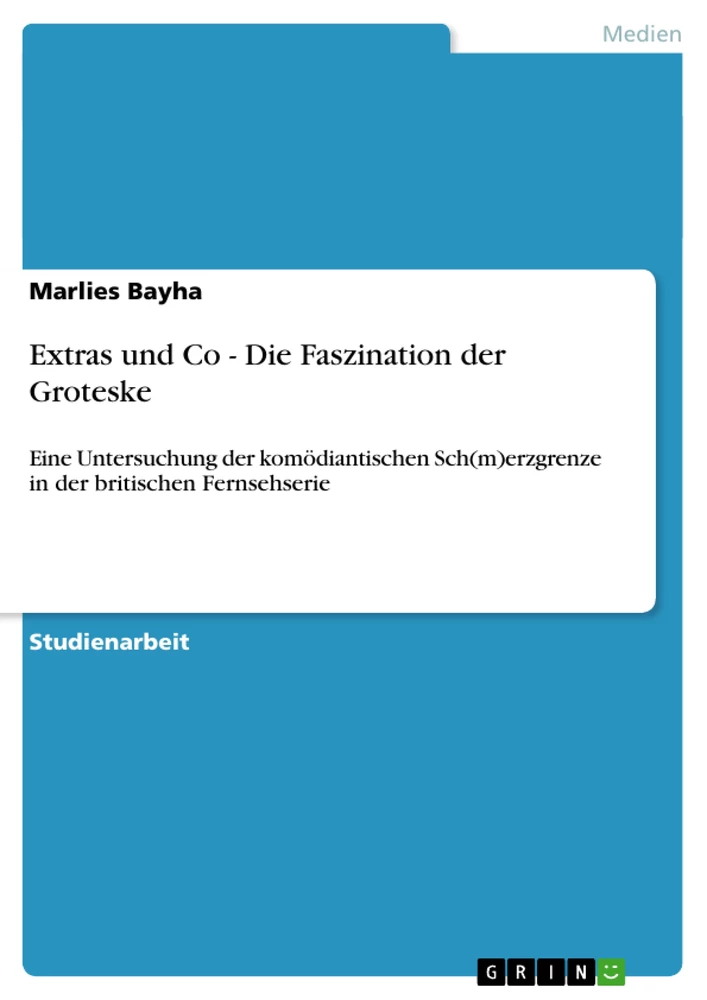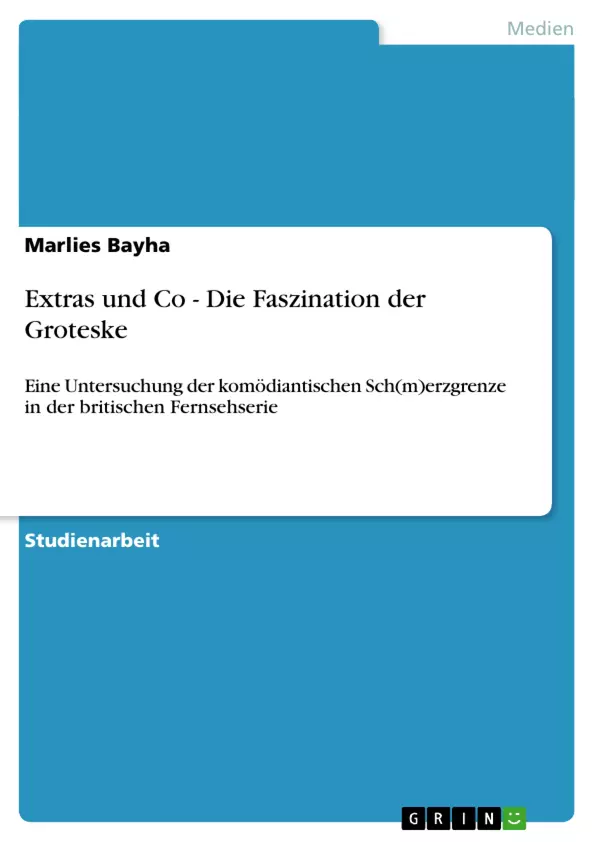„What makes Britain laugh? It's not an easy question to answer. [...] Of course, the British have changed a great deal in time. But many of the things which amused our parents, grandparents and even great-grandparents can still make us smile, chuckle, titter, chortle, splutter or guffaw today [...]. Some of the subjects may have changed [...] but others are much the same: we're still fascinated and infuriated by our mysterious class system, our politicians, our celebrities. Perhaps most of all, we're endlessly amused by ourselves and our bizarre habits.“
Das Zitat entstammt einem Artikel zum britischen Humor von Mark Duguid, Autor des Onlineportals des British Film Institute. So eigen und vielfältig der britische Humor ist, so scheint es Konstanten zu geben, die sich über Jahrzehnte halten und generationenübergreifend für schmunzelnde Mundwinkel sorgen. Insbesondere Absurdität, groteske Momente und sogenannte sozio-heikle Themen, wie sie auch Duguid nennt, scheinen einen Basispfeiler der britischen Komödie auszumachen. So finden sich die beiden britischen Serien Fawlty Towers und Extras – um die es im folgenden Text geht – im obigen Zitat wieder. Über verschrobene Angewohnheiten verfügen die Protagonisten allemal und während bei Fawlty Towers das zitierte Klassensystem thematisch an der Tagesordnung steht, bewegt sich bei Extras die britische und amerikanische Medienprominenz über das Serienparkett.
Um dem britischen Humor mit seiner Vorliebe für das Groteske auf den Zahn zu fühlen, strebt die folgende Arbeit eine Analyse der 70er Jahre Serie Fawlty Towers und dem 2005 erstmals ausgestrahlten Format Extras an, über das sich John Cleese, Gründer von Fawlty Towers, folgendermaßen äußerte: „The finest sitcom ever crafted since the cosmos was created. Except for mine“. [...]
Inhalt
1. Einleitung
2. Formelle Analyse
2.1 Extras
2.1.1 Rahmendaten
2.1.2 Das Figurenensemble – der Anti-Helden-Squad
2.2 Fawlty Towers
2.2.1 Rahmendaten
2.2.2 Das Figurenensemble
2.3 Direkter Vergleich – Rahmendaten
3. Entstehung der Komik
3.1 Eine Typologie der Groteske
3.2 Wurzeln der Komik
4. Fazit
5. Quellen
1. Einleitung
„What makes Britain laugh? It's not an easy question to answer. [...] Of course, the British have changed a great deal in time. But many of the things which amused our parents, grandparents and even great-grandparents can still make us smile, chuckle, titter, chortle, splutter or guffaw today [...]. Some of the subjects may have changed [...] but others are much the same: we're still fascinated and infuriated by our mysterious class system, our politicians, our celebrities. Perhaps most of all, we're endlessly amused by ourselves and our bizarre habits.“ [1]
Das Zitat entstammt einem Artikel zum britischen Humor von Mark Duguid, Autor des Onlineportals des British Film Institute. So eigen und vielfältig der britische Humor ist, so scheint es Konstanten zu geben, die sich über Jahrzehnte halten und generationenübergreifend für schmunzelnde Mundwinkel sorgen. Insbesondere Absurdität, groteske Momente und sogenannte sozio-heikle Themen[2], wie sie auch Duguid nennt, scheinen einen Basispfeiler der britischen Komödie auszumachen. So finden sich die beiden britischen Serien Fawlty Towers und Extras – um die es im folgenden Text geht – im obigen Zitat wieder. Über verschrobene Angewohnheiten verfügen die Protagonisten allemal und während bei Fawlty Towers das zitierte Klassensystem thematisch an der Tagesordnung steht, bewegt sich bei Extras die britische und amerikanische Medienprominenz über das Serienparkett.
Um dem britischen Humor mit seiner Vorliebe für das Groteske auf den Zahn zu fühlen, strebt die folgende Arbeit eine Analyse der 70er Jahre Serie Fawlty Towers und dem 2005 erstmals ausgestrahlten Format Extras an, über das sich John Cleese, Gründer von Fawlty Towers, folgendermaßen äußerte: „The finest sitcom ever crafted since the cosmos was created. Except for mine“ [3] .
Mit der Fokussierung auf die beiden Serien bleibt eine Fülle britischer Formate unberücksichtigt, wobei es sich um eine bewusste Reduktion im Sinne des Forschungsinteresses handelt, da es sich um zwei sehr prägnante britische Serien handelt was den Humor, insbesondere das Moment der Peinlichkeit und der Groteske als humoristisches Element, angeht. Der Schwerpunkt der Analyse liegt auf der Betrachtung der Groteske in beiden Formaten. Zusätzlich soll versucht werden herauszufiltern, ob sich im Zeitverlauf die Antworten auf die Fragen was darf man machen? Was geht zu weit? Wie peinlich, wie politisch korrekt beziehungsweise unkorrekt darf etwas sein? verändert haben. Natürlich ist eine solche Auswahl nicht nur von der Entstehungszeit, sondern vordergründig von den Machern und der Konzeption eines Formats abhängig. Die beiden Formate lassen sich keineswegs eins zu eins gleichsetzten, doch gelten die beiden Ideenstifter Gervais und Cleese gleichsam als Menschen, die sich keinen gesellschaftlichen oder medialen Konventionen beugen, kein Blatt vor den Mund nehmen und das Spiel mit öffentlicher Bloßstellung und Momenten der Peinlichkeit bei Ihren Figuren lieben. Mit dem Vergleich der Rahmendaten und der Figurenensembles widmet sich das zweite Kapitel der formellen Analyse der beiden Formate.
Dabei ist es keinesfalls Ziel der Arbeit einer normativen Fragestellung zu folgen und Werturteile in wissenschaftlichem Kleid zu fällen, inwieweit eine der beiden Serien als besser oder schlechter, als lustiger oder unlustiger anzusehen ist, was weder sinnvoll noch möglich wäre. Vielmehr beschäftigt sich der folgende Text mit der Analyse des Humors, der Groteske und den merkwürdigen und unangenehmen Situationen, die zum Teil hart an der Sch(m)erzgrenze des Zuschauers vorbeischrammen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der genannten Grenzüberschreitung und den sozio-heiklen Themen, mit denen sich die britische Comedyserie scheinbar gerne und der dritte Teil der Arbeit beschäftigt.
2. Formelle Analyse
2.1 Extras
2.1.1 Rahmendaten
“[Extras is] about excruciating social faux pas and the minutiae of human behavior. If our comedy can be described easily, it's embarrassment. […] What's the worst thing someone could say here? We like the audience feeling empathy with 'em.”[4]
- Ricky Gervais
Das Zitat von Ricky Gervais, einem der beiden Gründerväter von Extras, spiegelt das Selbstverständnis und die „Grundstimmung“ der Serie perfekt wieder. Als Gemeinschaftsproduktion von BBC2 und dem amerikanischen Sender HBO wurde Extras zwischen Juli 2005 und Dezember 2007 erstmals im britischen Fernsehen ausgestrahlt. Trotz großem Erfolg bei Kritikern und Publikum[5] beschränkt sich die Serie auf zwei Staffeln mit je sechs Episoden sowie einer 80-minütigen Abschlussfolge. Sendestart der ersten Staffel war am 21.07.2005, woraufhin die Serie wöchentlich Freitag abends von 21:00 – 21:30 Uhr auf BBC2 ausgestrahlt wurde. Nach knapp zwei Jahren Produktionspause wurde die zweite Staffel von September bis Dezember 2007 auf dem gleichen Sendeplatz gezeigt.[6]
Die Einschaltquoten des Formats können aufgrund fehlender Informationen nicht analysiert werden, doch lässt sich ausschließen, dass Extras aufgrund von fehlenden Zuschauerzahlen auf zwei Staffeln begrenzt wurde. Vielmehr verbirgt sich dahinter der bewusste Entschluss des Gründerteams Ricky Gervais und Stephen Merchant, die Serie zu begrenzen und eine Art Qualitätssicherung zu verfolgen, anstatt dem kommerziellen Anreiz zu verfallen, das Format unbefristet weiter zu produzieren.
Für Idee, Drehbuch, Regie und große Teile der Produktion zeichnen ebenfalls Gervais und Merchant verantwortlich, die bereits für das international erfolgreiche Format The Office zusammengearbeitet haben.[7] Dies ist in sofern von Bedeutung, als dass der vorangegangene Erfolg von The Office und die daraus entstandene Zusammenarbeit mit dem Sender HBO und Größen der amerikanischen Film- und Fernsehbranche für die Realisierung von Extras wohl unabdingbar war.
Das Konzept der Serie beinhaltet, dass pro Folge prominente Gaststars auftreten. Sie spielen entweder eine verdrehte Version ihrer Selbst beziehungsweise des öffentlichen Bildes ihrer Person und dem von den Medien vermittelten Image, oder eine authentische, jedoch überspitzte Version ihres öffentlich wahrgenommenen Personenbildes und ihrer Lebensgeschichte. Als Beispiel lassen sich der englische Moderator Les Dennis und der Jungschauspieler Daniel Radcliffe nennen. Les Dennis verkörpert in der Serie eine bemerkenswert ehrliche, wenn auch zugespitzte Version seiner Selbst. Persönliche und berufliche Tiefschläge, die sich in seiner Lebensgeschichte finden, werden detailverliebt thematisiert, in aller Peinlichkeit zelebriert und auf 30 Minuten zugespitzt. Der Ehebruch seiner Ex-Frau Amanda Holden, Karrieretiefs und Selbstzweifel[8] – alles Ereignisse im Lebenslauf eines Prominenten, auf die sich die Boulevardpresse stürzt - werden in der Folge satirisch und glaubhaft thematisiert.
Dem gegenüber steht der Gastauftritt des Harry Potter -Darstellers Daniel Radcliffe, der als verdrehte und seitenverkehrte Version seines öffentlichen Images auftritt. Als pubertierendes Muttersöhnchen, das nur an Sex und Drogen interessiert ist, ohne dies erfolgreich umsetzen zu können, spielt Radcliffe entgegengesetzt zu der öffentlichen Wahrnehmung seiner Person, die oftmals auf die Figur des Harry Potter reduziert und festgelegt zu sein scheint. Als vom Schicksal gebeutelte Waise mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein, dem Herzen am richtigen Fleck und einem Sinn für die Rettung der Welt - worauf sich das Harry Potter -Image grob zusammenfassen lässt - stellt Radcliffe innerhalb der Serie die öffentliche Rezeption seiner Person komplett auf den Kopf.
Aus den seitenverkehrten und überspitzen Versionen der medialen Images entsteht ein großer Teil der Komik bei Extras. Hierfür ist es allerdings wichtig die Stars und deren öffentliche Fremdwahrnehmung zu kennen. Es ist ein gewisses Vorwissen von Nöten, um die Absurdität, Authentizität und Komik der Situationen zu erkennen. Zahlreiche Situationen bekommen durch die Gastprominenz eine andere und besondere Qualität. Hierbei ist insbesondere der Auftritt von David Bowie zu nennen. Bowie singt in einem Nachtklub ein zerschmetterndes Lied über den Protagonisten Andy und dessen Defizite. Durch die Person Bowie bekommt das Lied eine völlig andere Qualität und einen gesteigerten Grad der Demütigung für Andy, als wenn es von einer unbekannten, fiktiven Figur gesungen worden wäre.
Dem Phänomen des benötigten Vorwissens folgend, handelt es sich bei dem Großteil der Gaststars um tatsächliche Größen der Medienbranche. Insbesondere in der zweiten Staffel treten Größen der US-amerikanischen Prominenz auf, deren Image den meisten Rezipienten geläufig sein dürfte. Die Stars für die Serie zu gewinnen, wäre ohne den vorangegangenen Erfolg von The Office und den daraus entstandenen Beziehungen sicherlich nicht möglich gewesen.
Obwohl die Gastauftritte und die daraus gestrickten skurrilen Situationen einen großen Anteil an dem grotesken Humor haben, wäre es mehr als vermessen, das Hauptaugenmerk bei der Charakterisierung der Komik der Serie hierauf zu begrenzen.
Die eigentlichen Stars von Extras und die Verantwortlichen für die größten Momente der Peinlichkeit und Komik finden sich im festen Figurenensemble, bestehend aus dem frustrierten und erfolglosen Schauspieler Andy Millman (Ricky Gervais), seiner besten und einzigen Freundin Maggie Jacobs (Ashley Jensen), seinem untalentierten und nutzlosen Agenten Darren Lamb (Stephen Merchant) sowie aus dessen Gehilfe und einzigem weiteren Klient „Barry“ (Shaun Williamson).[9] Auf die Charaktere und deren Funktion wird im folgenden Kapitel eingegangen.
Thematisch baut sich die erste Staffel um Andys Kampf eine Sprechrolle zu ergattern und sein Leben als un(an)erkannter Statist an den Nagel zu hängen. Innerhalb dieses Strebens liegt der thematische Schwerpunkt auf der Konstruktion von gesellschaftlichen Faux pas und der Verarbeitung sozio-heikler Themen.
"The first series was about that dream, aspiration people trying, [...] The second series was, I suppose, be careful what you wish for. And in this one [Extras Christmas Special] , he's doing ok and he's got all the fame and all the fortune but now it's just not enough."[10]
Das Zitat von Gervais beschreibt die inhaltliche Entwicklung der Serie. Der thematische Fokus verschiebt sich mit dem Beginn der zweiten Staffel, der gleichzeitig den Beginn Andys eigener Sitcom when the whistle blows darstellt, zu dem Kampf darum, als Schauspieler ernst genommen, von den Kritikern gefeiert zu werden und nicht nur „dumme“, platte Comedy zu machen. Die zweite Staffel wirkt thematisch ernsthafter, erzeugt dementsprechend aber auch „noch schlimmere“ Situationen für Andy und sein Ego. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Dekonstruktion von Andys übersteigertem Selbstwertgefühl, seinen Vorurteilen und seinen selbstgesetzten Ansprüchen, anspruchsvolle Comedy zu machen beziehungsweise als ernsthafter Schauspieler wahrgenommen zu werden. Blamagen und Fehltritte werden durch die eigene Sitcom und deren kommerziellem Erfolg einer größeren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gervais nimmt dabei sein eigenes Metier und sich selbst schonungslos unter Beschuss und zeigt einen außergewöhnlichen Grad an Selbstreflektion, indem er eine Comedyserie schafft, die die Entstehung einer Comedyserie beschreibt und dekonstruiert.
2.1.2 Das Figurenensemble – der Anti-Helden-Squad
"Extras" is more of a traditional sitcom, really. There are stories, there are plots, but it's still a character-based piece.“ [11]
- Ricky Gervais
Die Äußerung von Gervais entstand im Rahmen eines Vergleichs von The Office und Extras. Obwohl das Zitat aus dem Vergleichskontext losgelöst ist, trifft es das Herzstück der Serie: das Figurenensemble oder - der Anti-Helden-Squad.
Trotz der ausgeprägten und beschriebenen Handlungsstränge, entstehen die Beson-derheit, der Charme und der Großteil der Komik durch die Figuren. Dreh- und Angelpunkt des Ensembles ist der Schauspieler Andy. Geplagt von Neurosen und einem unerfüllten Geltungsbedürfnis, schafft es Andy sich durch seine charakteristische und ausgeprägte Hybris mit untrüglichem Talent in die peinlichsten Situationen zu manövrieren:
„I can't stand lateness, I can't stand noise, a noisy restaurant - it drives me mad. And I've put all of these neuroses and hates into Andy Millman.“ [12]
Gervais schafft es zuverlässig, für Andy extrem peinliche Situationen zu generieren beziehungsweise ihn deren Opfer werden zu lassen. Um beispielsweise seine Chancen bei einer religiösen Frau zu erhöhen, gibt sich der atheistische Andy als Katholik aus. Da er nicht die geringste Ahnung von deren Sitten und Bräuchen hat, redet er sich um Kopf und Kragen.[13] Während sich Andy in der beschriebenen Szene selbstverschuldet in das finale „Fettnäpfchen“ manövriert, beginnen die meisten der katastrophal enden Situationen harmlos. Andy versucht die Missverständnisse oder Faux pas Anderer (meistens von Maggie) zu retten, verstrickt sich dabei unbeabsichtigt in die Situationen und versetzt sich meist selbst den finalen Todesstoß in die Peinlichkeit. Hier finden sich Parallelen zu der Figur des Basil Fawlty, dem Protagonisten von Fawlty Towers, worauf in Kapitel 2.3 genauer eingegangen wird.
Andy fungiert trotz der Neurosen und Verschrobenheiten als rationaler Gegenpart zu Maggie und Darren. In einer Welt voller Absurditäten
wirkt seine Figur im Vergleich zum restlichen Cast wie der personifizierte gesunde Menschenverstand. In diesen Situationen wird er zur
Identifikationsfigur und dem Sprachrohr des Zuschauers
. Er macht die Absurdität vieler Kommentare und Handlungen deutlich und vermittelt Gedanken und Gefühle, die dem Zuschauer bei der Rezeption von Maggies und Darrens - zum Teil wahnwitzigem - Verhalten durch den Kopf schießen. Trotz den ausgeprägtesten intellektuellen Fähigkeiten geht Andy zuverlässig als “Opfer” peinlicher Situationen hervor. Er bricht die Identifikation durch moralisch unangemessene Kommentare, die oftmals nicht so gemeint sind wie sie bei seinem Gegenüber ankommen oder unbedacht aus ihm herausbrechen. Innerhalb des Ensembles verfügt Andy über den h
öchsten Grad an Selbstreflektion. Sein Bewusstsein über die eigene Blamage erzeugt beim Zuschauer das ausgeprägteste “Mitleiden” und den höchsten Grad des Fremdschämens. Das Phänomen des eigenen Bewusstseins der Peinlichkeit als humoristisches Schlüsselelement wird von Gervais im folgenden Zitat auf den Punkt gebracht:
“[I]f you're not embarrassed, then it's not embarrassing for anyone else. But if someone's embarrassed, that's embarrassing. […]If someone goes to the toilet and they come out and there's a big wet part, but no one says anything, then they discover it, how embarrassing is that? What if you come out and say, "Look, I pissed myself," right? It's not embarrassing.”[14]
[...]
[1] Duguid, Mark: The British Sense of Humor. In: Screenonline, Onlineportal des British Film Institute. Online abrufbar unter: http://www.screenonline.org.uk/tours/humour/tourBritHumour1.html.
[2] Im Folgenden wird dieser Begriff verwendet um bestimmte Themen zu deklarieren und eine Redundanz in deren Erklärung zu vermeiden. Der Begriff bezeichnet Themen, die dazu einladen einen sozialen Faux pas zu begehen und thematisch ein erhöhtes Potenzial bieten in ein Fettnäpfchen zu treten und gewollt oder unbeabsichtigt gesellschaftlich und politisch inkorrekt zu sein (oder zu erscheinen). Es handelt sich um Themen, die Kontroversen und „thematische Brennpunkte“ in einer Gesellschaft darstellen. Auch in aufgeklärten Gesellschaften gehören (Homo)Sexualität, Religion, Behinderungen, Minderheiten, Rassismus, Intoleranz beziehungsweise übertriebene Toleranz und der daraus entstehende unsichere Umgang mit „heiklen Themen“ zu Bereichen, die kontrovers diskutiert werden und schwierig sind. Bei der Interaktion von Menschen können hier gehäuft Schwierigkeiten auftreten.
[3] John Cleese über Extras. Online abrufbar unter: http://www.rickygervais.com/2extras2.php.
[4] Interview mit Ricky Gervais bei HBO, 2008. Online abrufbar unter: http://www.hbo.com/extras/interviews/gervais2.html (2ter Teil), Zugriff: 22.03.08.
[5] Zu den Einschaltquoten, dem Marktanteil und dem Kernpublikum liegen leider keine glaubwürdigen Informationen vor. BBC2 veröffentlicht keine Daten dieser Art. Dementsprechend musste auf eine detaillierte Analyse der Rezipienten und Marktanteile verzichtet werden.
[6] Vgl. Internetauftritt von Extras bei BBC2. Online abrufbar unter: http://www.bbc.co.uk/comedy/extras/index.shtml. Zugriff: 20.03.08.
[7] Vgl. Ebd.
[8] Vgl. Dennis, Les (2008): Must the show go on? S.108 ff.
[9] Vgl. http://www.bbc.co.uk/comedy/extras/.
[10] Holt, Richard: Ricky Gervais and the Extras Christmas Specia l. In: The Telegraph, 02.12.07. Online abrufbar unter: http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2007/12/07/nextras107.xml.
[11] Interview mit Ricky Gervais bei HBO, 2008. Online abrufbar unter:
http://www.hbo.com/extras/interviews/gervais2.html.
[12] Ebd.
[13] Vgl. Extras 1. Staffel, Folge 3.
[14] Interview mit Ricky Gervais bei HBO, 2008. Online abrufbar unter: http://www.hbo.com/extras/interviews.
Häufig gestellte Fragen
Was macht den britischen Humor in Serien wie „Extras“ aus?
Zentrale Elemente sind Absurdität, Groteske und das Zelebrieren peinlicher Situationen sowie die Auseinandersetzung mit sozio-heiklen Themen.
Worum geht es in der Serie „Extras“ von Ricky Gervais?
Die Serie handelt von Statisten (Extras) und nutzt prominente Gaststars, die oft eine überspitzte oder ins Gegenteil verkehrte Version ihres eigenen Images spielen.
Wie wird die Groteske in „Fawlty Towers“ eingesetzt?
Die Serie nutzt das britische Klassensystem und die neurotischen Angewohnheiten des Protagonisten Basil Fawlty, um Komik durch soziale Grenzüberschreitungen zu erzeugen.
Warum spielen Gaststars in „Extras“ sich selbst?
Durch die satirische Verzerrung ihres realen Medienimages entsteht eine besondere Qualität der Demütigung und Komik, die Vorwissen beim Zuschauer voraussetzt.
Was ist das Ziel des Vergleichs der beiden Serien?
Die Arbeit untersucht, wie sich die Darstellung von Peinlichkeit und politischer Unkorrektheit über die Jahrzehnte (70er Jahre vs. 2000er) verändert hat.
- Citar trabajo
- Marlies Bayha (Autor), 2008, Extras und Co - Die Faszination der Groteske, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/134872